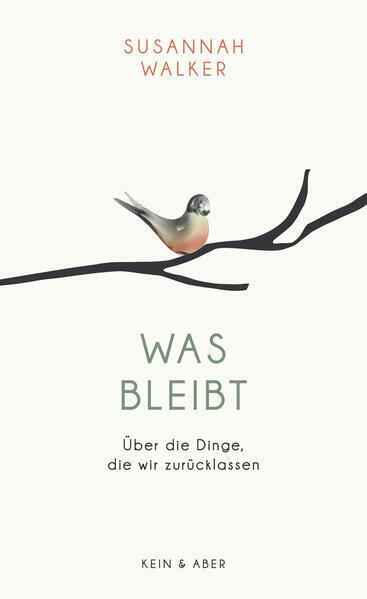Wenn die Dinge zu sprechen beginnen
Julia Kospach in FALTER 41/2018 vom 10.10.2018 (S. 37)
Warenwelt: Susannah Walker erzählt über die Dinge, die wir zurücklassen, und darüber, was diese über uns erzählen
Wie soll man dieses Buch beschreiben? Vielleicht als alltagsarchäologische Studie. Oder als raffiniertes, von hinten aufgerolltes Porträt einer brüchigen Mutter-Tochter-Beziehung. Man könnte es aber auch psychologische Fallgeschichte, Familienchronik oder anthropologische Theorie der Dinge nennen, in die zudem noch eine gehörige Portion Designgeschichte hineingemischt ist. Am ehesten ist das Buch eine Mischung aus all diesem.
Solche Bücher finden in einem Buchmarkt, der äußersten Wert auf klare Etiketten legt, in der Regel nur schwer einen Verlag. Denn der Buchhandel sträubt sich gegen Bücher, von denen er nicht weiß, in welches Regal er sie einordnen soll. Wenn solche schwer schubladisierbaren Hybridwerke trotzdem erscheinen, haben die Leserinnen und Leser an ihnen besondere Freude, denn das bedeutet zumeist, dass sie besonders gut sind. So auch hier.
Das außergewöhnliche und kluge Buch, um das es geht, trägt den Titel „Was bleibt. Über die Dinge, die wir zurücklassen“. Geschrieben hat es die britische Designhistorikerin, Kuratorin und Literaturwissenschaftlerin Susannah Walker, die im Hauptberuf Designbücher publiziert und als Beraterin für TV-Sendungen zu Kunst, Architektur und Lifestyle tätig ist. Hier beschäftigt sie etwas ganz anderes – allerdings so, dass auch hier ihre Expertise einfließen kann: Susannah Walker schreibt über den Tod ihrer Mutter und darüber, was die Dinge in deren Haus in Worcester über die Mutter, sie selbst und die Familiengeschichte erzählen.
Es ist eine Situation, die uns allen nach dem Tod naher Verwandter bevorsteht: Hinterlassenes aussortieren, Ordnen, Aufheben und Wegschmeißen, Bilanz ziehen – im Wort- wie im übertragenen Sinn. In Walkers Fall ist es ein besonders dorniger Weg, denn ihre Mutter war eine schwierige, unglückliche Person. Ihr Lebensweg ist von Verlust, Einsamkeit und Alkoholismus gezeichnet und mündete im Alter in ein an Messietum heranreichendes Horten von Dingen. Die Mutter hinterließ Walker ein Haus, dessen Anblick tiefe Scham mit Ratlosigkeit und Überforderung hervorrief. Dazu kommt, dass Walker nach der Scheidung ihrer Eltern ab acht beim Vater aufwuchs. Zeitlebens blieb die Beziehung zu ihrer ehemals so eleganten, klugen Mutter mehr als kompliziert.
Mit fast schon manischer Energie macht sich Walker daran, aus den verdreckten und von Mief, Zigarettenrauch und Feuchtigkeit zerstörten Gegenständen im Haus ihrer verstorbenen Mutter zu lesen – wie eine Archäologin in einer Fundstätte. Wonach genau sucht sie? Letztlich wohl danach, dass sie ihrer distanzierten Mutter doch viel bedeutet haben könnte. Stattdessen fördert sie eine sie betreffende Notiz in mütterlicher Handschrift zutage: „Geburt der zweiten Tochter. Schlief nur wenig. Ein unerträgliches Kind.“
Walker, das ungeliebte, energiegeladene Kind einer schattenhaften Mutter, wendet alle Kraft auf, um zu rekonstruieren, wo das traurige, enttäuschungsbereite Wesen ihrer Mutter seine Wurzeln hatte, und fördert aus deren Hinterlassenschaften eine zwiespältige Geschichte zutage, in der Snobismus und Trennung, Kindstod und Verschweigen, Verlust und Einsamkeit sich schon seit Generationen erbarmungslos weitervererben. Gleichzeitig geht es aber natürlich auch um die vielen seltsamen Gesichter der Trauer – und um das Tabu, dass in der Trauer von Hinterbliebenen eine riesige Portion Erleichterung, Entlastung und sogar Freude enthalten sein kann.
Als Erinnerungsbuch befasst sich „Was bleibt“ auch mit der zutiefst menschlichen Strategie, Besitztümer aller Art als Bollwerk gegen Kränkung, Schmerz und Verlust anzuhäufen, und kommt dabei notgedrungen zu der universellen Frage, ob und in welcher Weise die Dinge, die wir besitzen, für uns sprechen, uns ausmachen oder sogar die Überhand über unser Leben gewinnen können. Wie sie diese Einsichten aus Alltagsgegenständen und Erinnerungsstücken gewinnt, wie sie dabei in die Geistes- und Kunstgeschichte und in die Psychologie mäandert und wie sie all das Kapitel für Kapitel in ein Buch verwandelt, ist ebenso faszinierend wie die grandiose Aufrichtigkeit, mit der sie ihre eigene Rolle und ihre eigenen Sehnsüchte analysiert. Am Ende weiß sie, dass sie nie ein geliebtes Kind war, aber mit ihrer Mutter wohl eines gemeinsam hatte: eine ausgeprägte Fähigkeit, Dinge mit Leben und Bedeutung zu erfüllen. Vielleicht, weil sich Dinge im Endeffekt als verlässlicher erweisen können als Beziehungen.