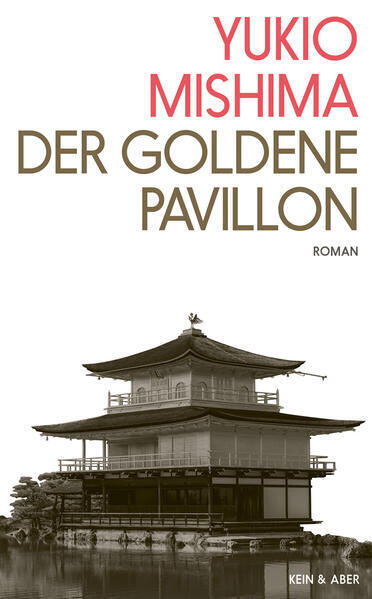Des Schrecklichen Anfang
Walter Ruprechter in FALTER 11/2020 vom 11.03.2020 (S. 12)
„Der Goldene Pavillon“, ein Schlüsselwerk des schillernden Yukio Mishima, liegt in neuer Übersetzung vor
Das literarische Werk des japanischen Schriftstellers Yukio Mishima steht nach wie vor im Schatten seines spektakulär inszenierten Freitods (Seppuku) vor 50 Jahren im Hauptquartier der Selbstverteidigungskräfte in Tokio. Der Samurai-Tod auf offener Bühne war sein letzter radikalnationalistischer Akt, ein Statement gegen eine schal gewordene Wirklichkeit der Egalität und des Kommerzes, die nach dem Krieg auch den japanischen Alltag prägte.
Mishima hatte ein Faible für starke Inszenierungen und rebellische Gesten, die sein früh begonnenes Schaffen ebenso wie sein früh beendetes Leben durchziehen. Sein Interesse für die herostratische Tat eines Novizen, der im Juli 1950 ein nationales Heiligtum, den Goldenen Pavillon in Kyoto, in Brand steckte, mag auch daher rühren. Mishima hat sich den Stoff sogleich als Romanvorlage angeeignet und den Motiven nachgespürt, indem er den Täter im Gefängnis besuchte. Erkenntnisse daraus, verbunden mit philosophischen Überlegungen, bilden die Grundlage für den 1956 publizierten Roman, der nun unter dem Titel „Der Goldene Pavillon“ in einer neuen Übersetzung erschienen ist.
Mishima erzählt die Geschichte in Anlehnung an das historische Ereignis, allerdings als Entwicklung einer Obsession des Novizen Mizoguchi, der durch körperliche Gebrechen (er ist hässlich und stottert) von seiner sozialen Umwelt entfremdet ist.
Der Weg in ein normales Leben wird ihm vom Schönheitsideal des Goldenen Pavillons verstellt, das ihn sein Vater, ein Zen-Priester, schon als Kind eingeimpft hat und das sich in entscheidenden Lebenssituationen (etwa der Begegnung mit Frauen) als hemmende Vision zwischen ihn und die Realität schiebt. Mizoguchi errichtet sich eine Welt aus Ressentiments und untermauert sie mit existentialistischen Gedanken, die ihn zur Überzeugung bringen, dass der Pavillon zerstört werden muss. Auf diese Weise wird das vergoldete Bauwerk aus dem 14. Jahrhundert zu seinem eigentlichen Gegenspieler, wobei das Verhältnis zu diesem von Hassliebe, von Anziehung und Abstoßung, geprägt ist: „Es war nicht allzu lange, dass mich das Phantom des Goldenen Pavillons so völlig umfangen hielt. Als ich wieder zu mir kam, hatte er sich bereits zurückgezogen. Nun war er nur noch ein Gebäude, das nordöstlich in der Gegend von Kinugasa lag, und von hier aus unmöglich zu erkennen. Der illusionäre Moment, in dem der Kinkaku mich angenommen und umarmt hatte, war vorüber.“
Mishima erzählt aus der Perspektive des Protagonisten, entfaltet eine Innenschau von dessen Obsessionen. Mizoguchis Wahrnehmungen erweisen sich oft als Trugbilder, und Begegnungen mit anderen Figuren bleiben zumeist rätselhaft und von Missverständnissen geprägt, was vor allem für den Prior des Tempels gilt, der ihn mit seinen undurchschaubaren Handlungen in Unruhe versetzt. In der Versprachlichung der Wahnideen und ihrer Umsetzung in eine spannende Romanhandlung zeigt sich Mishimas literarische Meisterschaft, für die er lange als Nobelpreiskandidat gehandelt wurde.
Ursula Gräfe hat für die Übersetzung dieses Werks eine Tonlage gefunden, die sowohl Mishimas bildgenauem und klarem Stil als auch der Pathologie des Ich-Erzählers gerecht wird. In ihrem Nachwort weist sie auch auf die Erstübersetzung durch Walter Donat hin, die 1961 unter dem Titel „Der Tempelbrand“ erschienen ist, und führt deren „älteren Sprachstand“ (wohl ein Euphemismus für Nazi-Jargon) als Begründung für ihre Neuübersetzung an.
Dezent verschweigt sie dabei, dass Donat während des Krieges in Tokio als „Kulturwart“ und Leiter des Japanisch-Deutschen Kulturinstituts sein Unwesen im Dienste Nazi-Deutschlands trieb.
Dass Mishima in faschistischen Kreisen rezipiert und verehrt wird, hat Tradition, beruht aber auf einem Missverständnis, das im abstrusen Charakter seines seit den 1960er-Jahren offen zur Schau gestellten Nationalismus und vom Seppuku besiegelten politischen Aktionismus gründet. Ob dieser letzte Akt als „Putsch“ oder als „Performance“ (wie Gräfe vorschlägt) zu bezeichnen ist, lässt sich kaum entscheiden. Denn in Mishimas Kunstauffassung findet sich eine verworrene Gemengelage von politischen und ästhetischen Elementen, wie auch bei seinem Vorbild Gabriele D’Annunzio, dessen Besetzung von Fiume 1919 als „poetischer Staatsstreich“ bezeichnet wurde.
Wie dieser war Mishima ein Schriftsteller-Dandy, der sein Leben in widersprüchlichen Posen zwischen Bodybuilder und heiligem Sebastian und schließlich im Suizid als Samurai inszenierte. Schon sein erster Erfolgsroman „Bekenntnisse einer Maske“ ist ein Spiel mit Dichtung und Wahrheit, das er zeitlebens mit sich selbst und anderen getrieben hatte. Paradox erscheint auch die Rechtfertigung seiner nationalistischen Aktivitäten in einem Interview, das er einem amerikanischen Journalisten in seiner eklektizistischen Luxusvilla in Tokio gab.
Die Verbindung von westlichen mit traditionellen japanischen Konzepten war für Mishima immer ein Thema gewesen. Er suchte Nietzsches Artisten-Metaphysik mit dem Hagakure, der Ethik der Samurai, zu verbinden, und Rilkes berühmte Zeile aus den „Duineser Elegien“, „das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang“, könnte auch als Motto über dem „Goldenen Pavillon“ stehen.
Dieser Roman ist nicht nur literarisch ein Meisterwerk, sondern durchaus auch politisch aktuell, indem er zeigt, welch zerstörerische Kräfte das Ideal von Reinheit und Schönheit in einem von der Lebenswelt ausgeschlossenen Menschen freizusetzen vermag