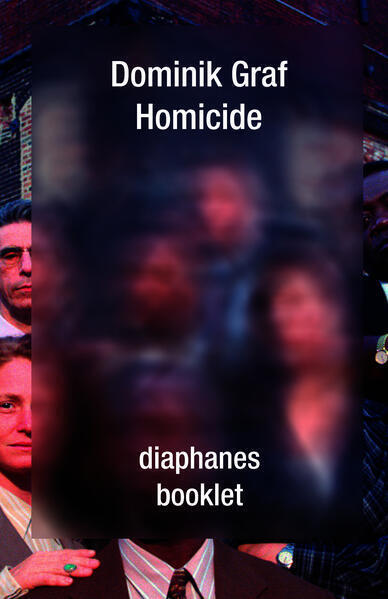"Im ,Tatort' kommt der deutsche Film zu sich"
Klaus Nüchtern in FALTER 12/2013 vom 20.03.2013 (S. 24)
Mit seinen Krimis hat Dominik Graf Filmgeschichte geschrieben. Der deutsche Regisseur liebt das Fernsehen und TV-Serien, weil er weiß, wozu die gut sind
Dominik Graf, 60, ist der höchstdekorierte Genrearbeiter im deutschen Fernsehen. Vor allem das Krimi- und Polizeifilmfach hat es dem Münchner Sohn eines Schauspielerehepaars angetan. Er hat bei Serien wie "Der Fahnder", "Tatort", "Sperling" oder "Polizeiruf 110" Regie geführt, mit "Die Katze" (1988) einen Kriminalfilmklassiker des deutschen Kinos gedreht und zuletzt mit seiner Russenmafiaserie "Im Angesicht des Verbrechens" (2011) die Zuschauer vor den Fernseher gelockt.
Bevor es nach Wien geht, wo das Filmmuseum eine Werkschau des Regisseurs präsentiert und diesem auch Carte blanche gegeben hat, einige seiner Lieblingsfilme zu zeigen, ist er bei der Diagonale zu Gast. Nach einem eher unsanften Flug von München nach Graz landet Graf im österreichischen Winter und kommt direkt zum Falter-Gespräch ins Foyer der UCI Kinowelt, wo nach einiger Zeit auch eine Ecke gefunden wird, die nicht völlig popcornversaut und möglichst weit vom nächsten vor sich hindudelnden Lautsprecher entfernt ist. Graf möchte jetzt erst mal ein Cola.
Falter: Sitzen Sie jeden Sonntag um 20.15 Uhr vor dem Fernseher?
Dominik Graf: Ich schaue mir zumindest bei fast jedem "Tatort" die ersten zehn Minuten an und entscheide dann, ob ich dranbleibe.
Sie boykottieren nicht grundsätzlich bestimmte Kommissare?
Graf: Nein.
Nicht einmal die Österreicher?
Graf: Die schon gar nicht. Nix gegen Fritz Eckhardt!
Der ist allerdings seit circa 25 Jahren außer Dienst und seit circa 20 Jahren tot.
Graf: Aber auch Harald Krassnitzer und seine Kollegin sind doch gerade wieder in Hochform. Da geht ziemlich die Post ab! Man darf den Kritikern beim "Tatort" nicht glauben. Die haben auch schon so einen politisch korrekten Blick und schauen immer, ob das "Thema" auch ordentlich behandelt wurde.
Und Til Schweiger als neuer "Tatort"-Kommissar?
Graf: Zu dem sag ich nix.
(Lachen seitens der Falter-Redakteure.)
Graf: Nein, nein, ich fand ihn ganz gut, will aber wirklich nicht ins Detail gehen. Der Schweiger hat sich schon ein paar Mal über mich beschwert und mir neulich bei einer Preisverleihung den Handschlag verweigert. Ich habe offenbar irgendwann mal was Falsches gesagt. Auch wenn ich etwas Positives sagen würde, bekäme er es sicher in den falschen Hals. Wenn jemand schnell beleidigt ist, muss man aufpassen.
Man hat jedenfalls versucht, den "Tatort" mit ihm Richtung Actionfilm zu drehen.
Graf: Das finde ich grundsätzlich lobenswert. In den letzten zehn Jahren war es im "Tatort" ja immer so, dass es nach 30 Minuten eine Verfolgungsjagd mit zwei Autos durch eine enge, sehr gut absperrbare Straße gab, die nach fünf Sekunden wieder vorbei war. Da merkte man, dass die Sparpolitik schon den Autoren Fußfesseln angelegt hatte. Til Schweiger aber schießt in den ersten zehn Minuten einfach drei Mädchenhändler ab und zuckt mit den Achseln. Und auch der Film zuckt mit den Achseln: haben sich halt in den Weg gestellt. Diese Nonchalance hat mir schon gefallen.
Sie selbst werden demnächst wieder einen neuen "Tatort" drehen. Können Sie über den schon was verraten?
Graf: Unter den wahnsinnig vielen TV-Krimis, die ich gemacht habe, sind eigentlich relativ wenige "Tatorte": ein Schimanski und einer mit den beiden Münchnern ("Frau Bu lacht" von 1995, Red.). Jetzt kommt wieder einer mit Batic und Leitmayr, weil ich mit denen Geschichten erzählen kann, die mit thematisch weniger belastbaren Kommissaren nicht funktionieren. Außerdem kommt hinzu, dass München für mich noch immer nicht auserzählt ist.
Ein Heimspiel also. Worum wird es gehen?
Graf: Um Gentrifizierung, was in München ein brandaktuelles Thema ist. Die Zeitungen sind voll davon. Es steckt eine unendliche Habgier dahinter, und die Stadt verödet natürlich, wenn es nur noch Wohnungen und keine Hinterhöfe mit Betrieben mehr gibt. Das ist aber nur die Oberfläche, darunter liegt dann ein Fall, der wesentlich tiefer geht.
Batic und Leitmayr hätten sich nach einer Durststrecke wieder einmal einen richtig guten "Tatort" verdient.
Graf: Fanden Sie die denn schwach?
Na ja, der mit den beiden Brüdern und ihren Eltern ("Der traurige König", 2011) war schon sehr okay.
Graf: Der war gut und wurde bei mir ums Eck gedreht. Und der zum Jahreswechsel mit Fabian Hinrichs ("Der tiefe Schlaf", Red.) war ganz toll. Am Ende haben sie den Mörder eigentlich, werden es aber nie sicher wissen, weil der vor ihren Augen überfahren wird. So einen Schluss muss man sich auch erst einmal trauen!
"Der oide Depp" mit den Rückblenden ins Rotlichtmilieu der 1960er-Jahre, in denen Nicholas Ofczarek einen Zuhälter spielt, war eigentlich auch toll.
Graf: Der war super! Ich muss mich also schon anstrengen, dass ich dieses Niveau erreiche. Ich finde Batic und Leitmayr jedenfalls grandios.
Derzeit halten wir bei einem Höchststand von 21 "Tatort"-Teams. Ist das nicht viel zu viel? Da behält doch niemand mehr den Überblick.
Graf: Ich befürchte auch, dass das Interesse durch Übersättigung kaputtgehen könnte. Dennoch habe ich das Gefühl, dass im "Tatort" oder auch beim "Polizeiruf" noch Filme zustande kommen, wie sie im Kino gar nicht mehr möglich sind. Das ist so bizarr, witzig, frech und auf den Punkt, da kommt der deutsche Film für einen Moment zu sich selbst. Im "Tatort" kann man noch außergewöhnliche B- oder C-Pictures machen, die man sonst in Deutschland gar nicht mehr finanziert bekommt. Wenn man die Leute fragt, was sie im vergangenen Jahr im Fernsehen fasziniert hat, kommen immer drei, vier "Tatorte" zusammen. Dagegen stinken die großen thematischen und eventhistorischen Unternehmungen doch total ab.
Wenn man Sie fragt: "Kino oder Fernsehen?", gibt's da Präferenzen
oder ist es Ihnen wurscht?
Graf: Wurscht ist es mir nicht. Das Kino finde ich immer wahnsinnig anstrengend. Es kostet automatisch das Doppelte, was es im Fernsehen kosten würde, und dieser Bohei sagt mir nicht sonderlich zu. Aber nun habe ich grad einen richtig großen Kostümfilm über Schillers Liebe zu den Schwestern Lengefeld gemacht, und das war schon auch sehr erfüllend. Grundsätzlich aber ist das Fernsehen für mich der bessere und angenehmere Ort, weil's schnell geht. Wenn ich eine Idee habe, dann soll es, bitte schön, nicht so lange dauern, bis die Darsteller tot sind.
Wie kommen Sie eigentlich zum Drehbuch bzw. was haben Sie da mitzureden?
Graf: Da wird man in der Regel sehr früh eingebunden. Im Grunde genommen ist es von Anfang an eine Zusammenarbeit zwischen der Redaktion, dem Drehbuchautor und dem Regisseur.
Werden die Spielräume für den Regisseur enger?
Graf: Ich bin schon sehr lange dabei, und man traut mir einfach zu, dass eine Szene schon was werden wird, wenn ich mich für sie stark mache. Junge Regisseure haben es da sicher schwieriger.
Sie müssen sich also nicht dauernd über Redakteure ärgern?
Graf: Nein. Ich würde das journalistische Vorurteil ja gerne bestätigen, aber ich habe noch nie etwas an den Redakteuren vorbeigeschmuggelt: Alles, was man von mir kennt, ist in absoluter Abstimmung mit den verantwortlichen Redakteuren gemacht worden. Bei "Hotte im Paradies" habe ich allerdings die Szene, in der Hotte (dargestellt von Miel Matičević, Red.) die ältere Frau, die er gerade beklauen wollte, zusammenschlägt, so inszeniert, wie sie auch im Buch beschrieben wurde: "Wir erkennen ihn nicht wieder." Selbst der Autor war schockiert! Er musste aber so zuschlagen, damit das Bild vom netten und irgendwie recht sonnigen Zuhälter zerbricht. Der wurde dann natürlich – zack! – auf 23 Uhr verschoben. Beim "Scharlachroten Engel" war's ähnlich. Da stand in TV Spielfilm: "von Stoiber auf 23 Uhr verbannt". Da wurden auch alle abgemahnt, und seitdem guckt der Bayerische Rundfunk sehr genau darauf, was ich so an Gewalt produziere. Da muss man bei mir aufpassen.
Worauf man bei Ihnen auch aufpassen muss, ist der Ton. Das ist heute im Fernsehen meistens eine einzige Soße. "Die Beute" von 1988 hingegen klingt vollkommen anders. Da wird über Geräusche und Musik ein unglaublicher Druck erzeugt.
Graf: Das habe ich mir von Nicolas Roeg abgeschaut, und zwar von "Bad Timing", der ja in Wien spielt. So lebendig habe ich Wien nie gesehen! Ich habe früher immer gedacht, man kann deutschen Städten auch über den Ton etwas von New York mitgeben. Inzwischen sind die meisten davon aber solche Särge, dass sich das Sounddesign gar nicht mehr lohnt.
Die Umwelt wird lauter, aber die Filme werden leiser?
Graf: Es gibt in der Tat immer Beschwerden von Zuschauern, wenn die Tonebene zu anstrengend wird, und das wird dann auch berücksichtigt. Hinzu kommt die katastrophale Digitalisierung: Musik, Außengeräusche, Dialoge. Das kommt alles schlechter durch. Und erst diese schreckliche Homekino-Entwicklung mit Dolby Surround! Ein großer, mittlerweile verstorbener Mischmeister meinte in den 1990ern einmal: Was wollen die Deutschen mit dem Zeug, die haben ja gar keine Wohnzimmer, die groß genug wären?! Inzwischen haben sie die zwar, aber während die Musik und der Dialog den Zuseher richtiggehend anspringt, wird die Atmosphäre bei der Entcodierung am Fernseher nach unten nivelliert. Da kann man sich Mühe geben, so viel man will, das wird aus technischen Gründen unglaublich leblos.
Sie sind auch ein Teamarbeiter. Wie wichtig ist Ihnen das?
Graf: Es ist wie eine Familie, die man gründet in der Branche. Es gibt auch nix Spannenderes, als mit denselben Schauspielern über längere Zeit an völlig verschiedenen Filmen und Figuren zu arbeiten. Man kennt sich und kennt sich doch nicht.
An wen denken Sie da?
Graf: Von Miel Matičević haben die Zuseher vermutlich angenommen, dass er tatsächlich ein Zuhälter vom Stuttgarter Platz ist. Zwei Filme später hat er Clemens von Brentano gespielt. Das sind wirkliche Abenteuer.
Sie haben in Filmen wie "Die Katze"
und "Die Sieger" mit Leuten wie Götz George und Heinz Hoenig gedreht, zwei der physischsten Schauspieler des deutschen Films. Das ist offenbar etwas, was Sie reizt.
Graf: Meine Generation hat halt im Fernsehen und im Kino zunächst einmal Schauspieler von großer Körperlosigkeit erlebt. Die Stars waren alle von einer seltsamen deutschen Nachkriegsschwäche gekennzeichnet – je schwächer, umso attraktiver. In den 1970ern ist einem diese Konzentration aufs gesprochene Wort aber so auf die Nerven gegangen, dass auf einmal Schauspieler wie Götz George oder Klaus Löwitsch kamen, die sich körperlich total verausgabt haben. Die standen dann Leuten wie Siegfried Lowitz gegenüber, die überhaupt nichts gemacht haben, außer zu stehen und zu sprechen. Das war auch sehr eindrucksvoll. In den 1990er-Jahren dann folgte eine Generation, die mit dem Körper viel selbstverständlicher umgeht und nicht ständig jede Tür eindrücken muss. Hoenig, der genau meine Generation ist, war schon eigen – kein körperlicher Held, sondern jemand, der seine Rundheit auch einsetzen konnte.
Ich habe ein Faible für feiste Schauspieler. Wenn ich Regisseur wäre, würde ich Charles Durning, Ned Beatty, Brian Dennehy und Tom Sizemore mal gemeinsam in einen Film packen.
Graf: Die kriegen Sie ja gar nicht nebeneinander auf die Leinwand! Aber es stimmt schon. Der Durning war manchmal so eine böse Sau! Auch Dieter Pfaff war so jemand, der aus seinem Fett was machen konnte. Man denkt immer, Dicke seien so gemütlich. Aber als Otto Schatzschneider im "Fahnder" konnte er ganz schön bösartig sein.
Auf eine ganz andere Weise ist auch Andre Braugher, der in "Homicide" den Detective Pembleton spielt, sehr körperlich. Der Schlaganfall, den er bekommt, und die Wut, die er danach auf sein Gebrechen entwickelt – das ist echt bedrohlich.
Graf: Ja, wirklich beeindruckend. Die Amis haben das aber immer schon gekonnt. In "The Great Escape" spielte mein Vater einen Wärter. Er war völlig fasziniert, weil Steve McQueen diesen großen Satz mit dem Motorrad, der ihn da ja aus dem Camp rausbringt, in der Mittagspause immer geübt hat. Die Körperlichkeit, aber auch Schlichtheit von Schauspielern wie James Garner hat ihn, der aufgrund seiner Kriegsverletzung überhaupt nichts Physisches auf die Beine stellen konnte, sehr beeindruckt.
Welche US-amerikanischen Schauspieler würden Sie denn gerne beschäftigen?
Graf: Er ist jetzt zwar schon zu alt, aber Gene Hackman war für mich schon der Größte nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war schon einer, mit dem man dann doch gerne auf ein Bier gegangen wäre.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: