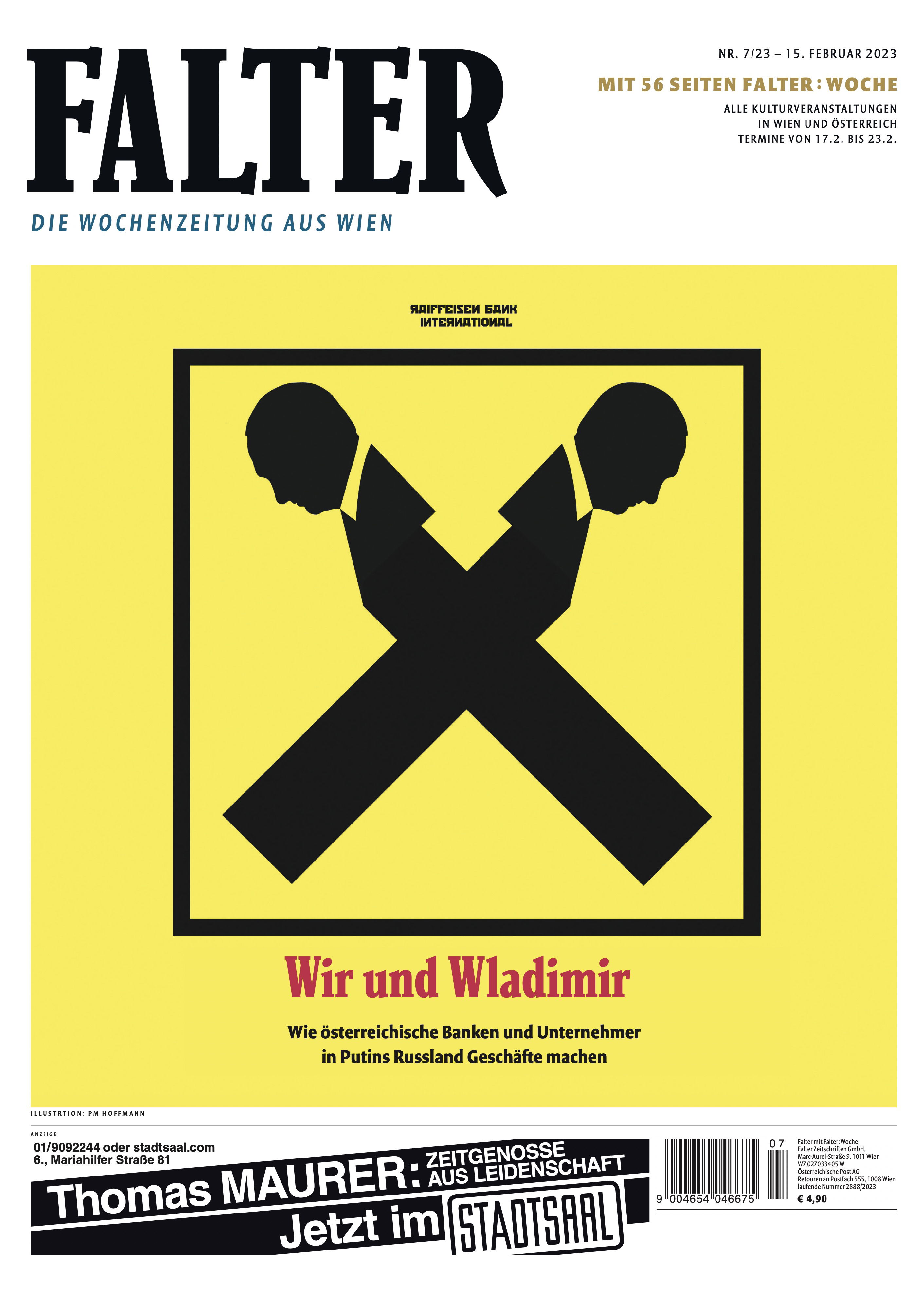
"Meine Eltern haben mich krank gemacht"
Matthias Dusini in FALTER 7/2023 vom 15.02.2023 (S. 38)
Die sozialen Medien würden einen wie Piet Meyer ein Nepo-Baby nennen. So heißen die Kinder berühmter Eltern, die durch nepotistische Privilegien bekannt werden. Meyer ist der Enkel des Malers Marc Chagall (1887-1985) und der Sohn eines in der Schweiz legendären Museumsdirektors, dem er nun das Buch "Franz Meyer, der Museumsmann" widmet. Für den heute knapp 70-Jährigen war die vornehme Herkunft mehr Fluch als Segen: "Ich wurde im Olymp geboren und landete in der Scheiße."
Meyer pendelt zwischen Zürich und Wien, wo er in der Innenstadt eine Wohnung gemietet hat. Das Wohnzimmer gleicht einem Büro, in den Regalen stapeln sich Manuskripte aus der Zeit als Verleger. Einige afrikanische Statuetten erinnern an seine Tätigkeit als Ethnologe. 2020 stellte der Piet Meyer Verlag, eine angesehene Adresse für Schriften über Kunst, seine Tätigkeit ein. Nun hat der Büchermacher selbst zur Feder gegriffen und eine Abrechnung verfasst.
"Franz Meyer, der Museumsmann" schildert Rituale elterlicher Kälte. Piet und seine beiden jüngeren Schwestern frühstückten kein einziges Mal mit dem Vater. Sie wurden niemals umarmt, geküsst oder bei ihrem Namen gerufen. Piet erlebte einen Empfang in der Basler Villa, bei dem die Mutter sagte: "Ich hasse Kinder!" Die Gäste aus Paris pflichteten ihr bei: "Oui, madame, das können wir total gut verstehen." Marc Chagall, der große Poet unter den Modernen, verweigerte die Rolle des gütigen Opas: "Er hat mir in die Augen geschaut und gesagt: Du bist ein Nichts."
Meist waren die Eltern auf Reisen. Da kümmerte sich ein Kindermädchen um den Haushalt. Tine, eine Bauerntochter aus dem Appenzell, vollendete die Hölle. Die Nanny schlug täglich zu, sehr schnell, sehr hart. Der Bub durfte weder weinen noch schreien. "Es war niemand da, der ihr Einhalt geboten hätte", erinnert sich Meyer.
In der Museumswelt ist der Vater Franz Meyer ein Mythos. Er war einer der Kuratoren, die die Galerien für die neue Kunst öffneten, organisierte etwa 1956 im Kunstmuseum Basel die erste Retrospektive des Bildhauers Alberto Giacometti. Im Jahr 1967 überzeugte er die Bürger, bei einer Volksabstimmung für den Ankauf zweier teurer Gemälde von Pablo Picasso zu stimmen. Der spanische Künstler war so angetan, dass er dem Museum mehrere Werke aus eigenem Besitz drauflegte.
Die Sammlung des Kunstmuseums Basel geht auf das 16. Jahrhundert zurück, als reformierte Bürger ihre Schätze öffentlich zeigen wollten. Die Einrichtung besitzt eine in Österreich unvorstellbar reiche Kollektion moderner und zeitgenössischer Kunst von Vincent van Gogh bis Andy Warhol, ein Bestand, der auch auf das Wirken und sogar persönliche Schenkungen des Direktors Franz Meyer zurückgeht. Freunde und Kollegen erlebten ihn als Workaholic, brillanten Netzwerker und Kunsthistoriker, der mit Joseph Beuys befreundet war.
Als Franz Meyer heiratete, stieg er in den Hochadel der Kunstwelt auf. Ida Chagall, Tochter des russisch-jüdischen Malers, überragte den Schweizer Gatten in ihrer intuitiven Intelligenz. Glanzvoll wie eine Diva, einnehmend und klug bildete sie den Mittelpunkt jeder Gesellschaft. In ihrer Pariser Villa verkehrte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Elite: Filmregisseure, Politiker, Kunsthändler, Künstler, Journalisten. Sie war mit dem Maler Henri Matisse und dem Denker Jean-Paul Sartre befreundet.
Dem Sohn bedeutet das nichts: "Die beiden haben mich krank gemacht." 40 Jahre Depressionen liegen hinter ihm. Er wollte nie heiraten und Kinder haben. Mitte 20 floh er nach Afrika, um als Ethnologe Feldforschung zu betreiben, danach kamen einige Jahre "im Wald", wie er vage sagt: "Mit mir stirbt die väterliche Linie Meyer aus." Sein Buch sieht er auch als Genugtuung gegenüber der auf ihre demokratische Tradition so stolzen Basler Bürgerschaft, die kein Verständnis hatte für einen, dem scheinbar alles in den Schoß fiel.
Meyer schrieb ohne Verbitterung. Das erleichtert die Lektüre, denn Selbstmitleid vergiftet die Empathie. Für ihn sei der Vater ein Fremder, daher sei ihm die Arbeit nicht so schwergefallen, sagt Meyer. Er näherte sich dem Thema wie ein Journalist, der erst einmal recherchiert. Denn zu den Demütigungen des Vaters gehörte das Schweigen. In Gesellschaft eloquent und charmant, erzählte er zuhause weder von seinen Begegnungen noch über seine beruflichen Abenteuer, nahm den Sohn kein einziges Mal mit ins Museum.
Die Suche nach der Vergangenheit führte Meyer nach Zürich zu einer gründerzeitlichen Villa mit riesigem Park. Hier hatte Urgroßvater Fritz Meyer (1847-1917) residiert, der den Grundstein des Familienvermögens legte. Der Vorfahr suchte sein Glück auf der indonesischen Insel Sumatra, die damals unter niederländischer Kolonialverwaltung stand. Der Selfmademan baute Tabakplantagen auf, ein im späten 19. Jahrhundert sehr einträgliches Geschäft. Piet Meyer verklärt den Ursprung des Meyer'schen Wohlstands nicht.
"Es galt, in möglichst kurzer Zeit Maximalerträge aus Ländern zu pressen, die zuvor mit Waffengewalt besetzt worden waren", schreibt er. Die Archive erzählen von Pflanzern, die die Felder mit Leichen ermordeter chinesischer Zwangsarbeiter düngten. Zurück in der Schweiz, konnte sich Fritz Meyer um 1890 seiner eigentlichen Passion widmen, der Kunst.
Im Februar 2015 titelte die New York Times: "Gauguin-Gemälde soll 300 Millionen Dollar gebracht haben." Es handelt sich um "Wann heiratest du?"(1892), ein Hauptwerk des französischen Malers Paul Gauguin von dessen erster Reise zur Südseeinsel Tahiti. Meyer kannte diese moderne Ikone von seinen Besuchen im Kunstmuseum Basel, wo das Werk hing, bevor es in den arabischen Raum vercheckt wurde. Was ihm sein Vater jedoch nicht erzählte: Fritz Meyer hatte Gauguins Meisterstück 1893 in Paris um 1500 Francs erworben und kurz vor seinem Tod 1917 weiterverkauft.
Immer wieder stößt der Nachkomme in den größten Museen der Welt auf die Provenienz Fritz Meyer. Der Plantagenbesitzer gehörte zu den ersten Sammlern überhaupt, die Bilder des in seiner Zeit wenig geschätzten Vincent van Gogh kauften. Sein Urgroßvater habe sich in der Ferne einen anderen Blick auf die Dinge angeeignet, vermutet Piet Meyer. Lange bevor Künstler wie Pablo Picasso die außereuropäische Kunst imitierten, schätzte sein Vorfahre die "primitiven" Stammeskulturen Sumatras.
Ohne Wehmut blickt der Urenkel auf den Familienschatz zurück. Spöttisch berichtet er von einem Hauptwerk des naiven Malers Henri Rousseau, das der Kunsthändler Ernst Beyeler 1985 den Erben um einen Pappenstiel abluchste. "Der hungrige Löwe wirft sich auf die Antilope" (1898/1905) hing einst in einer Meyer-Villa in Zürich und ist heute die Attraktion des Basler Museums Fondation Beyeler. "Als Kind mochte ich das Bild nicht sehr", erinnert sich Meyer. "Weshalb sollten wir dieses brutale Fressmahl sehen, während wir unsere Suppe löffelten?"
Als Meyer 2007 in Bern einen Kleinverlag gründete, tauchte er in die Welt der Eltern ein. Über die Bücher kam der Autor wieder mit den Namen in Berührung, die ihm aus den familiären Unterhaltungen vertraut waren. Der Piet Meyer Verlag publizierte etwa Erinnerungen des deutschen Philosophen Georg Simmel an einen Besuch bei dem Bildhauer Auguste Rodin 1905. Nun bekam Meyer jene Anerkennung, die ihm der Vater verweigerte. 2011 erschien in Großbritannien die große Biografie des Pop-Malers David Hockney; da erhielt der Einmannbetrieb den Zuschlag für die deutsche Übersetzung.
Vor 20 Jahren verliebte sich Meyer in eine Wienerin. So kam es, dass der Kunstfreund immer öfter in die Donaumetropole reiste und eine Verlagsniederlassung eröffnete. Die Anonymität sei ihm wichtig gewesen, er wollte den Leuten nicht als "Enkel von" vorgestellt werden. Freundschaften zerbrachen daran, dass jemand Meyers Herkunft verriet.
Vor zwei Jahren gab Meyer seinen Verlag auf. Die Auseinandersetzungen mit den Nachlassverwaltern von Künstlern wurden immer mühsamer. Trusts und Estates bestimmen über das Erbe der um viele Millionen gehandelten Klassiker. Mehrmals passierte es dem Verleger, dass am Ende einer mehrjährigen Produktion ein kommentarloses Nein kam: "Ich habe hier acht Bücher liegen, die nie erschienen sind."
Im Sommer feiert Meyer seinen 70. Geburtstag. Das Vaterbuch sei auch eine Reaktion "auf das kürzer werdende Leben" gewesen, sagt der zum Autor mutierte Verleger, eine Art Bilanzziehen oder Friedenfinden. "Ich habe meinen Vater unfassbar gehasst, aber dieser Hass ist inzwischen weg." An einem Text über seine Mutter habe er zu schreiben begonnen, das Vorhaben aber rasch wieder aufgegeben. "Sie stand mir viel näher als er. Daher wäre die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit noch schmerzvoller."
Die Geschichte hat kein Happy End. Kurz vor Franz Meyers Tod 2007 bekam Piet Meyer eine Postkarte, auf der ein einziger Satz zu lesen war: "Ich wäre jetzt bereit, dich zu sehen." Für den Adressaten hatte das Schreiben etwas Groteskes. 54 Jahre nach dessen Geburt erklärt ein Vater seinem Sohn, dass er nun endlich bereit sei, ihn zu treffen. Spontan schickte Piet Meyer eine Postkarte zurück mit einem ebenfalls lapidaren Satz: "Es ist zu spät."



