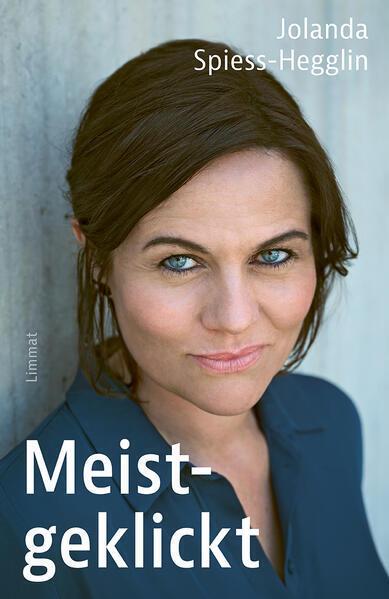"Heute hat die Scham die Seite gewechselt"
Tessa Szyszkowitz in FALTER 7/2025 vom 12.02.2025 (S. 20)
So richtig fassen kann sie es noch nicht, aber das kann ja noch werden. "Ich habe permanent das Gefühl, dass ich kontrolliert bleiben muss", sagt Jolanda Spiess-Hegglin, "aber ich bin sehr erleichtert." Die 44-jährige Aktivistin und Autorin sitzt vor dem Bildschirm im ausgebauten Dachboden einer Scheune im Kanton Zug. Im Hintergrund steht der Kontrabass ihres Mannes. Während des Interviews mit dem Falter versinkt das Zimmer hinter ihr langsam im abendlichen Dunkel.
Jolanda Spiess-Hegglin aber strahlt. Sie hat guten Grund. Nach einem zehnjährigen Kampf gegen das Schweizer Boulevardblatt Blick und den Konzern Ringier AG hat sie gewonnen.
In 150 Artikeln hatte die Zeitung 2014 persönlichkeitsverletzend über Jolanda Spiess-Hegglin geschrieben. Die ehemalige grüne Politikerin hat Ringier auf Gewinnherausgabe von vier dieser Artikel geklagt. Am 22. Jänner legte das Zuger Kantonsgericht die Höhe des Gewinns und damit der Rückerstattung fest: Der Verlag muss ihr 309.531 Franken erstatten - das ist der Profit aus den vier Artikeln, die unterschiedlich gewichtet, weil unterschiedlich oft angeklickt wurden: 112.791 Franken etwa für "Sex-Skandal in Zug" vom 27. Dezember 2014, dagegen nur 25.238 für "Jolanda Heggli zeigt ihr Weggli" vom 4. Februar 2015. Dazu kommt noch eine Entschädigung von 112.495 Schweizer Franken. In Euro: 447.915. Da sind die ebenfalls vom Gericht verhängten fünf Prozent Zinsen seit Gewinnerzielung noch nicht mitgerechnet.
Ein Sieg, der richtungsweisend sein könnte. Ein Signal an alle Boulevardblätter. Ab jetzt heißt es: Klicks um jeden Preis können Zeitungsverlage teuer zu stehen kommen. Medien-Anwältin Rena Zulauf, die Jolanda Spiess-Hegglin vertritt: "Unrecht darf sich nicht lohnen."
Blick zurück mit Blick: "Hat er sie geschändet?", stand am 24. Dezember 2014 auf der Titelseite. Daneben ihr unverpixeltes Foto und das eines Lokalpolitikers der konservativen SVP. Beide mit vollem Namen genannt. Jolanda Spiess-Hegglin stand in ihrer Küche und starrte auf die Titelseite, die ihr von Freunden auf ihr iPad geschickt worden war. Darunter stauten sich schon die Kommentare. Mit Entsetzen stellte sie fest: Die allermeisten beschimpften nicht den -mutmaßlichen - Täter. Sondern sie, das - ebenfalls mutmaßliche -Opfer.
Ihre drei Kinder waren damals noch klein. Ihr Mann und sie blieben bei dem Plan, zu Hause Weihnachten zu feiern. Vor dem Haus standen Reporter, auf ihrem Telefon rief ein Blick-Reporter nach dem anderen an. Sie drückte alle Anrufe weg. Das Ehepaar zog sich am Weihnachtstag die Decke über den Kopf, während die Kinder im Wohnzimmer mit den Geschenken spielten. Jolanda Spiess-Hegglin war im Schock.
Der Weihnachtstag 2014 war der Beginn einer jahrelangen Tortur. Die hetzerische Boulevardpresse biss sich an ihr fest. Dabei war sie die geschädigte Partei. Die grüne Politikerin, ein aufstrebendes Talent im Kanton Zug, war vier Tage vorher mit einem "Filmriss", wie sie sagt, aufgewacht. Und Schmerzen im Unterleib. Was genau am Abend davor geschehen ist, wusste sie nicht mehr.
Heute denkt man bei "Filmriss" sofort an K.o.-Tropfen. An Date Rape. An sexuellen Missbrauch. Damals, im Schweizer Kanton Zug, brauchte das Krankenhaus, in das Spiess-Hegglin ging, zehn Stunden, bis ihr Blut abgenommen wurde. Die meisten Drogen kann man dann nicht mehr nachweisen. Was aber schon gefunden wurde, und zwar in ihrem Intimbereich: die DNA-Spuren von zwei Männern.
Die Landammann-Feier am 20. Dezember 2014. Landammann, so heißt das Regierungsoberhaupt des Kantons. Die gesamte Zuger Polit-Elite war da, auch die neugewählte grüne Kantonsrätin Jolanda Spiess-Hegglin. Sie wurde im Gespräch mit dem konservativen SVP-Politiker Markus Hürlimann gesehen. Wie seine DNA-Spuren bei Frau Spiess-Hegglin landeten, wurde nie geklärt. Die Verfahren gegen ihn und einen zweiten SVP-Politiker hatte man schnell eröffnet und 2015 schnell wieder eingestellt. Spiess-Hegglin wiederum wurde von Hürlimann 2015 wegen falscher Anschuldigungen angezeigt. Das wurde von den Schweizer Medien bis in jedes Detail und mit vielen Unterstellungen breit berichtet.
Nicht oder kaum berichtet wurde, dass auch dieses Verfahren 2018 eingestellt wurde. "Es wurde behördlich festgehalten, dass ich davon ausgehen durfte, dass ich Opfer einer Sexualstraftat geworden war", sagt Spiess-Hegglin heute. Und: "Ich kann mich nicht erinnern. Ich möchte deshalb auch niemanden beschuldigen."
Aber Spiess-Hegglin wollte auch nicht auf sich sitzen lassen, dass sie als Täterin in der Landammann-Affäre dargestellt wurde. "Die ganzen Schuldzuweisungen, die nachher kamen von den Medien, das war das Schlimme", erzählt sie. "Ich war zuerst ein bemitleidenswertes Opfer, danach eine blutrünstige Täterin, eine Ehebrecherin sowieso." Ihre Kollegen in der grünen Partei standen nicht zu ihr. "Sie haben gesagt, entweder bist du jetzt ruhig oder du gehst." Das kam für sie aber nicht in Frage: "Ich wollte einfach alles richtiggestellt haben, was da an Mist erzählt wurde."
2016 verließ sie die Politik. Sie gründete den Verein Netzcourage, der Betroffenen von digitaler Gewalt hilft. Heute mangels Finanzierung nur in Notfällen. Auch international hat sie sich mit Frauen vernetzt, die gemeinsam gegen Diffamierung von Frauen kämpfen.
Vor allem aber verschrieb sie sich dem Kampf gegen die Schmutzkübelkampagne gegen ihre Person. "Warten, bis Gras über die Sache wächst. Das haben mir alle geraten", steht auf dem Buchrücken von "Meistgeklickt". Ihr Buch ist die Chronologie ihrer Geschichte. Und ihres Kampfes: "Ich hatte nicht das geringste Interesse daran, dass über diese Ungerechtigkeit auch noch Gras wächst."
Die Opfer-Täter-Umkehr akzeptierte sie nicht. Das machte sie zu einer unbequemen Frau. Dass sie um sich schlug, immer weitere Details aus einer Nacht, an die sie sich nicht erinnern konnte, publizierte, machte sie angreifbar. Eine schwierige Zeit für die ganze Familie, auch für ihren Mann Reto Spiess. 2017 gab er sein erstes und bisher einziges Interview. Und zwar Hansi Voigt, dem ehemaligen Chefredaktor - so heißt das in der Schweiz -der Online-Redaktion von 20 Minuten, der später das Online-Portal "Watson" mitgründete.
Als Online-Kenner wusste er, wie die Klick-Wirtschaft im Journalismus funktioniert. Jolanda Spiess-Hegglin selbst hatte sich schon in unzähligen Fällen von Online-Beschimpfungen mit Strafanzeigen gewehrt. Erfolgreich. 2020 dann hatte sie die Ringier AG in einem Stufenverfahren geklagt. Ein Verfahren in zwei Etappen. Der Ringier-Verlag zahlte am Ende 10.000 Franken zur Genugtuung und entschuldigte sich bei Spiess-Hegglin.
Hansi Voigt brachte eine neue Idee ein: Er half ihr, sich gegen die persönlichkeitsverletzenden Artikel in der Zeitung Blick zu wehren, indem sie den Ringier-Verlag auf Gewinnherausgabe klagte.
Gewinnherausgabe? Hinter dem sperrigen Wort verbirgt sich viel Geld. "Ein sehr effizientes Werkzeug" sei das, sagt Voigt, "gerade gegen illegalen Sensationsjournalismus". Das Gesetzbuch sieht zwar seit Jahrzehnten vor, dass Opfer auf Gewinnherausgabe klagen können. Aber in der Realität war es schwierig, den Gewinn zu beziffern.
Als Online-Journalist hatte Voigt aber Erfahrung, wie das Klick-Modell funktioniert, während es früher bei einem Printprodukt fast unmöglich war, festzustellen, welcher Artikel wie oft angesehen wurde - "im gedruckten Produkt hat man ja die ganze Zeitung gekauft und durchgeblättert", sagt Voigt. Heute kann ein Verlag genau messen, wie viele Klicks ein einziger Artikel bekommt. Dazu kann ausgerechnet werden, was ein Verlag an der dazu geschalteten Werbung verdient.
Voigt hat aus all diesen Informationen ein Modell entwickelt, das speziell auf Boulevardmedien anzuwenden ist, die mit reißerischen Schlagzeilen werben und mit einem einzigen Artikel viele Leserinnen und Leser auf ihre Webseite bringen. "150 Artikel wurden über Jolanda im Blick geschrieben", sagt Voigt. "Über eine unbekannte grüne Kantonspolitikerin." Das war nicht mit journalistischer Informationspflicht zu erklären. Blick habe, schreibt die Weltwoche, "außer Rand und Band über das Geschehen berichtet, das doch eher von begrenztem öffentlichen Interesse war".
Der Knackpunkt dabei: "Es braucht ein Delikt", sagt Voigt. "Aber wenn ein Artikel persönlichkeitsverletzenden Inhaltes ist, dann kann der Profit aus diesem Artikel eingeklagt werden und muss wie im Falle von Jolanda Spiess-Hegglin der geschädigten Person übergeben werden."
Spiess-Hegglin klagte Ringier auf Gewinnherausgabe im Falle von vier Artikeln, die in den Jahren 2014 und 2015 über sie geschrieben wurden. "Den Gewinn aus diesen Artikeln hat der Verlag unrechtmäßig eingesteckt. Wenn ein Dieb im Supermarkt erwischt wird, darf er die geklaute Ware auch nicht behalten."
Im Oktober 2024 verhandelte das Gericht, am 27. Jänner verkündete es Urteil und Höhe der Zahlungen: im Durchschnitt 100.000 Franken pro Artikel. So viel hat der Ringier-Verlag 2014 und 2015 verdient, als im Blick, der größten Boulevardzeitung der Schweiz, reißerisch über Jolanda Spiess-Hegglin berichtet wurde.
Der Ringier-Verlag wehrt sich gegen das Urteil. Vor allem gegen die Höhe der Gewinne, die er zurückerstatten muss. "Der zugesprochene Betrag entbehrt jeder faktischen Grundlage", steht auf der Webpage von Blick. "Das Urteil gefährdet Medienfreiheit und journalistische Überwachung der Mächtigen." Deshalb wird "Ringier das Urteil des Zuger Kantonsgerichts anfechten".
Dabei hat sich der Verlag schon entschuldigt. "Das war keine publizistische Sternstunde", schreibt die Geschäftsführerin von Blick, Ladina Heimgartner, in einem Kommentar nach dem Urteil. "Die Art und Weise, wie vor 10 Jahren über die Ereignisse berichtet wurde, ist Ausdruck eines harten Boulevardstils, den Blick längst nicht mehr praktiziert, und das ist gut so." Spiess-Hegglin stimmt dem zu: "Heute, nach #MeToo, hat die Scham die Seite gewechselt."
In der Schweizer Presse ist das Urteil umstritten. "Wenn das Schule macht, dann wird Investigativjournalismus schwieriger werden", sagt Michèle Binswanger, Journalistin beim Schweizer Tagesanzeiger, die selbst ein Buch über die Landammann-Affäre geschrieben hat. Im Eigenverlag. "Besonders für kleine Verlage, die sich dann überlegen müssen, ob sie ein Risiko einer solchen Klage eingehen." Ursula Klein dagegen, die einen täglichen Mediendienst der Schweizer Kommunikationsbranche betreut, schreibt: "Der in großen Teilen misogyne Fall Spiess-Hegglin ist ein Fall Ringier."
Die Ringier AG hat jetzt noch bis Ende Februar Zeit, in Berufung zu gehen. Vielleicht wird auch erst in der übernächsten Instanz, dem Bundesgericht, endgültig über die Sache entschieden. Jolanda Spiess-Hegglin ist jedenfalls auf weitere mediale Kampfhandlungen vorbereitet: "Egal, ob sie berufen oder nicht: Die restlichen 146 Artikel auch noch auf Gewinnherausgabe zu klagen, wäre unser nächster logischer Schritt."