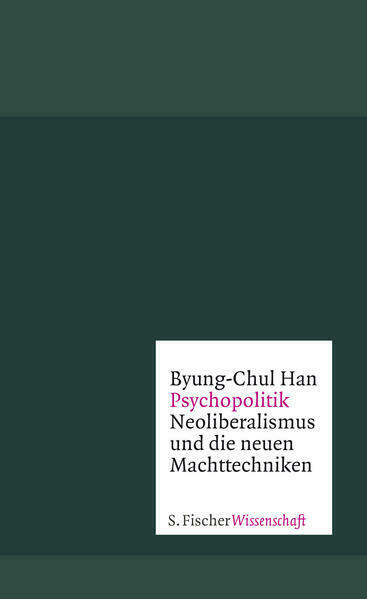Der Terror des digitalen Rosenkranzes
Matthias Dusini in FALTER 34/2014 vom 20.08.2014 (S. 18)
Der Philosoph Byung-Chul Han bedient mit seiner Kritik am Neoliberalismus konservative Ressentiments gegen die Gegenwart
Das Leistungssubjekt, das sich frei wähne, sei in Wirklichkeit ein Knecht. Das ist eine der vielen schlechten Botschaften, die der deutsche Philosoph Byung-Chul Han in seinem neuen Essay "Psychopolitik – Neoliberalismus und die neuen Machttechniken" verkündet. Er sieht im Neoliberalismus ein System, das die Freiheit ausbeutet. Die neoliberale Herrschaft preise die Autonomie des unternehmerischen Selbst, ohne deren Risiken und Nebenwirkungen zu erwähnen. "Die psychischen Erkrankungen wie Depression und Burnout sind der Ausdruck einer tiefen Krise der Freiheit", schreibt der an der Universität der bildende Künste Berlin lehrende Denker.
Die Klage über das Leiden der zur Souveränität Verdammten ist nicht neu. Der französische Soziologe Alain Ehrenberg etwa beschrieb das "erschöpfte Selbst" als Folge gesteigerter Erwartungen an die eigenen Leistungen. Auch die kanadische Publizistin Naomi Klein untersuchte eine neue Form des Kapitalismus, der die Seelen der Konsumenten kolonisiert. Ehrenberg kam durch das Studium wissenschaftlicher Literatur zu seinem Befund, Klein stützte ihre Thesen auf die Auswertung von Medienberichten. Byung-Chul Han hingegen hält sich mit empirischen Details nicht weiter auf.
Ohne sich um argumentative Schärfe zu bemühen, stellt er eine flotte These nach der nächsten in den Raum. Das klingt manchmal unfreiwillig komisch, etwa wenn er schreibt: "Das Gefühl ist nicht identisch mit der Emotion." Manchmal klingt es auch nur überheblich, wenn der Autor sich die Schriften von Kolleginnen zur Brust nimmt, ohne auf deren Analysen näher einzugehen: "Die Machttechnik des neoliberalen Regimes bildet den blinden Fleck der Foucaultschen Analytik der Macht." Na dann!
Naomi Klein sei "blind für die neoliberale Psychopolitik", denn sie habe deren verführerische Wirkung nicht erkannt. Dabei war die Faszination etwa von Markenprodukten, hinter denen sich die Ausbeutung von Arbeitern und Arbeiterinnen in armen Weltgegenden verbirgt, eines von Kleins zentralen Argumenten bei der Beschreibung der neoliberalen Arbeitswelt.
Jäger und Gammler
Byung-Chul Han hat in seinen Büchern "Müdigkeitsgesellschaft" und "Transparenzgesellschaft" Schlagwörter für eine diffus pessimistische Gegenwartsdiagnostik geliefert. Dass der kreative Imperativ in prekarisierten Arbeitsmilieus zu Ermüdungserscheinungen führt, ist eine ebenso treffende Beobachtung wie jene einer von Geheimdiensten und Internetkonzernen durchleuchteten Überwachungsgesellschaft. Bei der Lektüre von "Psychopolitik" drängt sich indes der Verdacht auf, dass es dem Autor nicht um die Auseinandersetzung mit politischen Verhältnissen geht, sondern um die Artikulation eines Ressentiments. Das Smartphone erinnert ihn an einen Rosenkranz, denn beide dienten zur Selbstprüfung und Selbstkontrolle. Dass man mit dem Gerät auch Revolten organisieren kann, auch schon wurscht.
Natürlich ist auch das Spielen am Computer ein weiterer Schritt zur kollektiven Verblödung: "Das Jagen entspricht dem Gamemodus, während Tätigkeiten eines Bauern, die auf das langsame Reifen, auf das stille Wachstum angewiesen sind, sich jeder Gamifizierung entziehen." Ein Besuch auf dem virtuellen Bauernhof des Browser-Games "Farmville" würde den Autor eines Besseren belehren. Hier könnte er digital Tiere füttern und Felder bestellen.
Rechtes Neolib-Bashing
Gewiss, die linke Neoliberalismuskritik hat einen jammerigen Unterton. Jedes Fitnessstudio steht unter Selbstoptimierungsverdacht, jedes Praktikum gilt als Selbstausbeutung. Lässt sich der Sklaventreiber nicht benennen, dann ist das der Beweis dafür, dass die Gewalt des Regimes im System selbst angelegt ist. So wurde der österreichische Wohlfahrtsstaat oft schon mit einem Übungsgelände der neoliberalen Chicagoer Schule verwechselt.
Wen diese Art der Überzeichnung stört, der wird auch mit rechtem Neolib-Bashing à la Byung-Chul Han keine Freude haben. Das tiefe Gefühl verflacht bei ihm unter dem Druck der Verhältnisse zur oberflächlichen "Emotion". Das "Glück des Ausschweifenden", ein Opfer der "konsumistischen Praxis". Die bekannte Polemik des Schriftstellers Botho Strauss gegen die seichte Mediengesellschaft, 1993 im Spiegel unter dem Titel "Anschwellender Bocksgesang" erschienen, findet hier ihre durch Big-Data-Ekel ergänzte Fortsetzung.
In Byung-Chul Hans Neoliberalismuskritik klingt jener Kult der Kultiviertheit an, mit dem sich die konservative Kulturkritik schon immer von der technisch beschleunigten Gegenwart abgrenzte. Der distinguierte Bildungsbürger sondert sich ab von der "Gleichschaltung der heutigen Transparenz- und Informationsgesellschaft". In einer Welt des durch Data-Mining forcierten Zählens gehe die identitätsstiftende Erzählung verloren. "Totale Beschleunigung findet in einer Welt statt, in der alles additiv geworden und jede narrative Spannung, jede Vertikalspannung verloren gegangen ist", so Byung-Chul Han.
Unter dem Titel "The End of Theory" kündigte Wired-Herausgeber Chris Anderson 2008 das Ende der Notwendigkeit theoretischer Konzept an. Die Auswertung der durch die digitale Vernetzung erhobenen Datenmengen, das sogenannte Data-Mining, würde die traditionelle wissenschaftliche Methodik auf den Kopf stellen.
Beim Lesen von "Psychopolitik" bekommt man den Eindruck, als habe das "Ende der Theorie" die Theorie nun selbst erfasst. Byung-Chul Han liefert intellektuelles Fastfood für ein zivilisationsmüdes Publikum, für dessen Konsum ein Smartphone-Display locker ausreicht. Der Neolib hatte schon fittere Gegner.