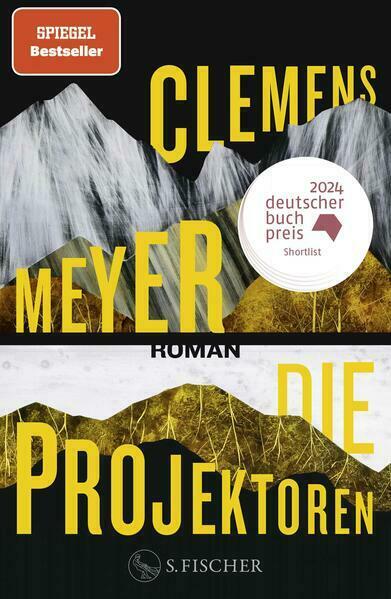Die Silberplatte im Kopf von Old Shatterhand
Marianna Lieder in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 17)
Noch halbwegs am Anfang des 1041 Seiten hohen Textgebirges, das Clemens Meyer in „Die Projektoren“ aufschichtet, heißt es: „Der Roman, wie ihn die Moderne versteht, ist ein Monolith, ein Chaos aus Stimmen.“ Das kann man durchaus so sagen. Dennoch stimmt der Satz, mit dem sich Meyers Roman so salopp wie offensichtlich selbst meint, zunächst ein wenig misstrauisch.
So wartet „Die Projektoren“ mit einer erschlagenden Fülle von Handlungssträngen, Orten, Protagonisten, Zeitebenen und Erzählstilen auf. Es geht um Titos Partisanen, um Nazis und Neonazis. Es geht um Faschismus, Sozialismus, Kapitalismus, um die Jugoslawienkriege der 1990er, um einen China-Imbiss in Sachsen, um ein Massaker an den amerikanischen Ureinwohnern, um den wilden Westen und den wilden Osten. Der Titel lässt erahnen, dass auch das Kino eine wichtige Rolle spielt. Vor allem geht es um Karl May und um seine Helden, die auf der Leinwand von Lex Barker und Pierre Brice verkörpert wurden.
Vom serbischen Novi Sad geht es nach Belgrad, dann in die USA und schließlich ins heutige Syrien. Von Leipzig geht es nach Dortmund und wieder zurück nach Leipzig, wo in einer Nervenheilanstalt ein Mann behandelt wird, der die Wände seiner Zelle beharrlich mit unverständlichem Zeug vollkritzelt und sich daher den Namen „der Fragmentarist“ eingehandelt hat.
Vor allem diese Figur wirft anfangs die Frage auf, ob der Autor es sich nicht doch ein wenig zu einfach macht, indem er sich unter dem Deckmantel des „Romans, wie ihn die Moderne versteht“, umstandslos die Lizenz zum planlosen, grafomanisch-größenwahnsinnigen Draufloslabern erteilt. Denn zur Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts lässt sich ja so einiges herbeiassoziieren. Schließlich hängt ja alles mit allem zusammen – irgendwie.
Doch Meyer weiß sehr genau, was er tut, sein Wahnsinn hat Methode. Er legt es bewusst darauf an, seinen Lesern auf die Nerven zu gehen, durch unbeirrbar vor sich hinmäandernde Figurenprosa, in der das Geschehen lange keine rechte Kontur annehmen will. Das gilt passagenweise sogar für den Bewusstseinsstrom des „Cowboys“, eine der Hauptfiguren des Romans, ein Gestaltwandler, Schlachtenbummler und Zeitreisender, der gegen die Nazis kämpfte, in Titos Jugoslawien in Ungnade fiel, sich als Film-Double von Lex Barker und als Groschenromanschriftsteller versuchte. Bisweilen schwer zu ertragen sind auch die beiden „Dottores“, die unbeirrbar kalauernd den Fragmentaristen in der Leipziger Klinik überwachen.
Doch genau in jenen Momenten, in denen man das Buch am liebsten in die tiefste Schlucht des kroatischen Velebitgebirges schleudern will, lenkt der Autor plötzlich ein. Er ändert Stil und Erzähltempo und verwebt all die lose heraushängenden Fäden zu einer formbewussten, stimmigen, unwiderstehlich soghaften Erzählung.
Zu regelrecht sensationeller Form läuft Meyer auf jenen knapp 30 Seiten auf, die gebündelt unter der Kapitelüberschrift „Wunder über Wunder“ selbst zu einem der Wunder der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gehören. Als Protagonistin taucht hier die historisch verbürgte „chronofotografische Flinte“ auf, die um 1900 erfunden wurde, um bewegte Objekte abzulichten. Bei Meyer materialisiert sich dieser eigentümliche Fotoapparat, der tatsächlich aussah wie eine Art Gewehr, auf mirakulöse Weise in den Schützengräben des letzten Jahrhunderts. Die Folgen sind fatal. „Bilder waren mit einem Mal gefährlicher als Waffen“, heißt es, „zumindest genauso gefährlich.“
Zu den prägnantesten Nebenfiguren gehört ein junger Neonazi namens Franko, der vor der Wende vaterlos in Westdeutschland aufwuchs. In der Wohnung seiner Hippie-Mutter findet er eines Tages ein altes schwarzes Messbuch im Taschenformat, den sogenannten Schott, den vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil jeder fromme Katholik besaß (dass Karl Mays Roman „Der Schut“ unmittelbar vor dem „Schott“ Erwähnung findet, gehört zu Meyers komplexem etymologischem Humorprogramm).
Als aus den vergilbten heiligen Seiten dann auch noch ein Ustascha-Ausweis herauspurzelt, ist die selbstermächtigende Herkunftsgeschichte schnell fabriziert. Der Vater, so denkt sich Franko, muss in seiner Jugend ein kroatischer erzkatholischer Faschist gewesen sein. Diesem Vorbild gilt es nachzueifern. Franko macht sich auf, um im blutig zerfallenden Jugoslawien mit ein paar Gleichgesinnten auf der Seite der Kroaten zu kämpfen.
Meyer stößt hier in das Herz rechtsidentitärer Vergangenheitsprojektionen vor. An anderer Stelle geht es um die brennenden Flüchtlingsheime im frisch wiedervereinigten Deutschland. Irgendwo findet sich eine unmissverständliche Anspielung auf Putins Überfall auf die Ukraine. Überhaupt gibt es hier unendlich viele Versehrte, Tote und Menschheitsverbrechen. Der so gerne als naiv verschrieene Humanismus Karl Mays, der sich immer wieder zwischen das blutige Geschehen drängt, müsste eigentlich obszön wirken.
Doch genau das ist hier nicht der Fall. Das liegt daran, dass Meyer trotz der offenkundig politischen Schwerpunktsetzung keine Sonntagspredigt zur Weltverbesserung und Demokratieverteidigung hält, sondern konsequent die Eigengesetzlichkeit der Literatur zelebriert. Dazwischen darf dann doch noch deutlich genug und maximal unpathetisch die frohe Botschaft der May’schen „Edelmenschen“ durchschimmern. Die Silberplatte, die man Lex Barker nach einer Kriegsverletzung in den Schädel operiert hat, muss bisweilen ganz ähnlich durch sein blondes Haar gefunkelt haben. Wer dieses Buch liest, findet den Schatz im Silbersee.