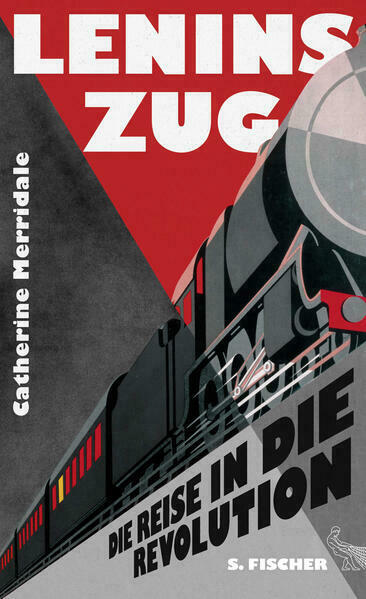Sind Revolutionen schrecklich oder schön?
Erich Klein in FALTER 11/2017 vom 15.03.2017 (S. 40)
Geschichte: Zwei Bücher analysieren die Revolution in Russland vor 100 Jahren und die Revolution an sich
Als Nikolaus II. nach 300-jähriger Herrschaft der Romanows am 15. März 1917 abdankte und mit der sogenannten Februarrevolution eine neue Ära Russlands anbrach, befand sich Lenin noch im Exil in Zürich. Dass er im November desselben Jahres die Ideen von Karl Marx in eine Regierungsideologie umformen sollte, war nicht abzusehen. Allerdings gab es in der deutschen Heeresleitung den Plan, die Entente durch Schüren revolutionärer Unruhen in Russland zu schwächen und den kräfteraubenden Zweifrontenkrieg zu beenden. Sir Winston Churchill schrieb dazu später: „Die Deutschen richteten die grausigste Waffe auf das Land. Sie beförderten Lenin wie einen Pestbazillus in einem plombierten Waggon aus der Schweiz nach Russland.“
Unterwegs zur Weltrevolution
Die britische Historikerin Catherine Merridale hat mit „Lenins Zug. Die Reise in die Revolution“ ihre imposanteste Arbeit zur Sowjetgeschichte vorgelegt. Minutiös wird die am 9. April 1917 beginnende Fahrt von 30 Revolutionären über Deutschland, Schweden und Finnland rekonstruiert. Im Hintergrund werden das Kriegsgeschehen, diplomatische Verwicklungen und Intrigen beschrieben, die Diskussionen der Bolschewiki untereinander und die Kollisionen der russischen Innenpolitik.
Windige Gestalten wie Parvus, der Organisator der Geheimaktion, sind da ebenso zu finden wie der spätere Schriftsteller W. Somerset Maugham als britischer Spion. Häufig zu Wort kommt der Altbolschewik Nikolaj Suchanow, dessen Tagebuch eine der besten Quellen zur Oktoberrevolution darstellt. Innerhalb von acht Tagen kommt Lenin nach 20-jähriger Abwesenheit in der Hauptstadt Petrograd an und ruft vor einer begeisterten Menge die Weltrevolution aus. Dazu sollte es nicht kommen, und auch die Machtergreifung der Bolschewiki erfolgt erst ein halbes Jahr später.
Merridale analysiert die Gründe für den Erfolg von Lenins Versprechen eines sofortigen Friedens bei der russischen Bevölkerung, während mächtige bürgerliche Gegenspieler wie der Minister für Auswärtige Angelegenheiten Pawel Miljukow vorerst noch spotteten: „Kein Bürger Russlands erachtet es für möglich, seine Friedensliebe kundzutun, indem er einem Feind, der sein Land verwüstet, Dienste leistet.“ Am Ende stehen die Vertreibung der provisorischen Regierung und die erfolgreiche Revolution, heute meist als Putsch tituliert. Tatsächlich handelt es sich um das folgenreichste politische Ereignis des 20. Jahrhunderts.
Ein Gutteil der Mitreisenden in die Revolution fiel später Stalins Terror zum Opfer. Den seit 1924 als Gegenstand eines bizarren Politkultes ausgestellten Leichnam Lenins nimmt Merridale zum Anlass für eine Diagnose des heutigen Russlands, das auch nach 100 Jahren nicht so recht weiß, wie es mit der Oktoberrevolution umgehen soll: „Lenin mag tot sein, aber er stellt eine persönliche Präsenz in Wladimir Putins Russland dar, das seinerseits ein Artefakt ist, unter dessen öliger Haut sich unergründliche Fäulnis verbirgt.“
Linke Melancholiker
Der 68er Gero von Randow (Jahrgang 1953) spielt noch einmal Revolution. Schließlich „hat vor 100 Jahren, im Jahr 1917, die russische Oktoberrevolution gesiegt“. Sieht man vom Anlass des runden Datums und der zweifelhaften Selbststilisierung der Sowjetkommunisten als Befreiern der Menschheit ab, wozu der renommierte Zeit-Journalist eher wenig zu sagen hat, dann handelt es sich bei seinem Buch „Wenn das Volk sich erhebt“ um ein brauchbares Taschenbrevier zu den Begriffen Revolution und Revolutionär, biografische Einlassungen inklusive.
Es beginnt mit einem Potpourri erhabener Definitionen und Stimmungslagen. Georg Friedrich Wilhelm Hegel notierte über die Wirkungen der Französischen Revolution von 1789: „Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht, ein Enthusiasmus des Geistes hat die Welt durchschauert, als sei es zur wirklichen Versöhnung des Göttlichen mit der Welt nun erst gekommen.“ Nicht weniger pathetisch klangen die Kampfrufe 180 Jahre später, als Pariser Studenten im Mai 1968 den Versuch unternahmen, die Verhältnisse radikal zu verändern: Sätze wie „Strukturen gehen nicht auf die Straße“ oder „Revolutionen sind Feste oder sie sind es nicht“ stellen bis heute Seelenbalsam für linke Melancholiker dar. Wie die Revolution damals endete, ist bekannt – als Erinnerung.
Spotlightartig beschreibt von Randow die englische, amerikanische, französische und russische Revolution, die halbanarchistischen Räterepubliken nach dem Ersten Weltkrieg, Konterrevolutionen und diverse Aufstände bis zur maoistischen Kulturrevolution und zum deutschen „Sonderfall“ des Jahres 1989 und zum Arabischen Frühling der 2010er-Jahre.
Engagement und Ironie
Der interessanteste Teil des Buches, der rote Faden, der sich durch 300 Seiten zieht, ist das persönliche „Engagement“ des Autors, um diesen heute altertümlich anmutenden Ausdruck zu verwenden. „Wenn sich die Völker vom Joche selber befreien, kann keine Wohlfahrt gedeihen“, hieß es bei Friedrich Schiller, als er reaktionär wurde. Gero von Randow ist genau in diesen Momenten voller Interesse und gehobener Neugier. Die Ermordung des demonstrierenden Studenten Benno Ohnesorg im Juli 1967 ist der Auslöser seines bundesrepublikanischen Revolutionseifers.
„Ich war 14 Jahre alt und schockiert. Nur drei Jahre später sollte ich mich bereits als Kommunist verstehen.“ Es folgen linkes Sektierertum in den Reihen der DKP, Ernüchterung über Kadergenossen aus der DDR und den „real existierenden“ Sozialismus, verschwörerische Umtriebigkeiten mit dem ANC (dem marxistischen Afrikanischen Nationalkongress) und immer wiederkehrende Enttäuschungen: über die Revolution in Algerien, jene in Nicaragua, schließlich jene in Polen. Als der Generalsekretär der KPdSU Juri Andropow den rhetorischen Weltfrieden über das Ziel der Weltrevolution stellt, hat sich Randow längst abgewandt. Revolution, das bedeutet nur noch Brecht und Zitate von Bob Dylan.
Das höchst lebendige und stellenweise ironisch-selbstkritische Porträt der westdeutschen Linken wird ergänzt durch ein „Pantheon der Revolutionäre“, gleichsam die historischen Vor- und Spiegelbilder des „Engagements“ – von Georges Danton, Victor Serge, Erich Mühsam und Frantz Fanon bis zu persönlichen Bekanntschaften.
Kitsch oder Frivolität?
Im Fall der Demontage der Immer-noch-Popikone Che Guevara wird Gero von Randow nachgerade altersmilde: „Der Revolutionär als Vollstrecker der Zukunft an den Gegenwärtigen, das war Che Guevara, der tragische Berufsrevolutionär, der den Weg von der Menschenliebe zum Zynismus ging.“ Und gelinde gesagt befremdlich geraten schließlich die Ausführungen im vorletzten Kapitel, wenn die Frage nach den Millionen Opfern des Kommunismus („War es das wert?“) wie folgt traktiert wird: „Doch die Frage fußt ohnehin auf einer falsche Voraussetzung. Es ist ja nicht so, dass vor einer Revolution irgendein historisches Subjekt die Risiken wägt, kaltblütig die Opferzahlen vergleicht und schließlich (…) eine rationale Entscheidung trifft. Revolutionen sind Ereignisse. In ihnen verhält man sich, und das ist alles.“
An dieser Stelle wird klar, warum der Untertitel des Buches, „Schönheit und Schrecken“ nicht nur frivol klingt, sondern tatsächlich geschmäcklerisch ist. Dazu passt das Ende mit einem Blick auf den seit 1924 einbalsamierten Lenin im Mausoleum auf Moskaus Rotem Platz. Randow nennt die Mumie selbst „den erstaunlichsten Revolutionskitsch aller Zeiten“. Ein Buch zur Erinnerung an ihren jugendlichen Überschwang für ältere Semester und für solche, die trotz alledem Revolutionäre werden wollen.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: