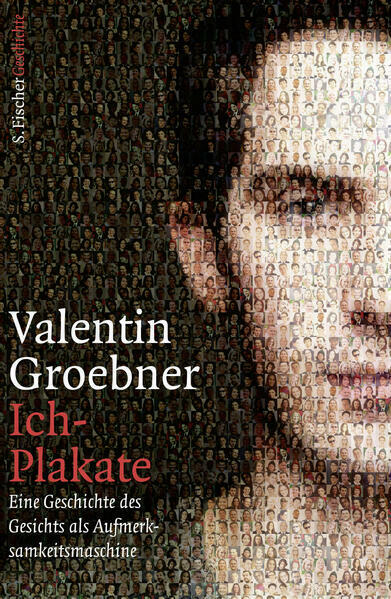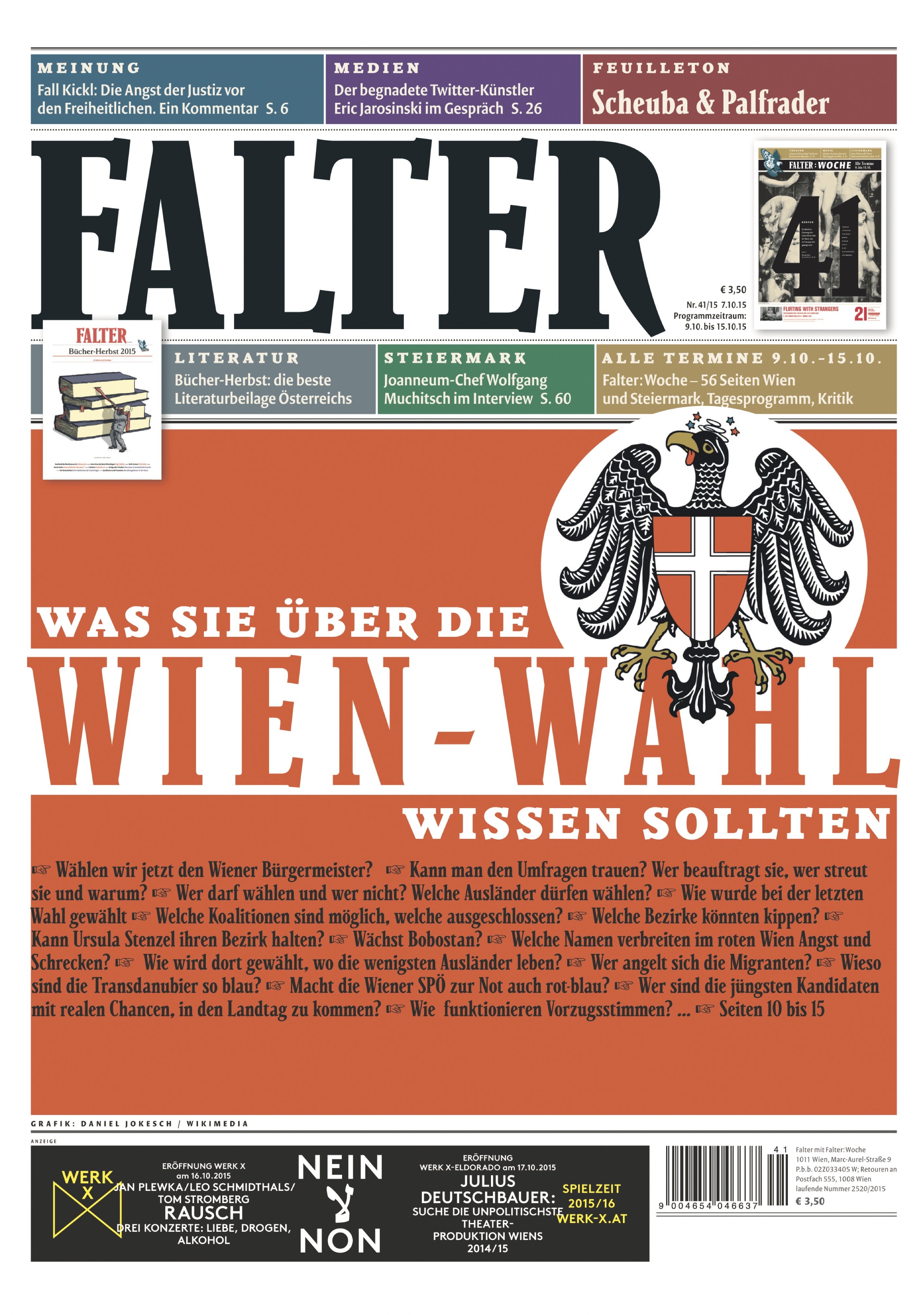
Vom Gemälde über das Photomaten-Porträt zum Selfie
Julia Kospach in FALTER 41/2015 vom 07.10.2015 (S. 53)
Medien: Valentin Groebner untersucht Plakatgesichter und geht dafür weit in die Kunstgeschichte zurück
Das Wort Selfie hat, wiewohl es noch sehr jung ist, bereits eine steile Karriere gemacht. Erstmals 2002 belegt, kürte es die Redaktion des Oxford Dictionary schon 2013 zum Wort des Jahres. Das dahinterstehende Phänomen des selbstgemachten digitalen Bildes vom eigenen Gesicht, schreibt der Historiker Valentin Groebner in seinem Essay „Ich-Plakate“, ist in der Social-Media-Welt „zu einer Art Ego-Wappen“ geworden.
Man könnte meinen, es führe in die falsche Zeitrichtung, etwas so Altmodisches wie die Heraldik für die Beschreibung einer so brandneuen Erscheinung wie des Selfie zu bemühen. Doch genau mit dem Blick zurück nähert sich Valentin Groebner seinem Thema.
Im Zentrum stehen die tausenden Gesichter, die uns rund um die Uhr von Werbeplakaten anschauen und, wiewohl stumm, lautstark „Ich“-Botschaften verkünden. Groebner geht es nicht um bewegte Film-, Fernseh- oder Videogesichter, sondern um die – unbewegt – „sprechenden, lächelnden und zwinkernden Gesichter auf den Plakaten des 21. Jahrhunderts“. Es geht um Werbung. Das Selfie passt da als Akt der Selbstwerbung gut dazu.
Der Wiener Groebner, Jahrgang 1962, ist an der Universität Luzern Professor für Geschichte mit Schwerpunkt Mittelalter und Renaissance. Mittelalterliche Bilder vom Gesicht Christi, Porträts von Renaissancefürsten, Ikonen oder hochmittelalterliche Heiligengesichter „als interaktive Bildschirme ins Jenseits“ sind es denn auch, die er heranzieht, um die ungeheure Wirkung von Gesichtern in Großaufnahme zu beleuchten. Eine Diskrepanz arbeitet er dabei besonders heraus: Anders als die Gesichtsbilder in ihrer Wirkung suggerieren, ist die Verbindung zwischen dem Porträt und dem Porträtierten von jeher mehr als lose.
Wirklichkeitsnah werden Porträts ab den 30er-Jahren des 15. Jahrhunderts. Jan van Eycks gemeinhin als Selbstporträt gedeutetes Gemälde „Mann mit rotem Kopftuch“ (1433) gilt dabei „als eine Art medialer Urknall des Konzepts vom abgebildeten Ich“. Doch dieses „Ich“, in dem die traditionelle kunsthistorische Deutung den endgültigen Durchbruch des realistischen autonomen Porträts erkannt hat und das seinen Höhepunkt in den berühmten Porträtgemälden der Renaissance erlebte, hatte einen Haken.
Die Gesichtsbilder, die so häufig den Vermerk „ad vivum“ oder „au vif“ trugen und damit nahelegten, sie seien nach der Natur gemalt worden und würden den Porträtierten wie lebendig darstellen, entstanden oft nach anderen Bildern. Kein lebendiger Mensch saß je für sie Modell. Damit ist man beim Kern von Groebners medienhistorischer Betrachtung: „Das Gesicht, das Ich sagt, führt deswegen zu keinem Original. Sondern in die Geschichte der Techniken, ein Bild möglichst optimal wirken zu lassen.“ Diese Wirkung basiert auf Wiederholung, auf der Vervielfältigung nicht-authentischer Gesichter und auf dem mitgelieferten Kontext. Die Gesichter tun nur so, als wären sie eine Kopie des Originals mit all dessen Eigenschaften.
Stark macht sie ihre Suggestionskraft. Sie treten die Nachfolge älterer Darstellungsmuster für das Übernatürliche, Heilige und Übersinnliche an. Die „lächelnden Münder und funkelnden Augen auf den Plakaten, die einer Ware ein Gesicht geben sollen, sind hilfreiche Täuschungen, Angebote zur Metamorphose“. Sie enthalten ein starkes „Versprechen von Verwandlung“. Im Dienste dieses Effekts dürfen Werbegesichter nicht allzu einzigartig sein.
Die Großaufnahmen fotografierter Gesichter, die uns heute so allgegenwärtig sind, hatten nach dem Ersten Weltkrieg auf Plakaten und Zeitungstitelseiten ihre ersten Auftritte. Nicht lang danach feierte ein anderes Phänomen einen riesigen Erfolg: die Photomaten-Kabinen. Für wenig Geld bekam man mehr als ein halbes Dutzend kleiner Gesichtsbilder von sich selbst, von denen man das beste behielt. Die in tausenden solcher Fotokabinen entstandenen Selbstporträts zeigen „das Streben nach dem Wunsch-Gesicht: die allein vor einem Spiegel eingenommene Pose“. Und lassen sich getrost als die historischen Vorläufer der heutigen Selfies verstehen.