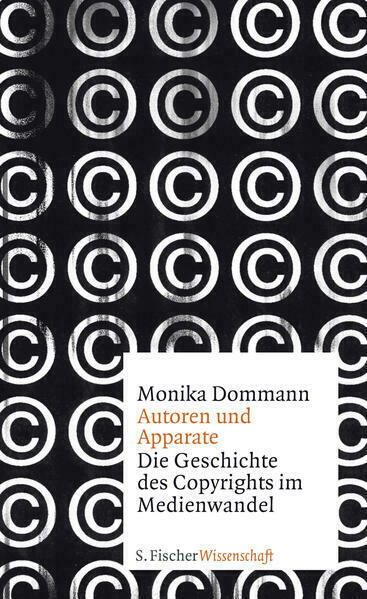Was ich schreibe, gehört mir. Aber wer zahlt mit?
Rudolf Walther in FALTER 17/2014 vom 23.04.2014 (S. 18)
Das Urheberrecht ist nicht erst seit Google Books umkämpft. Eine Studie geht den historischen Wurzeln des geistigen Eigentums nach
Oberflächlich betrachtet sieht es so aus, als ob die Möglichkeit, übers Internet Musikstücke oder – dank der medialen Macht von Giganten wie Google – Bücher gratis zu beschaffen, gleichsam über Nacht das Autoren- und Urheberrecht bzw. das Copyright zerstören würde. Die Studie von Monika Dommann zeigt, dass es sich dabei um eine unhistorische Dramatisierung handelt.
Tatsächlich war das im 18. Jahrhundert entstandene Urheberrecht immer geprägt von Konflikten zwischen den daran Interessierten (Autoren, Verlegern, Druckern, Buchhändlern, Lesern). Und diese Konflikte veränderten sich mit den Techniken der Vervielfältigung und Verbreitung von Wissen durch Apparate von der Fotokamera über das Grammofon und das Radio und den Film bis zum Fotokopierer und dem Computer.
Das Recht, das diese Konflikte regeln sollte, bewegte sich freilich nicht im luftleeren Raum, sondern entwickelte sich in Kontexten, die sozial, wirtschaftlich und politisch, aber auch technisch geprägt waren und immer wieder neue Vervielfältigungspraktiken hervorbrachten, die die Rechtsfigur des Urheberrechts bzw. geistigen Eigentums zu Anpassungen herausforderte.
Die Studie befasst sich mit der Entwicklung im Zeitraum zwischen 1850 und 1980 und behandelt die Verhältnisse in Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien) und in den USA.
Ein Urheberrecht, das den Autor und den Verleger eines Werks vor Nachdrucken schützt, entstand erst im Zuge der Aufklärung. Davor waren Drucker und Verleger auf eine Erlaubnis der Obrigkeit angewiesen, die diese zugleich als Überwachungsinstrument (Zensur) benützte. Das Urheberrecht schützte zunächst auf dem Territorium eines Staates das schriftlich vorliegende Werk eines Individuums und stiftete so einen Zusammenhang von geistiger Arbeit und Eigentum, wie ihn John Locke (1632–1704) theoretisch zuerst konzipierte und die Staaten erst anfangs des 19. Jahrhunderts rechtlich normierten. Diese Regelung erwies sich bald als ungenügend und so kam es zur Internationalisierung des Autorenrechts im Rahmen der Berner Konvention von 1886.
Die Musikdose als Anfang
Unter das Urheberrecht fielen mit der Berner Konvention auch Musiknoten, aber nur insofern, als sie gedruckt vorlagen. Mit der Erfindung und Verbreitung von Musikdosen, die Musik mechanisch vervielfältigten, entstand ein Konflikt zwischen Musikdosenherstellern und dem Recht des Komponisten. Das Urheberrecht konnte nur erhalten werden, indem man es vom Kriterium der Schriftlichkeit ablöste und etwa Musikdosenfabrikanten verpflichtete, Komponisten an den Einnahmen aus dem Verkauf von Apparaten zu beteiligen. Diese Erweiterung des geistigen Eigentums öffnete den Weg für die ökonomische Verwertung von neuen Vervielfältigungstechniken (Fotografie) bereits Ende des 19. Jahrhunderts. Die Integration neuer Vervielfältigungsapparate ins Urheberrecht führte mit jedem Innovationsschub zu neuen Interessenkollisionen und -konflikten.
Mit der Erfindung des Grammofons etwa kamen neben den Komponisten und Musikverlegern Musikinterpreten hinzu, die an der Verwertung ihrer Arbeit mitbeteiligt werden wollten. Da der einzelne Urheber jedoch den nationalen – und erst recht den internationalen Markt – nicht überblicken konnte, entstanden zuerst in Frankreich und später in anderen Ländern Verwertungsagenturen, die den Markt für ihre Mitglieder beobachteten und das Inkasso von Gebühren sowie die Umverteilung dieser Tantiemen an die Urheber übernahmen.
Die USA lösen es anders
Die Konflikte konnten jedoch nie endgültig gelöst werden, wie Monika Dommann etwa anhand der Erfindung des Tonbandgeräts zeigt. Das Tonbandgerät macht den Besitzer zum Sammler von Musik aus dem Radio oder von Schallplatten und virtuell zu einem Konzertveranstalter, bei dem keine Verwertungsagentur Gebühren einfordern kann. Wird der Apparat für die einen zur tödlichen Gefahr für die gesamte Musikkultur, so beschwören andere immer wieder das Urheberrecht als einzigen Kulturschutz.
Um den Interessenkonflikt zwischen Radioanstalten, Musikverlegern, Komponisten, Interpreten, Schallplattenindustrie und Tonbandproduzenten zu kanalisieren, führte man nach langwierigen Verhandlungen 1965 eine Apparateabgabe ein: Der Verkäufer eines Tonbandgeräts muss seither in Deutschland fünf Prozent des Ladenpreises an eine Verwertungsagentur abführen, die das Geld an Urheber, Verleger und Interpreten verteilt.
Aufschlussreich ist die in manchen Zügen abweichende Entwicklung in den USA. Während etwa in Deutschland das Fotokopieren zum eigenen Gebrauch gebührenpflichtig wurde, lehnten die USA eine Regulierung wissenschaftlicher Arbeit durch Geldabgaben ab. Schon in den 1930er-Jahren waren die amerikanischen Bibliotheken dazu übergegangen, große Bestände auf Mikrofilme zu kopieren und so seltene Bücher und Zeitschriften einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Der Zusammenhang von geistiger Arbeit und Eigentum differenzierte sich unter dem Druck technischer Innovation, wirtschaftlichen Wandels, sozialer und rechtlicher Entwicklungen aus, löste sich aber – trotz apokalyptischer Prognosen – nicht auf, sondern wurde neuen Kontexten, Arbeitsbedürfnissen und Interessen angepasst. Zu diesem Anpassungs- und Aushandlungsprozess gehören Lobbying ebenso wie Zweckallianzen zwischen Interessenten.
Monika Dommanns materialreiche Studie ordnet ein weitgehend unbekanntes und komplexes Thema übersichtlich und obendrein gut lesbar. Eine Pionierarbeit.