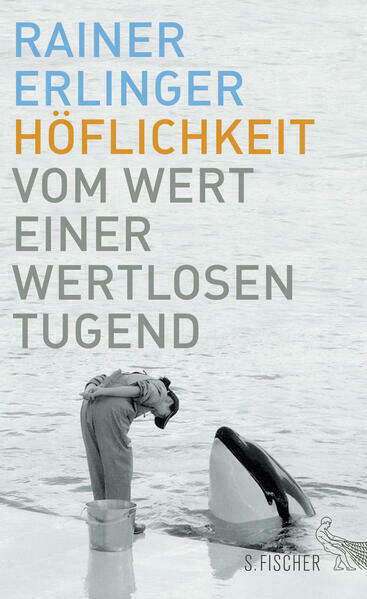Höflichkeit ist der Schmierstoff des Zusammenlebens
Julia Kospach in FALTER 11/2016 vom 16.03.2016 (S. 46)
Ethik: Rainer Erlinger erklärt die Tugend der Höflichkeit und klopft sie auf ihre Vor- und Nachteile ab
Wenn man lang darüber nachdenkt, kann Höflichkeit schnell zu einer zweischneidigen Angelegenheit werde. Für Rainer Erlinger ist sie das, und er hat viel und lange darüber nachgedacht. Nicht erst jetzt für sein Buch „Höflichkeit. Vom Wert einer wertlosen Tugend“, sondern auch in seiner Kolumne „Die Gewissensfrage“ in der Süddeutschen Zeitung, wo er Leserfragen zu Ethikproblemen des Alltags beantwortet.
Rainer Erlinger ist längst ein Profi im Überwinden kniffliger Alltagsstolpersteine. Er tut das, indem er Argumente abwägt, große Denker zu Rate zieht und schließlich meist zu einer handfesten Verhaltensempfehlung kommt. In der Kolumne wie auch seinem neuen Buch liegt seine Stärke in der unaufgeregten dialektischen Betrachtung von Problemstellungen und in seinem eleganten, pfiffigen Schreibstil.
Er ist gescheit und belesen und behält den mahnend ausgestreckten Zeigefinger stets eingepackt. Das Hilfszeitwort „sollen“, dem man in Ethikdiskussionen so oft begegnet, taucht bei ihm selten auf. Er hat es durch ein besonnenes Einerseits-Andererseits ersetzt, an dessen Ende es immer noch jedem freisteht, es so zu machen, wie es ihm selbst beliebt.
Auch jetzt präsentiert sich Erlinger nicht als Benimmlehrer. Stattdessen stellt er erst einmal nur fest, dass Höflichkeit das Miteinander angenehmer gestaltet. Sie ist „der Schmierstoff des Zusammenlebens“, das Gleitmittel, auf dem wir alle halbwegs geschmeidig durch die meisten Situationen kommen, mit denen wir es im Lauf eines Tages zu tun haben.
Doch kaum hat Erlinger das gesagt, ist er auch schon bei einer Radierung von Paul Klee angekommen, die den Titel „Zwei Männer, einander in höherer Stellung vermutend, begrüßen sich“ trägt. Darauf zu sehen sind die nackten, tief voreinander verbeugten Gestalten von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiser Wilhelm II. Ihre Verneigung voreinander ist so tief, dass sie die Grenze zur Unterwürfigkeit weit überschreitet.
Übertriebene Höflichkeit zielt zweifellos auf die Stellung des Gegenübers ab und nicht auf dessen Person. Genau hier sieht Erlinger ein zentrales Wesensmerkmal „echter“ Höflichkeit. Sie will der Person Achtung erweisen und dient dabei nicht (oder nicht nur) dem Höflichen selbst oder bestimmten starren Vorstellungen und Konventionen.
Damit ist man mittendrin im Abgrenzungsreigen, den Erlingers Buch in der Folge so anmutig vollführt. Höflichkeit ist nicht gleich Etikette, auch wenn die beiden viel miteinander zu tun haben. Natürlich behandelt Erlinger auch emotions- und konfliktgeladene Klassiker wie Türe-Aufhalten, Rechnung-im-Restaurant-Übernehmen, Nach-seinem-Urteil-über-die-neue-Frisur-gefragt-Werden und die Frage: „Darf man es sagen, wenn einem ein Geschenk nicht gefällt?“
Diese und Dutzende anderer kniffliger Situationen, für deren höfliche Bewältigung „die Besonderheit des Einzelfalls“ so wichtig ist, dekliniert Erlinger auf das Anregendste durch. Eines seiner Fazite lautet: „Nicht der Drang zur Wahrheit, sondern die Unfähigkeit zu schweigen ist der größte Feind der Höflichkeit.“ Das ist jedenfalls gut gesagt.
Daneben mäandert Erlinger in weniger erwartbare Gebiete aus, um mithilfe dieser Umzingelungstaktik die Höflichkeit in ihrem Wesen genauer zu definieren. Es geht um Sexismus und Toleranz, um Willkommenskultur und Provokation, sogar um Hygiene und Höflichkeit. Ein Kapitel widmet sich dem Händedruck und seinen bakteriellen Gefahren.
Erlinger bricht eine Lanze für die Pflege der Höflichkeit, sofern sie Achtung vorm Gegenüber ausdrückt. Das hindert ihn nicht, auch deutlich eine Gefahr zu benennen, die von ihr ausgeht: Sie ist ihrem Wesen nach konservativ und neigt dazu, Veränderungen zu behindern. Das Missverhältnis zwischen Theorie und Praxis ist einem wie Erlinger ohnehin stets bewusst: „Zwischen ‚Ach, schraub doch bitte die Zahnpastatube zu‘ und ‚Du faules Schwein lässt immer alles rumliegen und kümmerst dich um gar nichts‘ liegen aus Sicht der Höflichkeits-Linguistik Welten, im praktischen Leben dagegen nur ein schmaler Grat.“