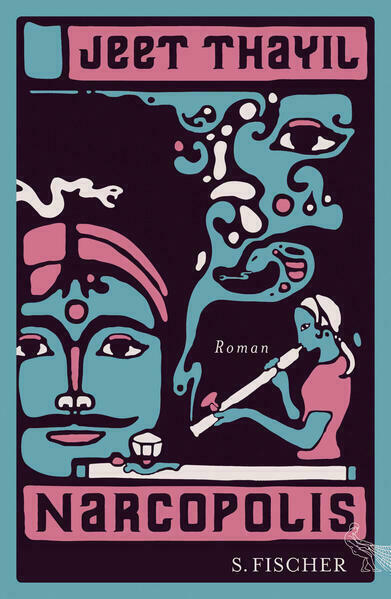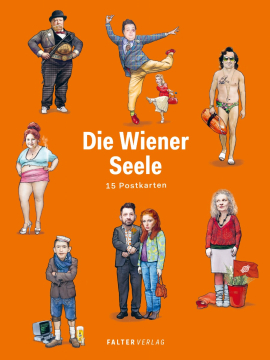Von der Opiumhöhle zur Heroinhölle
Sigrid Löffler in FALTER 41/2013 vom 09.10.2013 (S. 28)
Jeet Thayil und Mohsin Hamid erzählen von den menschenverschlingenden Megastädten Asiens
Man erkennt es erst auf den zweiten Blick: Die eigentlichen Protagonisten der Romane des Inders Jeet Thayil und des Pakistani Mohsin Hamid sind die vor sich hin explodierenden Megastädte Asiens, und ihr eigentliches Thema ist die Verstädterung. "Zieh in die Stadt", lautet der Lockruf, der junge Leute vom Land auf der Suche nach einem besseren Leben heute in die Millionenstädte treibt, wo ihnen, um Fuß zu fassen, jedes Mittel recht sein muss – weshalb
die Aufsteigergeschichten in den neuen Großstadtromanen vom indischen Subkontinent meist eine kriminelle Schlagseite haben.
Asien boomt, doch die Dynamik seiner monströs wachsenden Mammutstädte speist sich auch aus Verbrechen, Korruption und Gewalt. Auf legalem Wege, so der Lektüreeindruck aus den jüngsten Mega-City-Romanen, können junge Habenichtse aus den Dörfern in der Stadt nicht reich werden, geschweige denn stinkreich.
Das gilt für den namenlosen armen Dorfjungen, dessen Aufstieg und Scheitern in einer namenlosen Megalopolis Mohsin Hamid in seinem dritten Roman "So wirst du stinkreich im boomenden Asien" nachzeichnet, ebenso wie für die Hauptfiguren im Debütroman des indischen Lyrikers und Musikers Jeet Thayil, der in "Narcopolis" ein nächtliches Bombay beschreibt, das an der Nadel hängt.
Am Beispiel einer Gruppe von Süchtigen erzählt Thayil den Übergang von der Opiumhöhle zur Heroinhölle Bombay in den 1990er-Jahren. Kaum je fällt Tageslicht in diesen Dämmerroman, der die schummrigen Schauplätze seiner Schattenwelt fast nie verlässt und erst am Schluss in die schimmernden Nachtklubs der neureichen Hindu-Schickeria von heute wechselt, die Kokain und Ecstasy konsumiert, neue Drogen für ein neues Bombay.
Anfangs zieht noch der Opiumrauch durch Raschids finstere Kaschemme in
der Shuklaji Street, mitten im verrufensten Rotlichtviertel der Stadt. Der Roman lässt eingangs die schwarze Legende des alten Bombay, die geheime Geschichte der Drogenrituale in den Opiumhöhlen der 1970er- und 1980er-Jahre, in unendlichen kreiselnden, halluzinatorischen Wortwirbeln auferstehen und erinnert, nicht ohne Wehmut, an üppige Drogenräusche voll verschwiegener spiritueller Pracht – köstliche narkotische Tagträumereien, genossen im Kokon von Raschids wohlig gepolstertem Etablissement und sorgsam begleitet von den
Zeremonien des Eunuchen Dimple, einer transsexuellen Prostituierten, die die Pfeifen so kunstvoll zu stopfen versteht.
Er/sie ist das Gravitationszentrum des Romans, sein moralischer und emotionaler Mittelpunkt; sein/ihr Schicksal hält die
sich über drei Jahrzehnte erstreckende
Geschichte zusammen. Die Laster der Stammkunden – ein bunter Haufen von Zuhältern, Dealern, Künstlern und Gangstern, bald auch von Hippies und anderen neugierigen ausländischen Touristen – erscheinen in milde Nostalgie getaucht. Doch gleichsam über Nacht steigen die Stammkunden – und mit ihnen auch Raschid und Dimple – von der Opiumpfeife auf Heroin um. Verglichen mit dem neuen, harten Stoff wirkt das altmodische Opium geradezu harmlos.
Der schwarze Glamour des Opiumkonsums, genossen als kleiner Freiheitsrausch, als zeitweilige chemische Erlösung von der Alltagstrübsal, ist verschwunden. Ersetzt wurde das Rauschglück durch das Elend der Abhängigkeit von dreckigem Stoff und durch den körperlichen Verfall. So driftet der Roman durch seine private Nischenwelt aus kleinen Erlösungen und großem Grauen.
Jeet Thayil, der aus seiner Junkie-Erfahrung keinen Hehl macht und seine 20 an die Sucht vergeudeten Jahre in Interviews bedauert hat, will sich mit diesem Debüt in die reiche Drogen-Weltliteratur von Thomas de Quincey bis William S. Burroughs einschreiben. Dabei ist es ihm weniger um heroische Junkie-Nostalgie plus moralischen Entzugskater zu tun als vielmehr um das Gedenken an die Drogenköpfe, die mit ihm in den Opiumhöhlen der Shuklaji Street auszuschweifen pflegten – die Süchtler, die Abgestürzten, die Kaputten. Ihnen will er mit "Narcopolis" ein Denkmal setzen, in der Erinnerung an eine Welt, die nicht mehr existiert – außer auf den Seiten eines Buches.
Ein ganz anderer Erzählton herrscht in Mohsin Hamids "So wirst du stinkreich im boomenden Asien". Dieser scharfsichtige und bissige Roman verkleidet sich in sarkastischer Absicht als Selbsthilfebuch, indem er zugleich seinen Helden und den Leser in der Du-Form anspricht und nach Art der Ratgeberliteratur mit Karrieretipps versorgt: Zieh in die Stadt. Verschaff dir Bildung. Meide Idealisten.
Der Held bringt es vom armen Nobody aus der ländlichen Hinterwelt zum korrupten Tycoon in einer Mega-City. Seinen Reichtum verdankt er einer guten Geschäftsidee und einer Portion Skrupellosigkeit bei deren Umsetzung: Als findiger Selfmademan nutzt er den krassen allgemeinen Trinkwassermangel, steigt mit gefälschtem Mineralwasser (abgekochtem Nutzwasser) ins Tafelwassergeschäft ein und baut sich ein Imperium auf, wobei er auch die immer zynischeren Ratgebertipps beherzigt: Scheue nicht vor Gewalt zurück. Jongliere mit Schulden.
Ohne Bestechung, Mord und blutige Revierkämpfe mit Konkurrenten geht es nicht ab. Damit beginnt der geschäftliche Ruin des Helden, denn für die ganz große Abzocke fehlt diesem Außenseiter der Zugang zum Netzwerk der Machtelite, die die einträglichsten Pfründen immer noch unter sich verteilt.
Einen weiteren Rat ("Verlieb dich nicht") missachtet der Held. Seine große Liebe ist und bleibt "das hübsche Mädchen", dessen Aufstieg und Fall parallel zu seiner Karriere verlaufen. Seinen glänzenden Ruf als Seismograf der Umbrüche, die den indischen Subkontinent heute durchrütteln, bestätigt Mohsin Hamid mit diesem Roman aufs Neue.