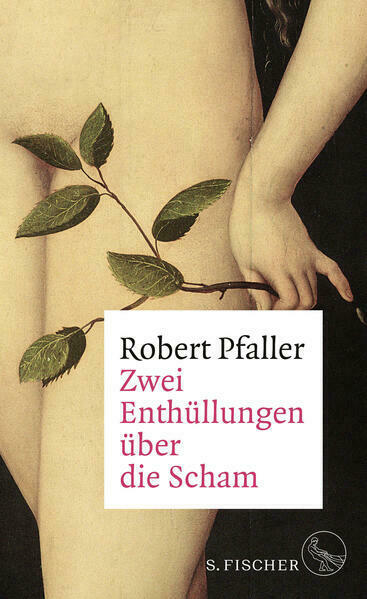"Scham ist eine Ressource der Solidarität"
Klaus Nüchtern in FALTER 22/2022 vom 01.06.2022 (S. 25)
Es vergeht kein Tag, ohne dass sich Menschen verletzt, gekränkt und beschämt fühlen und daraus Ansprüche auf Abbitte, Wiedergutmachung, Kompensation ableiten. Verletzungen sind zur harten politischen Währung geworden: Schnell ist jemand als Rassist und Sexist identifiziert und gerät in einen Shitstorm mit den bekannt verheerenden Folgen: "keine Möglichkeit der Anhörung, der Klarstellung und der Rechtfertigung. Ankläger und Gericht sind identisch, und der Angeklagte hat eigentlich nur eine Möglichkeit: zu verschwinden."
Der Wiener Philosoph Robert Pfaller, aus dessen soeben erschienenem Buch das Zitat stammt, ist für sein Unbehagen an der Identitätspolitik bekannt. In "Erwachsenensprache" (2017) kritisierte er die "Mikropolitiken der Rücksicht auf Empfindliche" mit ihren Geboten des politisch korrekten Sprachgebrauchs als Strategie der Bevormundung und der Verschleierung von Macht-und Klassenverhältnissen.
In "Zwei Enthüllungen über die Scham" denkt Pfaller in diese Richtung weiter, konzentriert sich dabei aber auf das im Titel genannte Phänomen, das bekanntlich das Gefühl auslöst, am liebsten vom Erdboden verschluckt zu werden, also: zu verschwinden. Anknüpfend an die Unterscheidung zwischen Scham-und Schuldkulturen zeigt er, dass die Scham keineswegs, wie lange angenommen, nur außengeleitet und damit moralisch "weniger nobel" als das vom eigenen Über-Ich verhängte Schuldgefühl ist, sondern dass unsere Zeit, in der es üblich geworden ist, Menschen eher aufgrund ihrer Identität anzugreifen als wegen ihrer Haltungen und Positionen, "stärker einer Kultur der Scham [ähnelt] als einer der Schuld".
Die politische Macht der Scham manifestiere sich aber nicht nur in den Möglichkeiten der Beschämung, des "shaming", sondern umfasse auch ein Diskretionsgebot: Als Takt-und Ehrgefühl stelle die Scham eine Ressource bereit, über uns hinauszuwachsen und mehr zu werden als das, was angeblich unsere Identität determiniere.
Falter: Als jemand, der von Freud und Žižek kommt, ist es Ihnen sicher recht, wenn wir mit einem Witz beginnen. Treffen sich zwei alte Freunde. Der eine erzählt dem anderen von seinen Inkontinenzproblemen und dass er schon erfolglos eine ganze Reihe von Ärzten konsultiert habe. Der andere rät ihm, es einmal mit einem Psychotherapeuten zu versuchen. Beim nächsten Treffen bestätigt ihm der Freund, dass das ein sehr guter Rat war. "Du machst dir also nicht mehr in die Hose?", will der andere wissen. "Das schon, aber es macht mir nichts mehr aus."
Robert Pfaller: Den hat mir meine Mutter erzählt. Was der Witz gut illustriert, ist, dass die Scham - anders als die Schuld - Ursachen hat, für die man nichts kann. Der Philosoph Günther Anders etwa schreibt in "Die Antiquiertheit des Menschen":"Nicht obwohl, sondern weil er nichts dafür kann, schämt sich der Bucklige des Buckels." Darüber zielt der Witz auch auf die Vorstellung, dass man gar nicht die Ursachen, sondern bloß das Gefühl der Scham beseitigen müsse.
Pfaller: Das ist eine alte Idee, die wir schon in der griechischen Antike bei den Kynikern finden und die 1968 wieder aufgegriffen wird, aber eine politische Arbeit am falschen Punkt darstellt. Menschen werden sich immer für etwas schämen, wofür sie nichts können. Anstatt also zu versuchen, die Scham zu beseitigen, sollte man darauf achten, dass sie keine Ungleichheiten und Benachteiligungen produziert. Außerdem sorgt die Scham nicht nur dafür, dass ich Peinlichkeiten zu vermeiden suche, sondern enthält auch ein Diskretionsgebot: Wenn ein anderer sich eine Blöße gibt, bin ich dazu angehalten, so zu tun, als hätte ich das nicht bemerkt oder als würde sie gar nicht existieren. Dieser Aspekt wird sehr oft übersehen, weil man nur das Peinliche und Unangenehme an der Scham registriert. Tatsächlich ist sie aber auch eine großartige Ressource der Solidarität.
Als Beleg dafür führen Sie in Ihrem Buch Howard Hawks' Screwball-Comedy "Bringing Up Baby" an.
Pfaller: Ja, die sogenannte "Torn dress scene", in der Cary Grant und Katharine Hepburn einander zum wiederholten Male treffen - diesmal in einem vornehmen Restaurant. Sie will sich bei ihm dafür entschuldigen, dass ihre Begegnungen bislang immer schiefgegangen sind, hält ihn fest und zerreißt ihm dabei den Frack. Worauf er meint, sie solle verschwinden. Nun ist sie beleidigt, dreht sich um und geht. Unglücklicherweise steht er auf ihrem Abendkleid, das nun seinerseits reißt, worauf Katherine Hepburn untenrum entblößt ist, das aber nicht bemerkt; im Unterschied zu Cary Grant, der mit seinem Zylinder versucht, ihre Blöße zu bedecken. Schlussendlich haben die beiden einen sehr merkwürdigen und komischen gemeinsamen Abgang.
Und die Pointe der Szene
Pfaller: besteht darin, dass Cary Grant, dem Katharine Hepburn in diesem Moment furchtbar auf die Nerven geht, sich dennoch dafür verantwortlich fühlt, ihr diese Peinlichkeit zu ersparen.
Das "Fremdschämen", das Sie als "neues Sprachspiel" bezeichnen, ist aber etwas ganz anderes, oder?
Pfaller: Ja, weil die Menschen in diesem Falle das Gebot der Diskretion vorsätzlich missachten. Die schämen sich nicht nur für jemand anderen, sondern fühlen sich auch bemüßigt, das in die Welt hinauszuposaunen, und schlagen daraus einen Distinktionsgewinn heraus.
In letzter Zeit hat auch die "Macht der Kränkung", so der Titel eines Buches des Psychiaters Reinhard Haller, starke Beachtung erfahren. Wie würden Sie zwischen "Kränkung" und "Beschämung" differenzieren?
Pfaller: Bei Kränkungen handelt es sich um psychische Verletzungen, die durch jemanden, oft ungewollt, ausgelöst werden. Beim sogenannten Shaming dagegen wird ganz bewusst sozialer Druck auf jemanden ausgeübt, wodurch Furcht vor dem Verlust von Geschäftskontakten oder Arbeitsmöglichkeiten entsteht. Es ist aber nicht sicher, ob jenseits dieser sehr realistischen Furcht auch eine innerpsychische Selbstverurteilung wie das Scham-oder das Schuldgefühl entsteht. Andererseits gibt es auch noble Beschämungen -etwa durch eine besonders großzügige Einladung. Während es ein Anlass von Kränkung sein kann, irgendwo nicht eingeladen zu werden, kann Beschämung also gerade dadurch entstehen, eingeladen zu sein.
Sie knüpfen in Ihrem Buch an die Unterscheidung zwischen Scham-und Schuldkulturen an. Was ist damit gemeint?
Pfaller: Die amerikanische Anthropologin Ruth Benedict hat eine große Studie im Auftrag der amerikanischen Armee durchgeführt, weil diese wissen wollte, mit welchem Feind sie es zu tun hat. Das Verhältnis zwischen Gefangenen und getöteten Feinden im Zweiten Weltkrieg betrug in etwa eins zu drei - und zwar an allen Fronten, außer im Pazifikkrieg: Da kamen auf einen Gefangenen 120 Tote. Benedict hat gezeigt, dass in der japanischen Kultur Scham und Ehre die großen Regulative sind. So hat sich zum Beispiel eine Reihe von Schuldirektoren umgebracht, nachdem die Schulgebäude ohne ihre Schuld in Brand geraten waren. Weil aber das Bild des Kaisers, das in jeder Schule hängt, bei dem Brand beschädigt wurde, war auch die Ehre des Direktors zerstört. Das ist in unserer Kultur undenkbar. Man würde sagen: "Ist doch nicht deine Schuld und war ja auch bloß ein Bild."
Klingt sehr plausibel. Wo also hat sich Benedict Ihrer Auffassung nach verrannt?
Pfaller: Bei der Annahme, dass Schuldkulturen von der Stimme des inneren Gewissens geleitet würden, es bei den rein außengeleiteten Schamkulturen hingegen nur darum gehe, das eigene Fehlverhalten vor den Blicken der anderen zu verbergen. Das hat auch kulturanthropologisch fatale Konsequenzen insofern, als die Schamkulturen dann gleichsam als die kindlichen Vorläufer der erwachsenen Schuldkulturen dastehen.
Wie lässt sich diese Auffassung widerlegen? Pfaller: An den Beispielen der Anthropologen und Ethnologen selbst. In einem berühmten Fall schildert Bronislaw Malinowski den Fall eines jungen Mannes von den Trobriand-Inseln, der ein tabuisiertes Verhältnis mit einer Cousine unterhielt, das von einem Nebenbuhler öffentlich gemacht wurde. Worauf sich der beschämte Trobriander feierlich kleidete, auf eine sehr hohe Palme kletterte, eine lange Rede über den Verlust seiner Ehre hielt und sich zu Tode stürzte. Die Pointe an dem Fall
Robert Pfaller wurde 1962 in Wien geboren. Ebendort und in Berlin studierte er Philosophie. International bekannt wurde er durch seine Theorie der "Interpassivität" (2000), auch Bücher wie "Wofür es sich zu leben lohnt"(2011) oder "Erwachsenensprache"(2017) fanden weithin Beachtung. Zuletzt erschien "Die blitzenden Waffen"(2020). Nach Gastprofessuren u.a. in Chicago, Straßburg und Zürich ist Pfaller heute Professor für Philosophie an der Kunstuniversität Linz ist aber, dass der ganze Stamm von diesem Verhältnis längst wusste und darüber sogar Witze gerissen hat. Das belegt, dass die Scham nicht zu dem Zeitpunkt ausbricht, in dem das tabuisierte Verhältnis den anderen zur Kenntnis gebracht wird, sondern in dem Moment, in dem das offene Geheimnis nicht mehr als solches aufrechterhalten werden kann.
Aber warum? Pfaller: Offenbar gibt es eine Beobachtungsinstanz in uns, die zwar ähnlich funktioniert wie das Über-Ich, das Schuldgefühle auslöst, aber ganz anderen Kriterien folgt.
Sie nennen es das Unter-Ich. Pfaller: Genau. Und ihm gegenüber müssen wir den Augenschein wahren. Das ist die Instanz, die wir täuschen, wenn wir so tun, als ob.
Das führt Sie auch zu einer unorthodoxen Lesart von "Des Kaisers neue Kleider".
Pfaller: Ja. Diesem Märchen wird üblicherweise die Moral "Kindermund tut Wahrheit kund" unterstellt. Man kann es aber umgekehrt auch dahingehend auslegen, dass ohnedies alle gewusst haben, dass der Kaiser nackt ist, und nur das Kind zu naiv war, um das diskrete Spiel der Erwachsenen zu durchschauen und mitzuspielen.
In Ihrem Buch beziehen Sie sich auch auf die Netflix-Serie "The Chair". Sie handelt von einem US-amerikanischen Uni-Professor, der aufgrund eines eindeutig parodistisch gemeinten Hitlergrußes zum Nazi abgestempelt wird. Wie viel Realismus steckt in dieser Satire?
Pfaller: Ich halte sie für eine sehr realistische Darstellung der Systematik von Shitstorms: Leute sind auf Grundlage von sehr wenig Informationen sofort bereit, vernichtende Urteile zu fällen und publik zu machen. Und je geringer die Information ist, umso fanatischer fallen die Urteile aus.
Zugleich wird Information ignoriert: Der Professor ist ja kein unbeschriebenes Blatt!
Pfaller: Es ist sogar noch schlimmer: Die Tatsache, dass der Mann ein ausgewiesenes Profil als linker Literaturwissenschaftler hat, macht ihn erst recht zum Objekt studentischer Aggression. Man darf nicht übersehen, dass diese Kämpfe an den Universitäten Rationalisierungen eines stets schon bestehenden Konflikts sind: In gewisser Weise ist es ja beschämend, dass da vorn jemand steht, dem man zuhören muss, weil er mehr weiß und vielleicht über die raffinierteren Argumente verfügt.
Was daran wäre neu?
Pfaller: Was sich historisch geändert hat, ist die Art der Waffen, die eingesetzt werden. Vor 40 Jahren hätte man linksliberale Professoren vielleicht als "Reaktionäre" beschimpft, heute würden sich dieselben Studierenden in ihrer ethnischen, geschlechtlichen oder sexuellen Identität gekränkt fühlen, was bei der Stelle für Gleichbehandlung und, über diese vermittelt, in den Rektoraten auf weit offene Ohren stößt. Und weil diesen daran gelegen ist, ihr Bild als weltoffene Institution zu bewahren, sind sie geneigt, Exempel zu statuieren.
Genauso wie in "The Chair".
Pfaller: Und es hat an US-amerikanischen Universitäten zu geradezu kafkaesken Hexenjagden geführt, wie die amerikanische Filmtheoretikerin Laura Kipnis gezeigt hat. Man bekommt ein Mail, in dem einem mitgeteilt wird, dass man angeklagt worden ist, allerdings nicht, welchen Vergehens. Man habe sich jedenfalls an diesem oder jenem Tag einer Kommission gegenüber zu verantworten, allerdings ohne Rechtsbeistand. Und wenn man sich über das Verfahren öffentlich äußert, wird man gefeuert.
"Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet."
Pfaller: In etwa so. An einer staatlichen Uni wird man noch von einer Gesetzlichkeit geschützt, aber sobald das Privatunternehmen sind, können die feuern, wen sie wollen.
Apropos Kafka: Mich hat gewundert, dass der letzte Satz des "Prozeß" in Ihrem Buch nicht vorkommt: "[] es war, als sollte die Scham ihn überleben."
Pfaller: An den musste ich natürlich auch denken, nur hat ihn mein Kollege Daru Huppert schon vor Jahren zum Ausgangspunkt eines sehr inspirierenden Vortrags über die Scham gemacht, weswegen ich den nicht noch einmal aufgreifen wollte.
Er illustriert aber sehr gut eine Besonderheit der Scham: Sie kommt plötzlich, und sie ist total.
Pfaller: Das ist der spannende Punkt. Bei der Schuld ist das anders. Man freut sich zunächst vielleicht sogar über eine Schurkerei, die man begangen hat, und erst später beginnt das Gewissen zu nagen. Die Scham hingegen ähnelt einem Dammbruch: Da ist schon davor ein unglaublicher Druck vorhanden. Zugleich ist das aber auch der Hinweis auf die andere Seite der Scham, nämlich dass diese Kraft, wenn sie nicht freigesetzt wird, so etwas wie ein Guthaben darstellt.
Das Altgriechische drückt diese Ambivalenz mit einem einzigen Wort aus.
Pfaller: Ja, es lautet "aidos" und bezeichnet sowohl die "Scham" als auch die "Ehre". Die Ehre ist so etwas wie die positive Kehrseite der Scham -das, was uns großartig erscheinen lässt. Deswegen fordern Fußballtrainer von ihren Spielern derzeit, dass sie diese Ehre auf dem Feld auch körpersprachlich darstellen. Es ist also eine Frage der Ästhetik und einer Haltung, die man zur Schau stellen muss.
Sie nennen es "Verantwortungsästhetik". Was ist damit gemeint?
Pfaller: Das bezieht sich auf die Terminologie Max Webers, der zwischen einer "Gesinnungsethik" und einer "Verantwortungsethik" unterscheidet. Bei Ersterer kommt es eben auf die Intention an, bei Letzterer auf die Folgen der Handlung. Das Eigenartige an der Scham ist nun, dass auch moralisch völlig irrelevante Kleinigkeiten und ästhetische Verfehlungen furchtbar peinlich sein können. Man denke an den Weltbankpräsidenten Greenspan, der bei einem Empfang in der Türkei ohne Schuhe über den Teppich gehen musste und leider ein Loch im Socken hatte.
Um noch einmal auf den Fußball zurückzukommen: Als Fans von Zinédine Zidane hatten wir beim berüchtigten Kopfstoß wohl die gleiche widersprüchliche Empfindung: "Was für ein Irrsinn!" Aber auch: "Was für eine grandiose Geste!"
Pfaller: Das hat damit zu tun, dass Zidane ein Ehrenmann ist und keine Ethik der Würde vertritt. Die Würde ist ein bürgerliches System, bei dem man über kleine Beleidigungen hinwegsieht und bei großen Insulten sagt: "Sie hören von meinem Anwalt." Die Ehre aber ist verantwortungsästhetisch und beruht auf dem Augenschein.
Das schreit nach Rache?
Pfaller: Ja, wobei das Besondere an Zidane auch noch war, dass er sich selbst gerächt hat. Das war lange Zeit unüblich. Wenn jemand Herbert Prohaska in seiner Zeit bei der Austria auf die Zehen gestiegen ist, dann hat er sich dafür nicht selbst revanchiert, sondern Josef Sara oder Karl Daxbacher sind ausgerückt, um ihn zu rächen.
Ist Will Smith auch ein Mann der Ehre?
Pfaller: Die Menschen haben sich fürchterlich über seine Gewalttätigkeit empört. Man muss aber in Rechnung stellen, dass er Chris Rock nicht mit einem Kinnhaken niedergestreckt hat. Jemandem eine Ohrfeige zu verpassen ist immer auch eine symbolische Geste - diesen semiotischen Aspekt darf man nicht übersehen.
Sie versuchen die Ehre des "verschmockten" Ehrbegriffs zu retten. Warum?
Pfaller: Weil die Ehre als das Andere der Scham das Startkapital ist, mit dem wir als erwachsene Menschen operieren können. Wenn wir aber keine Zukunft für uns mehr sehen und das Gefühl haben, dass es uns morgen auf jeden Fall schlechter gehen wird als heute, wird auch der Ehrgeiz desavouiert, über uns hinauszuwachsen. Dabei besteht unsere kostbarste Fähigkeit doch genau darin, unsere blödsinnige naturwüchsige Existenz hinter uns zu lassen -was uns nun durch eine essenzialistische Propaganda abgewöhnt werden soll.
Heimito von Doderer pflegte trotzig zu behaupten: "Ich bin kein Herkünftler, sondern ein Hinkünftler."
Pfaller: Das ist ein wunderbarer Satz. Die eigene Herkunft ist ja in den seltensten Fällen eine Glücksquelle. Darüber hinaus hängt die Geselligkeit der Menschen, davon ab, dass wir nicht sofort gekränkt sind. Wenn wir nicht dazu in der Lage sind, von unseren Befindlichkeiten ein Stück weit abzusehen, dann -und das ist der politisch entscheidende Punkt -gewöhnen wir es uns auch ab, auf unsere Interessen zu achten. Diese Interessen ermöglichen es aber, uns mit Menschen anderer Herkunft und anderer Identität zusammenzuschließen: dann können sich Eisenbahnerin und Eisenbahner zusammentun und gemeinsam für anständige Pensionen kämpfen.