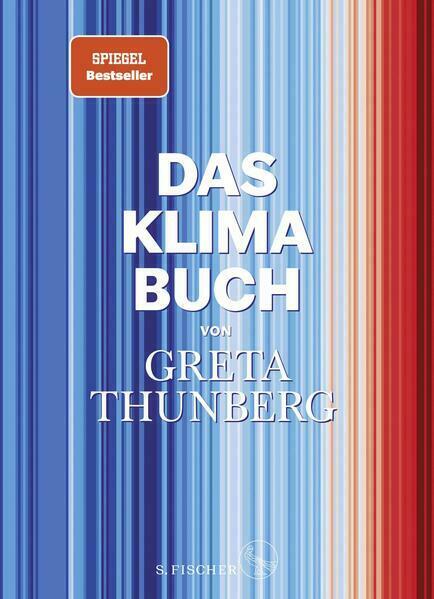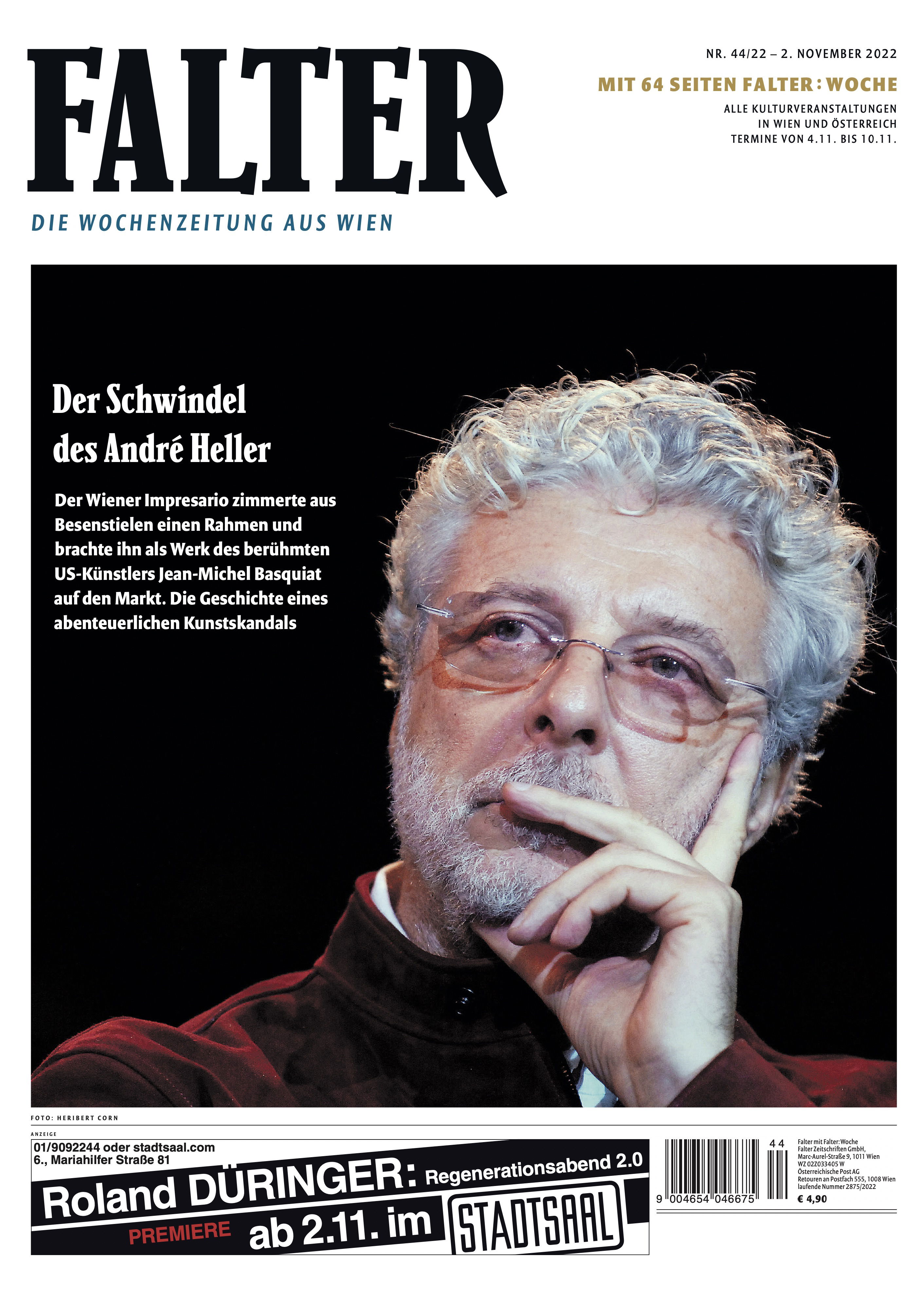
"Dies ist die größte Geschichte der Welt"
Gerlinde Pölsler in FALTER 44/2022 vom 02.11.2022 (S. 19)
Eigentlich hat Greta Thunberg alles falsch gemacht. Sich allein vor das Parlament setzen, nichts zu bieten haben außer ein Taferl, Fakten, moralische Appelle und Schuldgefühle - laut Verhaltensstudien "hätte es nicht funktionieren dürfen", wie ihr ein Psychologe später grinsend erklärte. "Aber es hat funktioniert."
Vier Jahre später legt die inzwischen 19-Jährige "Das Klima-Buch" mit dem Anspruch vor, den "aktuellsten Stand der Wissenschaft" abzubilden. Sie selbst leitet jedes Kapitel ein, den Großteil des Buches bestreiten Dutzende (Klima-)Forscher, Meteorologen, Psychologen und Autoren wie Margaret Atwood, Stefan Rahmstorf und Michael E. Mann.
"Dies ist die größte Geschichte der Welt", legt Thunberg los: Die Klimakrise sei "ohne Zweifel das Problem, das unser zukünftiges Alltagsleben prägen wird wie kein anderes". Was sie von anderen Krisen unterscheide, seien Zeitdruck und Unumkehrbarkeit: "Bei den gegenwärtigen Emissionsniveaus wird noch vor dem Ende dieses Jahrzehnts das Kohlenstoffbudget verbraucht sein, das uns verbleibt, um eine vernünftige Chance zu haben, unter 1,5 °C Erderwärmung zu bleiben." Ab diesem Punkt steigt das Risiko für irreversible Kettenreaktionen.
Nicht alle leiden gleich stark
Als roter Faden zieht sich das Thema Ungleichheit durch. "Wir sitzen nicht alle im selben Boot", betont Thunberg. Die reichen Länder würden "die Atmosphäre kolonialisieren" und nähmen "diejenigen, die am meisten von dieser Krise betroffen und am wenigsten dafür verantwortlich sind, immer fester in den Griff". Es sei das Mindeste, dass sie nun für die Schäden bezahlen. Der Ökonom Thomas Piketty hakt bei der Ungleichheit auch innerhalb einzelner Länder ein: Das reichste Zehntel der Weltbevölkerung sorge für etwa die Hälfte aller Emissionen, während die gesamte ärmere Hälfte lediglich zwölf Prozent verantworte. Piketty plädiert für Vermögenssteuern und Umweltabgaben, die den ärmeren Bevölkerungsteilen helfen und die auch die Wohlhabenderen spüren.
Aber wie kommen wir da technisch raus? Da zeige das Buch zu wenige Möglichkeiten auf, wurde schon kritisiert -doch das liegt wohl daran, dass es eben nicht auf die Rettung durch Technik setzt. Sehr wohl finden sich Kapitel zu Geoengineering, erneuerbaren Energien, Recycling. Allerdings mit der Botschaft: Ja, Windkraft und Solarinfrastruktur seien Gamechanger. Ein "nachhaltiges Auto" aber gebe es nicht, und Geoengineering sei Bluff. Stattdessen brauche es vor allem "weniger": weniger Autos, Stromverbrauch, Fleischverzehr, Konsum. Und was soll der Einzelne jetzt tun? Hat es überhaupt einen Sinn, wenn Sie, zum Beispiel, nicht mehr fliegen?
Der nötige Wandel, schreibt Thunberg, "lässt sich auf keinen Fall dadurch erreichen, dass einzelne Personen ihre Lebensweise ändern, einzelne Unternehmen neue Möglichkeiten zur Herstellung von grünem Zement finden oder einzelne Staaten die Steuern erhöhen oder senken". Umgekehrt gehe es auch nicht ohne die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger; unbedingt brauche es Einzelne, die vorangehen. Weniger Neues kaufen, vegan werden: Abgesehen von der (kleinen) Wirkung auf das Klima sei das als eine Form von Aktivismus zu sehen. Als Signal an andere, dass wir uns in einer Krise befinden und uns entsprechend verhalten sollten.
Hilft uns all das? Ja, tut es. Im Verhältnis zum Gewicht der Klimakrise wissen wir immer noch zu wenig, das Buch bereitet die Fakten übersichtlich auf und ist dank der kurzen Kapitel leicht zu lesen. Die Vielzahl an Themen und Autoren bringen den Lesern unterschiedliche Schwerpunkte nahe. Und dass Greta Thunberg motivieren kann, wissen wir sowieso.