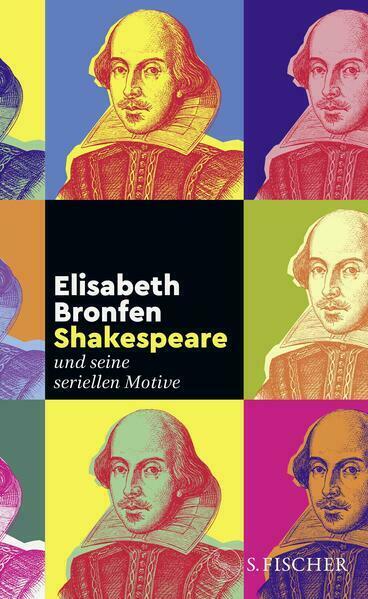Am Ende sind alle tot
Robert Misik in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 34)
Die Zeit ist aus den Fugen“, sagt Hamlet, der Dänenprinz. In diesen Tagen braucht man über die Aktualität der Diagnose keine großen Worte verlieren. Die Ordnung erodiert, an fähigen Anführern fehlt es. Christian Kern, der frühere SPÖ-Kanzler, meinte seinerzeit, was man in der Politik brauche, könne man alles in Shakespeares Königsdramen nachlesen. Zudem wisse man, wie es ausgeht: die Bühne voller Blut, alle Protagonisten tot.
Aufstände werden damit gerechtfertigt, schreibt die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen, dass „nur mit dem Sturz des Königs, der sein Amt missbraucht hat“, Legitimität wiederhergestellt werden kann. Konflikte brechen durch das „Nachwirken vergangener Vertrauensbrüche“ immer wieder auf. Amtsträger verwandeln sich nach der Machtübernahme zum Bösen, vergiftet vom Misstrauen. Geheimnisse werden gehegt und benützt, Intrigen gesponnen.
In allen Stücken Shakespeares steckt unendlich viel Aktualität, die nur unter der Patina freigelegt werden muss. Nun ist das die allgemeine Eigenschaft der „Brand New Classics“ (ein Schwerpunkt der kommenden Wiener Festwochen läuft unter diesem Slogan), aber was Bronfens Buch so speziell macht, ist ihre Lesart. „Shakespeare und seine seriellen Motive“ lautet der Titel. Sie sortiert also die Probleme auseinander, die Muster und dramaturgischen Kniffe, und zeigt, wie sie sich in Shakespeares Stücken wiederholen. Wie aufs Neue angewandt wird, was schon einmal funktioniert hat, wie der Dramatiker die Thematiken immer wieder unter neuen Gesichtspunkten durchkaut. Bronfen spricht sogar von einer „Reifung“.
Was immer wieder auftaucht: Traumbilder, Prophezeiungen und Gespenstergeschichten, toxische Geheimnisse, Unglück, das durch falsche Annahmen ausgelöst wird, Intrige und Leidenschaft. Die Serialität steckt nicht nur in der Wiederkehr der Thematiken, sondern auch in den Cliffhangern, die Shakespeare einbaut. Das Shakespearehafte ist für Netflix und Co perfekt. Man sehe sich nur „Succession“ an, das Drama um einen US-Medienmogul, dessen Kinder vergeblich um sein Vertrauen und die Nachfolge kämpfen.
Die Macht mag seit Shakespeares Zeiten ihre Verkörperungen verändert haben. Nicht mehr Könige, Feldherren, Träger personaler Macht sind heute zentral; sie wabert eher in den Kapillaren der Gesellschaft, hat sich aufgelöst in Strukturen (Michel Foucaults berühmte „Maschen der Macht“). Dennoch sind Shakespeares Fragen so aktuell, als hätte er sie vorgestern begrübelt. Ohnmacht, die mit der Macht einhergeht; unbeabsichtigte Nebenfolgen von Handlungen; die Frage, ob man denn überhaupt handeln kann, sobald man die Nebenfolgen bedenkt. Wer überstürzt handelt, richtet Unheil an, wer besonnen ist, erst recht. König Lear, der jähzornige Alte, regelt seine Nachfolge und setzt das Unheil in Gang, Zauderer Hamlet weiß, dass man gar nicht handeln kann, und wird aktionsunfähig. Der Kompromiss führt zu keinen Lösungen, die Kompromisslosen waten durch ein Meer von Blut.
Unfähige Könige sitzen am Thron, korrupte Hofschranzen und boshafte Berater umschwänzeln sie. Wer würde da nicht sofort an Donald Trump und den Mafiafaschismus um ihn herum denken, an Elon Musk oder J. D. Vance. Ein einmal errungener Frieden kann die Konflikte nur überdecken, alte Verletzungen kochen immer wieder aufs Neue hoch. Kennt man aus der SPÖ.
Die Leidenschaft zieht eine Blutspur, das Fehlen von Leidenschaft mitunter auch, Ehrgeiz, Rach- und Gefallsucht sowieso. All diese Fragen bilden den Korpus von Shakespeares Werk, doch, so Bronfen, „ohne dass für die Konflikte, die die Handlung durchgespielt hat, eine nachhaltige Lösung gefunden worden wäre“. So lebt Shakespeare fort, wird von uns heute „in einem Dialog mit unseren gegenwärtigen kulturellen Anliegen“ gelesen, die Zeit ist aus den Fugen und die Toten liegen auf der Bühne dieser Welt in ihrem Blut