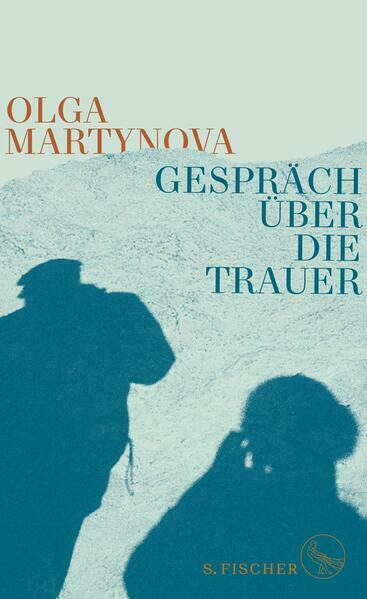In der Zeitanomalie
Ulrich Rüdenauer in FALTER 42/2023 vom 18.10.2023 (S. 42)
Knapp einen Monat nach dem Tod ihres Mannes, des Dichters Oleg Jurjew, der am 5. Juli 2018 starb, beginnt die russische Schriftstellerin Olga Martynova ihr „Gespräch über die Trauer“. Im ersten Eintrag klingt die Verstörung nach; kurz und protokollartig sind die Sätze, als könnte die Betäubung nur durch ein Übermaß an Form und Förmlichkeit überwunden werden: „Angesichts des Todes: Abwesenheit der Gegenwart. Gleichzeitiger Lauf der Vergangenheit und der Zukunft. Dazwischen ein Vakuumkorridor. Eine temporale Anomalie einer Grenzerfahrung.“
Diese Zeilen geben nicht unbedingt den Ton, aber doch die Motive und Themen für die folgenden 300 Seiten vor. Die Grenzerfahrung, außerhalb der Zeit zu stehen, in einer Zeitstarre zu verharren und der unerwiderten Liebe zu einem Toten mit aller Unbedingtheit anzuhängen, eröffnet einen Dialog mit sich selbst und anderen Trauernden. Mit Autorinnen und Autoren, die ihrem Verlust hinterhergeschrieben haben und ihren Schmerz zu Wort kommen lassen wollten, nein: eher mussten.
Zu ihren Gesprächspartnern gehören Julian Barnes und Joan Didion, Roland Barthes und Novalis. Martynova wendet sich mit Elias Canetti gegen die Ungeheuerlichkeit des Todes; Canetti hielt ihn für ein Verbrechen, das man mit allen Mitteln zu bekämpfen habe. „Das Bedürfnis zu wissen, wie andere Trauernde damit umgehen, was man nicht umgehen kann. Ein Grund, warum ich beschloss, all das niederzuschreiben.“
Vor allem aber spricht sie zu Oleg Jurjew, oder er zu ihr. Er erscheint ihr in Träumen. Seine Gedichte ersetzen nicht seine Gegenwart, sie lassen ihn präsent sein. „Ich erinnere mein Leben als wir“, schrieb Jurjew einmal, und die Erinnerung ist für Martynowa nicht nur Vergangenheit, sondern das, was diese Zeitenthobenheit, die den Trauernden befällt und ihn zum Außenstehenden macht, gänzlich anfüllt.
Martynova ist eine genaue Beobachterin noch der kleinsten Regungen im eigenen Innern – aber auch des Verhaltens der sie umgebenden Menschen. Und sie seziert Redewendungen, die berühren oder verstören oder etwas aufrühren. „Jemand schreibt über mich: ‚Olga Martynova hat 2018 ihren Mann verloren.‘ Was für ein Wort. Etwas zu verlieren, ist fast eine aktive Handlung, man war nicht achtsam genug, hat etwas übersehen, nicht aufgepasst. Ich habe dich verloren. Ich war nicht achtsam genug, habe etwas übersehen, nicht aufgepasst.“
Wer trauert, ist mit den Toten verbunden. Noch. Immer noch. Diagnostische Begriffe wie Trauerarbeit oder Trauerzeit sind für den, der die Verbindung nicht abreißen lassen will, eine Anmaßung: die Reaktion einer pragmatisch-weltzugewandten Gesellschaft. Zum Funktionieren gehört, dass der Hinterbliebene mit dem Leid, dem Kummer irgendwann abschließt, auch um andere nicht über Gebühr zu behelligen.
All diese Beobachtungen führen Martynova zu grundlegenden Überlegungen über unseren Umgang mit den Toten. Immer wieder gibt es schneidende Sätze, aphoristische Erkenntnisse oder Eingeständnisse einer Verwirrung, die das Unbegreifliche mit sich bringt. Der Kopf eines Trauernden sei nicht viel klarer als der Kopf eines Verliebten und jedem Quatsch ausgeliefert.
Die Vielschichtigkeit und Reflektiertheit von Martynovas brillant geschriebenem Buch lässt sich hier kaum darstellen: Man müsste auch über ihre vielen Abschweifungen sprechen, ihre assoziativen Verknüpfungen zu St. Petersburg und zum Krieg, ihre Reflexionen zur Antike, zum neapolitanischen Totenkult oder zum Transhumanismus. Es stecken in diesem Trauerbuch mindestens ein Dutzend Essays. Aber noch mehr Zweifel sind darin, Lebensmüdigkeit und Verzweiflung, irritierende und kluge Gedanken, die vor allem bei dem tröstlichen Widerhall finden, der selbst in jener „Zeitanomalie“ der Trauer lebt – wie „unter Drogen“. Für die Trauer gibt es, auch das sagt dieses Buch, keine Regeln und kein Maß.