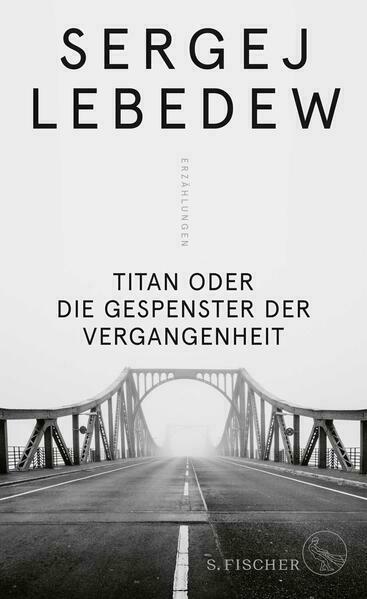Wenn der Geheimdienst zweimal klingelt
Erich Klein in FALTER 42/2023 vom 18.10.2023 (S. 16)
Als die Sowjetunion unterging, war der Schriftsteller Sergej Lebedew gerade einmal zehn. Mysteriöses geschah in jenem Jahr: Ratten, so groß wie Schweine – so ging jedenfalls das Gerücht –, streunten durch die Moskauer U-Bahn, die allmorgens mit schneepfluggleichen Zügen gesäubert wurde. Esoteriker aller Art versetzten die Menschenmassen in Trance, zugleich begann man, offen über die Millionen Opfer des Stalinismus zu sprechen.
Seit seinem Romandebüt „Der Himmel auf ihren Schultern“ (2013) hat Lebedew Russlands totalitäres Vermächtnis und dessen Nachwirkungen bis in die Gegenwart immer wieder zum Gegenstand seiner Romane gemacht, und nicht anders verhält es sich mit seinem jüngsten Buch „Titan oder die Gespenster der Vergangenheit“.
Auch wenn ich damals Kind war, erinnere ich mich an die mystische Stimmung, die auf einmal mit Urgewalt, wie ein Vulkan, überall ausbrach“ hält der Autor in einem knappen Vorwort zu den elf eigenständigen Erzählungen fest, die auf subkutane Weise miteinander verbunden sind. Ihnen gemein ist etwas Gespenstisches: „Die Empfindung des herannahenden Endes einer Epoche erweckt stets das Mystische zum Leben.“ An einem solchen Epochenbruch befindet sich das Land heute abermals.
Die erste, in einer nicht exakt definierten jüngeren Vergangenheit spielende Erzählung „Abend eines Richters“ beginnt prosaisch: „Staus in der Stadt, Staus an der Ausfahrt, Staus auf der Landstraße. Ein roter Schleier von Bremslichtern.“ Dass Richter Scheludkow am Weg zur Datscha von Polizisten aufgehalten wurde, ärgert ihn; nach seiner Beförderung würde ihm das im Dienst-BMW mit Blaulicht nicht mehr passieren. Seine Karriere interessiert ihn mehr als die Rehabilitation der Stalin-Opfer, über die ein Kollege tagsüber gewitzelt hatte: „Und wenn die Toten bei dir vorstellig werden?“
Im Lauf des Abends und der Erzählung wird Scheludkow von einer Kindheitserinnerung eingeholt – im Auftrag seines Vaters hatte er einst Hundewelpen in einem nahen Teich ertränkt. Die synchrone Wiederkehr der eigenen Vergangenheit und jener des ganzen Landes bleibt in merkwürdiger Schwebe.
Dieses flaue Unbehagen setzt sich auch in den anderen Geschichten des Bandes fort. Hinter der Fassade der Normalität haust immer verdrängte Gewalt. Mal nimmt das, wie beim Antiquar Batizki, der dem Geheimnis einer Schatulle aus der Vorrevolutionszeit nachspürt, märchenhaften Charakter an: Im Inneren des ominösen Kästchens öffnet sich ein gewaltiger Raum, und der Altwarenhändler wird vom Antoniusfeuer befallen. In einem ziemlich gewagten narrativen Salto mortale kommt die Mörderband des KGB-Vorläufers NKWD ins Spiel.
Die Erzählung „Das kurze i“ erinnert ein wenig an Borges. Ein gewisser Iwanow sitzt gerade im Zug und hält sich die Ohren zu. Im Auftrag des FSB (der den KGB ablöste) soll er den Abschiedsbrief eines in die Alpen geflüchteten Bankiers fingieren und diesen wohl liquidieren.
Schon als Kind war Iwanow ein begnadeter Imitator, machte zunächst Lenin nach, sprach später auf Bitten der Mädchen mit der Stimme Alain Delons. Seine Parodie des Generalsekretärs hat freilich zur Folge, dass der Geheimdienst ihn erpresst, für ihn zu arbeiten. All das hat wiederum auf mysteriöse Weise mit der Beseitigung des Buchstaben „i“ aus dem russischen Alphabet zu tun und mit Iwanows Tante, die Samisdat-Texte abtippte.
Mit dem Zahnarzt Kossorotow, dem Grabsteinbildhauer Muchin oder dem einfachen Datschennachbarn Kaljuschny, der unter seinem Haus einen Tunnel gräbt, sind dem Autor schillernde Figuren von kafkaesker Abstrusität gelungen. Kaljuschny verwandelt sich sterbend in einen Maulwurf: „Er war abgestürzt in ein fremdes-schon-nicht-mehr-fremdes Gedächtnis.“
Mit seinen zunächst konventionell anmutenden, dann aber ins Irreale kippenden Geschichten entwirft Sergej Lebedew Horrorkabinette, die man so einfach nicht wieder verlässt. Es herrscht der Schrecken der Normalität.