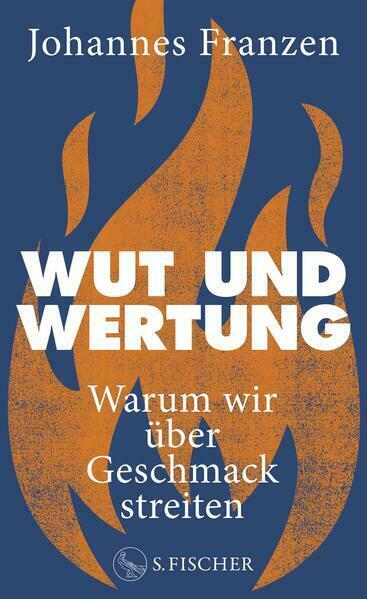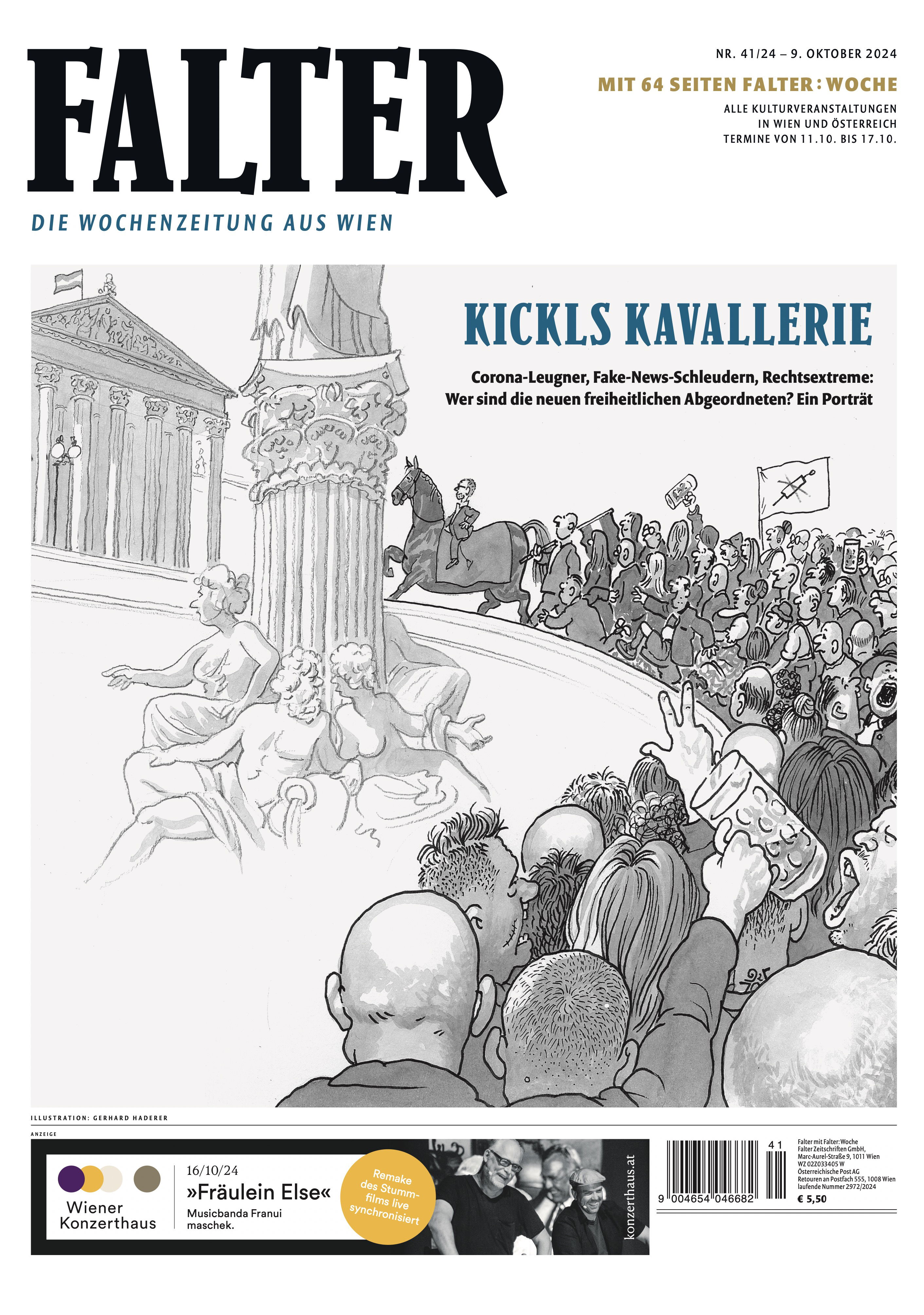
Die Hölle ist der Geschmack der anderen
Klaus Nüchtern in FALTER 41/2024 vom 09.10.2024 (S. 27)
Am 25. Mai 1849 kommt es vor einem Opernhaus in Midtown Manhattan, dem Theaterviertel von New York, zu einem Aufeinandertreffen zweier Menschenmengen. Es beginnt mit Beschimpfungen, mündet aber bald in ein Crescendo der Gewalt, sodass die Stadtregierung sich gezwungen sieht, die Nationalgarde einzusetzen, die prompt das Feuer eröffnet. Die tragische Bilanz: zwei Dutzend Tote und über 100 Verletzte.
Bei der Straßenschlacht, die als "Astor Place Riot" in die Geschichte eingegangen ist, handelte es sich nicht etwa um einen Krieg rivalisierender Banden, sondern um eine erbitterte Auseinandersetzung zwischen Kunstfreunden. Stein des Anstoßes war Shakespeares "Macbeth" beziehungsweise die drängende Frage, wer die Titelpartie der Tragödie auf die einzig wahrhaftige Weise zu gestalten und darzustellen vermag: Edwin Forrest oder William Macready.
Was aufs Erste nach einem Scharmützel zwischen durchgeknallten Theaternarren aussieht, weist bei näherer Betrachtung Facetten auf, die über die Sphäre der Schauspielkunst weit hinausweisen. Dazu muss man wissen, dass Macready, der im Astor Opera House gastierte, Brite, Forrest, der dieselbe Rolle zur gleichen Zeit nur wenige Straßen weiter am Broadway Theatre gab, hingegen Amerikaner war.
Während Shakespeares Landsmann einen distinguierten und zurückgenommenen Stil verkörperte und als Darling der Aristokratie galt, erfreute sich Forrests viriler Expressionismus in den unterbürgerlichen Schichten großer Beliebtheit. Kurz und gut: Die Theaterschlacht war auch ein Klassenkampf. Mit gutem Grund hat der Germanist und Kulturjournalist Johannes Franzen die blutige Episode an den Beginn seines soeben erschienenen Buches "Wut und Wertung" gestellt. In ihr manifestiert sich exemplarisch, welch gewaltige und gewalttätige Gefühle ästhetische Vorlieben auslösen können. Das gilt, wie der Autor zeigt, natürlich nicht nur fürs Theater, sondern für sämtliche Kunstgattungen, schließt TV-Serien ebenso ein wie Videospiele und reicht von der Shakespeare-Schlacht des 19. über die zahlreichen Kunstskandale des 20. bis zur Cancel-Culture des 21. Jahrhunderts. Der Untertitel von Franzens Buch leitet sich von der Forschungsfrage ab, die sich der Autor gestellt hat: "Warum wir über Geschmack streiten." Denn dass gestritten wird, ist unbestreitbar, auch wenn das bekannte lateinische Sprichwort "De gustibus non est disputandum" das Gegenteil behauptet.
Johannes Franzen nun hat es sich zur Aufgabe gemacht, die libidinösen Quellen zu erkunden, aus denen sich der Streit um den Geschmack speist. So wüst wie beim historischen Astor Place Riot geht es zum Glück nicht zu, aber auch die Gegenwart kennt ihre "Fan-Armys", die zumindest symbolisch und verbal übergriffig werden.
Sogar die selbstergriffenen Schneeflöckchenschwadronen der Swifties unterbrechen dann mitunter ihr Freundschaftsarmbandgeknüpfe und mutieren zu aggressiven Bullies, sobald jemand auch nur ein skeptisches Wort über das Objekt ihrer Verehrung verliert. Als der US-Journalist Chris Parnella Taylor Swifts Konzertfilm "The Eras Tour" zwar wertschätzend besprach, aber nicht damit hinterm Berg hielt, dass ihm "Renaissance" von Swifts Kollegin Beyoncé noch besser gefallen hatte, langten Morddrohungen auf seiner Mailbox ein.
Ganz offensichtlich verfügen Geschmacksfragen über einen unlöschbaren emotionalen Glutkern und können daher nur schwer im Modus rationaler Distanziertheit erörtert und verhandelt werden. Johannes Franzen begründet das überzeugend damit, "dass es sich bei unserem Geschmack um eine Selbsterzählung handelt, die einen zutiefst persönlichen Anspruch mit einer sozialen Identität verbindet, die vor dem Publikum einer (Teil-)Öffentlichkeit inszeniert wird. Geschmack bildet gleichzeitig einen Schutzraum des Privaten und eine Bühne der Selbstdarstellung."
So gesehen wäre eine ästhetische Passion, die man ganz für sich behält, gar kein Geschmack; dazu wird sie erst, indem sie öffentlich artikuliert und damit selbst zum Gegenstand von Zustimmung oder Ablehnung wird.
Dieser Double Bind ist der Grund, warum der Streit um Geschmack ein dermaßen hohes Verletzungspotenzial bereithält. Über den Häuptern all jener, die sich darauf einlassen, schwebt das Damoklesschwert einer doppelten Kränkung: Wer meinen Geschmack infrage stellt, zweifelt nämlich nicht nur meine ästhetische, sondern auch meine libidinöse Kompetenz an. Der Vorwurf, sich in die/den Falsche/n verliebt zu haben, aber ist äußerst ernüchternd, ja mitunter geradezu beschämend.
Man kann auf einen solchen Einwand mit einer oft schmerzhaften ästhetischen Selbstrevision reagieren und sich etwa eingestehen, dass Tom Waits vielleicht doch bloß Kitsch ist (siehe Fragebogen auf Seite 27). Oder man kann ihn nostalgisch abwehren, indem man die Unschuld der eigenen kindlichen Rezeption beteuert: "Ich habe beim Tod Winnetous geweint! Was kann das mit kultureller Aneignung oder gar rassistischen Stereotypen zu tun haben?!"
Die Retromanie der Gegenwart wirft ständig Altbekanntes in Form von Special Editions und Director's Cuts auf den Markt. Ausgerechnet sie aber führt Franzen zufolge auch dazu, dass Kunst, Comics oder Kinderbücher einer permanenten politischen Überprüfung und weltanschaulichen Neubewertung ausgesetzt werden. Und das sorgt seit geraumer Zeit für gesamtgesellschaftlichen Unmut mit hohem Triggerpotenzial.
Das Konzept der Triggerpunkte wurde von den Sozialwissenschaftlern Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westenheuser in ihrem gleichnamigen, im Vorjahr veröffentlichten Buch entwickelt. Darin widersprechen sie dem "Masternarrativ" einer hochgradig polarisierten Gesellschaft, wie es sich nicht zuletzt infolge der Pandemie etabliert hat, widmen sich aber auch der Frage, warum es "inflammatorische Detailfragen gibt, an denen ein ansonsten vorhandener Grundkonsens zerbricht".
Zu den Reizthemen zählt neben Tempolimits oder Gendersternchen, die von den Autoren aufgeführt werden, gewiss auch die sogenannte "Cancel-Culture", der eines der spannendsten Kapitel in Franzens Buch gewidmet ist. Als Beispiel dient ihm unter anderem das Gemälde "Thérèse, träumend" des französischen Malers Balthus aus dem Jahr 1938. Es zeigt ein etwa zwölfjähriges Mädchen, das mit geschlossenen Augen und gespreizten Schenkeln so auf einem Stuhl ruht, dass man seinen Slip sehen kann.
Als das Bild 80 Jahre nach seiner Entstehung im Metropolitan Museum of Art in New York gezeigt wird, unterzeichnen rund 10.000 Menschen eine Onlinepetition, in der die Abhängung des Gemäldes gefordert wird. Wie es die Dramaturgie von Kunstskandalen vorsieht, weist die opponierende Fraktion das Ansinnen im Namen der Kunstfreiheit zurück, ja der Kritiker Jonathan Jones identifiziert selbiges gar als die "Arbeit von Faschisten".
Es ist ein klassischer Triggerpunkt, der eine Eskalation der Erregung in Gang setzt. Die moralische Empörung der einen wird von der Gegenseite um nichts weniger empört zurückgewiesen und als "Ausdruck einer kunstfeindlichen Haltung" entlarvt, denn: "Wer seine moralische Wut über ästhetische Erfahrungen nicht sublimieren oder intellektualisieren kann, der ist auf dem halben Wege, sie zu zensieren."
Die hier bemühte Argumentation beruht in Franzens Analyse auf dem sogenannten "modernen Kunstparadigma". Grob gesprochen handelt es sich dabei um unsere gute alte "Hochkultur". Verstanden wird diese als autonomer Bereich mit Sonderstatus und eigenen Regeln, in dem ausschließlich ästhetische Kriterien Geltung besitzen, weswegen moralische Urteile als unangemessen zurückzuweisen sind.
Schlüssig ist das freilich nicht. Denn gerade transgressive, also bewusst auf den Tabubruch zielende Kunst ist nie "rein ästhetisch", sondern operiert ganz gezielt mit einer Lockerung und Aufhebung von Moralvorstellungen, deren Verletzung in einem anderem Kontext geahndet werden würde.
Wenn sich die Apologeten des Kunstparadigmas im Falle von Andres Serranos "Piss Christ" über die sehr voraussehbare Erregung angesichts dieser Fotografie, die ein im Urin des Künstlers schwimmendes Plastikkruzifix zeigt, ihrerseits echauffieren, gehöre das, so Franzen, "zum Spiel der strategischen Unehrlichkeit transgressiver Kunst, die der Öffentlichkeit weismachen möchte, dem Künstler und seinen Advokaten sei nicht klar gewesen, dass sein Werk eine erbitterte Kontroverse zur Folge haben würde".
Es ist überhaupt eine nicht geringzuschätzende Tugend des Autors, dass er in seinem ebenso luziden wie materialreichen Buch den "Polarisierungsunternehmern" (Steffen Mau) den Wind aus den Segeln nimmt, die Dynamik von Empörung und Gegenempörung einer kühlen Analyse unterzieht und die tatsächlichen Hegemonie-und Machtverhältnisse im Blick behält.
Als eine Gruppe von Studierenden im Jahr 2016 die Entfernung von Eugen Gomringers als sexistisch empfundenem Gedicht "ciudad (avenidas)" von der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin forderte, fegte ein Sturm der Entrüstung durchs Feuilleton, und der renommierte Schriftsteller und Ehrenpräsident des PEN, Christoph Hein, geißelte den "barbarischen Schwachsinn" der ungebildeten "Kulturstürmer".
Dabei hatten die dermaßen Herabgesetzten ihr Protestschreiben in einem recht zurückhaltenden Ton verfasst und ihr Anliegen klar argumentiert. Gefordert wurde lediglich die Entfernung des Gedichtes an einem bestimmten, als männlich dominiert erlebten Ort, an dem man die bewundernden Blicke auf Frauen auch nicht noch öffentlich lyrisch verklärt wissen wollte. Niemand hatte danach gerufen, die Werke Gomringers aus den Buchhandlungen und Bibliotheken oder dessen Gedichte von irgendeinem Lehrplan zu entfernen.
Der Vorwurf der "Zensur", der gleichwohl erhoben wurde, ging also ins Leere, weswegen Franzen auch den Begriff "Phantomzensur" bemüht und darüber hinaus darauf hinweist, dass Zensur "ein Vorrecht der Macht darstellt, und zwar der konkreten Macht, wie sie sich in staatlichen Institutionen oder etablierten Medien konzentriert". Jenen Medien also, welche die Verfasser des Protestschreibens ansatzlos als zensurgeile Kulturbanausen enttarnt hatten.
Überhaupt stellt Franzen in "Wut und Wertung" kursierende Narrative des kulturellen Niedergangs infrage, denen die durch Internet und Social Media ermöglichte Emanzipation des Publikums nicht geheuer ist. Passive Konsumenten werden auf einmal zu Diskursteilnehmern, die Sterne vergeben, Rezensionen verfassen oder gar Fan-Fiction schreiben und auf diese Weise die Gatekeeper-Funktion professioneller Kritiker ebenso unterlaufen wie die letztinstanzliche Autorität von Autoren über das eigene Werk.
Die Rapper Drake und Kendrick Lamar trugen heuer einen heftigen Streit - in der Genresprache "Beef" genannt -öffentlich und multimedial aus; der Konflikt zog einen ganzen Rattenschwanz an Kommentaren, Exegesen, Memes und Artefakten aus den Fan-Kohorten beider Lager nach sich. Franzen zieht daraus folgenden Schluss: "Die Fandoms erscheinen hier nicht als emotionalisierter Mob ästhetischer Hooligans, der über die Fans einer anderen Musik unkontrolliert herfällt, sondern als interpretationsgierige Gelehrtenrepublik."
Die Lektüre von "Wut und Wertung" stellt ein erkenntnisreiches und unterhaltsames Angebot dar, die "wintrige Melancholie" zu verscheuchen, die sich laut Franzen in den offiziellen Kunstdiskurs im Feuilleton und an den Universitäten eingeschlichen hat. Die letztgültige Sentenz zum Zusammenhang zwischen Wut und Wertung aber lieferte der schottische Musiker Momus mit einer Paraphrase Jean-Paul Sartres: "Die Hölle ist der Geschmack der anderen."