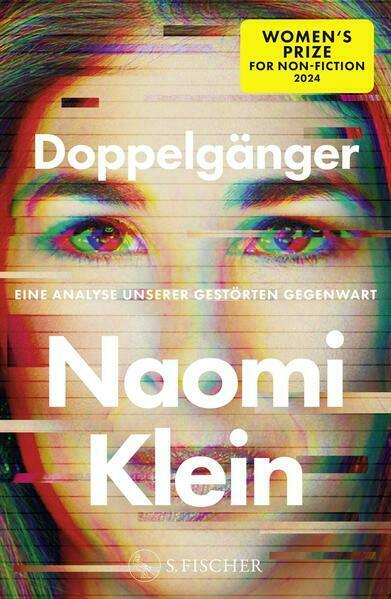Naomi und ich
Lina Paulitsch in FALTER 43/2024 vom 23.10.2024 (S. 31)
Durch die dünne Wand einer Toilette hört Naomi Klein zum ersten Mal von ihrer Doppelgängerin. Zwei junge Frauen lästern: "Hast du mitbekommen, was Naomi Klein schon wieder gesagt hat?" Draußen auf der Straße protestiert die "Occupy Wall Street"-Bewegung, bei der verschiedene Redner auftreten. Klein tritt aus der Kabine und sagt: "Ich glaube, ihr meint Naomi Wolf."
Fast unschuldig wirkt diese analoge Szene aus dem Jahr 2011. Denn später geht in den sozialen Medien die Verwirrung um die Naomis erst richtig los. In der Internetcommunity entstehen Running Gags, und bei Klein trudeln Likes und Hass ein -für Aussagen, die gar nicht von ihr stammen.
Diese Verwechslungskomödie ist der Ausgangspunkt für Kleins neues Buch "Doppelgänger". Zwei Naomis, beide jüdisch, braunhaarig und prononciert linke Denkerinnen. So weit, so gleich. Doch während der Covid-19-Pandemie biegt die zweite Naomi ab -und wird zur prominenten Verschwörungstheoretikerin. Auf 450 Seiten taucht Klein ins Denken ihrer Doppelgängerin ein. Die zweite Naomi -sie steht exemplarisch für eine virtuelle Parallelwelt, deren Auswirkungen in den letzten Jahren immer realer wurden.
Die Kanadierin Klein, Jg. 1970, wurde mit ihrem globalisierungskritischen Buch "No Logo" weltberühmt, später avancierte sie zur bekannten Klimaaktivistin. Naomi Wolf, acht Jahre älter als Klein, war ihr einst ein Vorbild. Der Bestseller "Mythos Schönheit" machte Wolf in den 1990ern zur gefragten Feministin, der demokratische US-Präsident Bill Clinton zog sie gar als Beraterin hinzu. Als Studentin interviewte die jüngere Naomi die ältere - und fühlte sich verstanden.
"Sucht ist wahrscheinlich der relevanteste Aspekt, wenn man diese beunruhigende Persönlichkeitsveränderung verstehen will", schreibt Klein. Minutiös schildert sie, wie Wolf erst zu Zuspitzungen neigt, sich dann von wissenschaftlichen Fakten distanziert und zu fantasieren beginnt. Schließlich posiert die feministische Vordenkerin mit Sturmgewehr, vergleicht digitale Impfpässe mit dem Holocaust und warnt vor ausbleibender Menstruation bei Frauen, die sich in der Nähe von Geimpften aufhalten.
Auf Social Media wird Naomi Wolf zum Star. Sie geriert sich als Kassandra, als linke Prophetin unter Rechten. Wenn sie bei Trump-Berater Steve Bannon im TV sitzt oder mit dem Ex-Fox-News-Moderator Tucker Carlson scherzt, fühlt sie sich erhaben. Wolf verlässt ihr Milieu -und genießt ihren Sonderstatus unter Fremden.
Doch die Autorin schasselt Wolf nicht bloß als Verwirrte ab. Sie rechnet mit der Linken ab, die pikante Themen ignorierte. Der Grat zwischen berechtigter Kritik an Machtstrukturen und Verschwörungserzählung sei schmal, so Klein. Die doppelte Naomi übernahm Kleins Themen und besetzte sie neu. Etwa das latente Unbehagen gegenüber digitalen Megakonzernen, die persönliche Daten zu Geld machen und uns überwachen. In Wolfs Parallelwelt ist aber nicht Facebook schuld, sondern eine Impfpass-App.
Es sei die große Kunst des Verschwörungsmythos, an reale Ängste anzudocken, deren Ursache aber falsch herzuleiten. Selbstkritisch gesteht Klein, die Covid-19-Maßnahmen der US-Regierung nicht gründlich genug hinterfragt zu haben. So sei erst der Nährboden entstanden, auf dem Begriffe wie "Holocaust" und "Faschismus" ihre historische Bedeutung verloren und zur Farce werden konnten.
Ein Doppelgänger, schreibt Klein, sei so etwas wie der böse Zwilling. Er verkörpert die seltsamen Allianzen, die sich pandemiebedingt offenbarten: Wellness-Gurus mit Eugenikern, Rechts-mit Eso-Extremisten. Influencer schlüpfen in die Rolle von Journalisten, imitieren stilistische Konventionen, "setzen sich aber über Grundregeln der journalistischen Genauigkeit hinweg".
Im virtuellen Raum haben die meisten Menschen einen Doppelgänger, den sie sich selbst erschaffen haben. Jedes Profil auf LinkedIn oder Instagram ist ein Avatar des eigenen Selbst: "Wir füttern Konzerne zur Erschaffung von Doppelgängern." Doch es ist ein Selbst, das profitabel sein will, das sich den Regeln des Marktes unterwirft. Ein kapitalistischer Doppelgänger, dem Fakten und Realität herzlich egal sind. Man denke an Fake-Titel und Fake-Expertise.
Später betritt Klein heikles Terrain und legt ihre These auf den Nahostkonflikt um. Die Palästinenser seien eine Art Anti-Ich der Juden in Israel. Sie würden spiegeln, was sie einst selbst für die Christen waren. Als wäre es selbstverständlich, bezeichnet Klein die jüdischen Siedler als Kolonisatoren und den israelischen "Kolonialismus als Wiedergutmachung für den Völkermord".
Das ist harter Tobak, den Klein insofern rettet, als sie dafür plädiert, sich vom binären Doppelgänger-Denken zu verabschieden. Der einfache Gegensatz von Kolonisatoren und Kolonisierten gelte in Israel nicht, es sei das "Produkt der Logik der Welt, in der wir leben und die in Flammen steht".
Weniger Ich-Bezogenheit, mehr Verbundenheit und Verwandtschaft, so Kleins Conclusio. Ihre ideale Welt ist justament das Rote Wien der Zwischenkriegszeit. Damals, als den Kranken und Armen Paläste gebaut wurden und in den Höfen gemeinsam gespielt wurde. Weniger Tech, mehr Stadt: Was hierzulande nach banaler Nostalgie klingt, ist der feuchte Traum der amerikanischen Linken.
Mit "Doppelgänger" hat Naomi Klein in exzellenter Weise die Wirrnisse der Gegenwart in Buchform gegossen. Sie liefert die Lektüre schlechthin zum postfaktischen Zeitalter -in der das andere Ich giert und regiert.