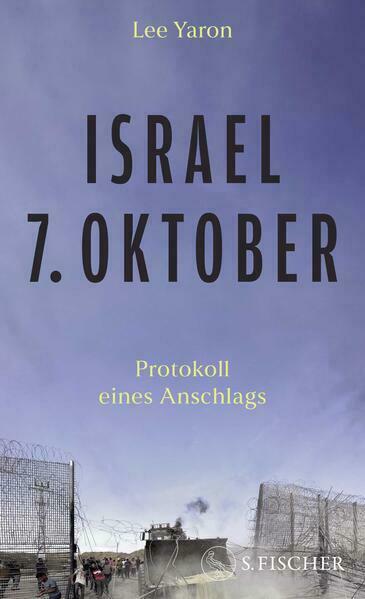Der 7. Oktober als Teil der Tradition der Gedenkbücher
Tessa Szyszkowitz in FALTER 40/2024 vom 02.10.2024 (S. 31)
Wie sitzt man Schiwa, die im Judentum gebräuchliche Trauerwoche, wenn es keinen Leichnam gibt? Wenn jemand Sohn, Tochter, Mutter und Ehemann verloren hat, sitzt man dann für alle zusammen sieben Tage Trauer oder sieben Tage für jeden hintereinander? Diese und viele andere Fragen stellt Lee Yaron in ihrem Buch "Israel, 7. Oktober", für das sie mit den Überlebenden des Hamas-Massakers vor bald einem Jahr gesprochen hat.
Die Journalistin, die zehn Jahre für die linksliberale Tageszeitung Ha'aretz investigative Reportagen über Korruption und Armut veröffentlichte, schreibt in der Einleitung zu ihrem dokumentarischen Buch: "Ich bin Tochter und Enkelin von Flüchtlingen und Überlebenden des Holocausts. Ich bin Jüdin. Ich bin Israelin. Und ich bin eine Frau, Feministin, Journalistin und gehöre aus tiefer Überzeugung zu jener Seite, die sich für die Rechte aller Völker zwischen Jordan und Mittelmeer einsetzt, jener Seite, die noch immer den Traum von zwei Staaten für zwei Völker träumt, die Juden und Arabern, Israelis und Palästinensern gleichermaßen Demokratie und Menschenrechte garantieren."
Schüsse im Morgengrauen Nach diesem Bekenntnis wendet sie sich dem größten Massaker an Juden und Jüdinnen seit dem Holocaust zu: dem 7. Oktober. Das Protokoll des Grauens beginnt in Sderot, einer israelischen Stadt direkt vor dem Gazastreifen. In den Morgenstunden übernahm dort die Hamas die Kontrolle der Polizeistation und fuhr mit weißen Lieferwagen durch die Straßen, aus denen sie wahllos Zivilpersonen erschoss. Dolev, Odia, Romi, Lia -vier Namen, vier Schicksale. Autorin Yaron hat mit den überlebenden Familienmitgliedern gesprochen, sie hat das Bildmaterial studiert: "Die Terroristen fuhren weiter, während Dolev blutend auf dem Gehweg lag, Lia noch immer in seinen Armen. Dolev schrie Lia zu, sie solle zurück zu ihrer Mutter laufen. Das dreijährige Mädchen, im weißen Kleid und barfuß, blieb noch fünfundzwanzig Sekunden bei seinem Vater, bevor es seiner Anweisung folgte." Die Eltern wurden erschossen. Nur die zwei Töchter überlebten.
Lee Yaron beschreibt, wie innerhalb weniger Stunden das Leben so vieler Menschen und ihrer Familien zerstört wurde. Jüdische Israelis; russisch-jüdische Einwanderer aus Charkiw, die vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine geflohen sind; Beduinen aus Israel, die im Kugelhagel der Hamas getötet wurden. Die Vergewaltigten, die Toten vom Rave, vom Kibbutz Be'eri, sie werden Teil dieser tragischen Erzählung. Jede einzelne Biografie, die von Paris in den Kibbutz Nahal Oz führt, aus Odessa nach Eilat, aus Kathmandu nach Gaza, bringt die Tragödie schonungslos ins Bewusstsein.
Besonders eindringlich die Geschichte von Sabine Taasa aus dem Dorf Netiv HaAsara unweit des Gazastreifens. Sie hatte im Juni 2023 vor dem Finanzausschuss des israelischen Parlaments gesprochen und mehr Unterstützung für Sicherheitsmaßnahmen gefordert. Nichts passierte. Einer ihrer vier Söhne und ihr Mann wurden von der Hamas erschossen.
Die Tradition der Yizkor-Bücher
Gedenkbücher gibt es in der jüdischen Geschichte schon lange. Lee Yarons "Israel, 7. Oktober" ist ein solches Yizkor-Buch. "Die jüdische Zeitrechnung gleicht einer Schriftrolle, die jedes Jahr neu aufgerollt und dann wieder zusammengerollt wird", schreibt Joshua Cohen im Nachwort. Der Pulitzer-Preisträger und Schriftsteller ist auch der Ehemann der Autorin. Begreift man den 7. Oktober in modernen und faktischen Begriffen, dann kann untersucht werden, wo Israel versagt hat und wie politische Lösungen gefunden werden können.
Wenn der 7. Oktober aber "nur als die neueste Wiederholung der uralten Geschichte jüdischen Leidens betrachtet wird - wie Israels Premier Benjamin Netanjahu es mit der Erwähnung des Überfalls des Volkes Amalek auf die Juden in der Bibel getan hat -, dann erfüllt Israel das Schicksal, das eigentlich vermieden werden sollte: "Der Auftrag Israels bestand darin, die Juden aus der Opferrolle zu befreien, nicht, sie weiter und immer wieder hineinzutreiben." Cohens Hoffnung ist, dass Leserinnen und Leser nach der Lektüre nicht Rache, sondern Frieden fordern.