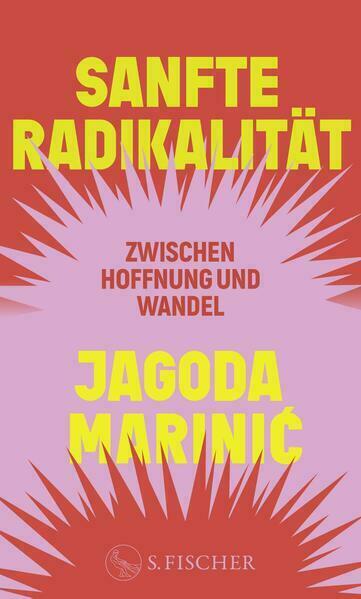"Ich will nicht in der Wut stecken bleiben"
Lina Paulitsch in FALTER 44/2024 vom 30.10.2024 (S. 22)
Sie ist Podcasterin, Kolumnistin, Autorin und Kulturmanagerin - und gilt in ihrer Heimat Deutschland als prominente Fürsprecherin einer diversen Gesellschaft. Jagoda Marinić hat nun das Buch "Sanfte Radikalität" geschrieben, in dem sie den Diskurs um Minderheitenrechte kritisiert. Mit dem Falter sprach sie über progressiven Aktivismus, Realpolitik und Sprache.
Falter: Der US-Wahlkampf findet auch auf Social Media statt. Elon Musk, der neue Inhaber von X, früher Twitter, unterstützt Donald Trump und hat Richtlinien zugunsten rechtsextremer Trolle geändert. Sie selbst sind auf X sehr bekannt. Wollen Sie überhaupt noch auf der Plattform bleiben? Jagoda Marinić: Es ist ein Dilemma. Aber ich weiß, wenn ich da rausgehe, verschwindet X ja nicht. Es werden andere Personen die Möglichkeit weiterhin nutzen, Bürgerinnen und Bürger zu informieren und zu desinformieren. Mein Weg ist, konstruktive Inhalte reinzubringen. Ich habe Tweets, die eine halbe Million Menschen erreichen, das aufzugeben scheint mir falsch.
Erleben Sie Hass?
Marinić: Neulich hatte ich unter einem Kommentar 1600 Anfeindungen. Die sind in der gleichen Tonalität wie bei Kamala Harris -es geht immer auch gegen mich als Frau, gegen mich als jemanden, der eine liberalere, vielfältigere Gesellschaft möchte. Die Postings sind oft sexualisierte Gewalt. Vor kurzem bekam ich ein Bild, wie jemand angeblich im Zug über meinem Buch onaniert. Diese Dinge muss man aushalten - und die EU stärker eingreifen.
Ihr Buch heißt "Sanfte Radikalität". Sanftheit ist oft eine weibliche Zuschreibung. War das Absicht?
Marinić: Nein. Ich meine das Humane, Menschliche. Radikalität ist eine Forderung von emanzipatorischen Bewegungen der letzten Jahre. Je wütender, radikaler, desto höher die Glaubwürdigkeit. Credibility kam mit der Wut. Dem setze ich das Sanfte gegenüber. Wenn wir so überzeugt sind von der eigenen Position, dass wir sie am Ende nicht mehr diskutieren, sondern den anderen nur belehren wollen, dann entsteht eine Verhärtung, die uns in Diskussionen nicht mehr voranbringt.
Die US-Republikaner sprechen von einem vermeintlichen Kulturkampf zwischen Woken und Konservativen. Wokeness, heißt es oft, werde als politisches Argument verwendet, um die Linke zu diffamieren. Haben die Republikaner also doch einen Punkt?
Marinić: Ich beobachte, wie Rechtsaußen-Kräfte die Diskussionen zugunsten von Minderheiten instrumentalisieren konnten, um Menschen zu mobilisieren mit dem Argument: "Schau doch mal, das autoritäre Modell ist viel interessanter als linke Bewegungen". Mein Buch versucht zu analysieren, woran das liegen könnte. Und zwar nicht nur zu behaupten, die Rechten seien so böse und das stimme alles gar nicht. Sondern ehrlich zu fragen: Wo liegen tatsächlich Fehler im Denken und Handeln von emanzipatorischen Bewegungen?
Worin bestehen diese Fehler?
Marinić: Viele Linke und Aktivisten fingen untereinander an, ihre Perspektiven so weit auszudifferenzieren, dass eine unübersichtliche Lagerbildung stattfand. Man hat dann eben nicht mehr nur Feministinnen vor sich, sondern man hat jene Feministinnen, die gendern, intersektionale Feministinnen, binärdenkende Feministinnen. Der Israel-Palästina-Konflikt hat dann schließlich noch verdeutlicht, was die letzten Jahre unterschwellig Thema war.
Nämlich? Marinić: Die Frage nach der einen großen Erzählung: Wer hat das Anrecht auf Minderheitendiskurse und wer nicht? David Baddiel hat dazu das wichtige Buch geschrieben "Jews don't count" - Jüdinnen und Juden zählen nicht. In manchen postkolonialen Lesarten gelten Menschen weißer Haut nicht als Opfer von Rassismus. Das illustriert ein Skandal um Whoopi Goldberg, die im Fernsehen sagte, Nazis gegen Juden, das sei ja ein Kampf von Weißen gegen Weiße. Wenn man den Rassismus-und Antidiskriminierungsdiskurs allein entlang der Hautfarbe führt, führt das - was die europäischen Rassismen angeht - natürlich zu Defiziten. Und das zeigt sich in der deutschsprachigen Debatte seit dem 7. Oktober.
Warum wird der Diskurs auch bei uns entlang der Hautfarbe geführt?
Marinić: Weil der deutschsprachige Aktivismus das Werkzeug und Wording aus den USA einfach übersetzt. Aber das funktioniert nicht so einfach. In Deutschland und Österreich sind Millionen von Gastarbeitern eingewandert -Italiener, Griechen, Türken, Ex-Jugoslawen. Macht es Sinn, diese Menschen in Schablonen und eine Begrifflichkeit zu packen, die sie selber gar nicht verstehen würden? Also erklären Sie mal meinen kroatischen Eltern, warum sie jetzt PoC, eine "Person of Color", sind. Das ist ein Diskurs, bei dem sie sich gar nicht mehr angesprochen fühlen und das von Menschen, die sagen, die Sprecherposition der Betroffenen zählt.
Sie sprechen in diesem Zusammenhang auch von "Reverse Othering". Was heißt das?
Marinić: Ich meine damit die deprimierende Entwicklung, dass Minderheiten im Kampf um Sichtbarkeit auf diese Art letztlich selbst das werden, was sie eigentlich bekämpfen. Ich bin zum Beispiel das Kind von Einwanderern, aber eben auch Schriftstellerin, Kolumnistin, Kulturmanagerin. Der Kampf, anderen die Ungerechtigkeiten deutlich zu machen, führt oft dazu, dass man sich am Ende sogar selbst nur mehr als Tochter von Einwanderern bezeichnet und die restlichen Dinge an sich ausklammert. Und jede strukturelle Diskriminierung, jede Barriere bestätigt dann meine eine Opferidentität.
Ihre Eltern kamen aus Kroatien nach Deutschland. Prägt das Ihre Identität?
Marinić: Sicher. Meine Identität beginnt mit Hybridität. Ich war von Anfang an Teil der heutigen Ex-Yu-Community und der deutschen Gesellschaft, später dann auch viel in den USA und Spanien. Die Normalität meiner Erlebniswelt war immer geprägt von Menschen, die eingewandert sind. Als Schriftstellerin will ich diese Menschen natürlich auch in meinen Erzählungen sehen, nicht sagen, ich bin von hier und Punkt. Was fiele da alles weg? Ich habe etwa sehr spät erfahren, wie die ganze Generation meiner Eltern, als sie nach Deutschland kam, auf ihre Gesundheit hin untersucht worden sind, vor oder hinter den Grenzen - so wie in Ellis Island, der Sammelstelle für Migranten, bevor sie in die USA einreisen konnten. Ich habe daraufhin in Archiven Fotos von türkischen Gastarbeitern gefunden, die in Unterhosen zu zehnt nebeneinander vor einem deutschen Arzt standen. Das waren unnötig entwürdigende Vorgänge des Aufnahmelandes. So ist der Diskurs bis heute: Viele erwarten, sie sollten sich einfügen. Es wird über sie geredet und nicht mit ihnen. Da wäre Wut naheliegend, und doch geht es mir in meinem Buch um den nächsten Schritt: Ich will nicht in der Wut stecken bleiben, die diese Identität unter Umständen mit sich bringt -und in der man es sich auch gut einrichten kann.
Ihr Buch ist auch ein Lösungsvorschlag, den sie an einem eigenen Projekt formulieren: das Haus der Kulturen in Heidelberg, das Sie gegründet und geleitet haben. Erklären Sie uns, was das ist.
Marinić: Das Interkulturelle Zentrum ist inzwischen eine städtische, kommunale Einrichtung, die gemeinsam mit der Zuwanderungsbehörde Teil des International Welcome Centers der Stadt Heidelberg ist. Das heißt eine kommunale Einrichtung in städtischer Hand, die Einwanderung und Interkulturalität zum Thema hat. Ein altes Fabrikgelände wurde dafür renoviert und bereitgestellt. Heute haben dort 100 NGOs eine Anlaufstelle und es gibt interkulturelle Veranstaltungen. Man muss eine Gegenwart schaffen, die einen aus der Nostalgie rausbringt. Deshalb ist das Haus im Kleinen in dem Buch eine Metapher für den großen Diskurs.
Wie meinen Sie das?
Marinić: Anfangs, beim Aufbau des Projekts, habe ich alles durch die Brille meiner Minderheitenidentität gesehen. Nach dem Motto: Klar, die Stadt will kein ernstzunehmendes, großes Projekt der Einwanderungsgesellschaft. Nach zwei Jahren habe ich so viele andere Initiativen kennen gelernt, die sich nicht gewollt fühlten, sich exkludiert fühlten -selbst ein deutscher Gesangsverein. Ich fing an, das Projekt nicht als Minderheitenthema, sondern als Ressourcenproblem zu betrachten. Es ist eine demokratische Struktur und es gibt nur begrenzt Steuergelder. Also muss ich eine Ansprache finden, die so viele Menschen wie möglich von der Notwendigkeit überzeugt, die Einwanderungsgesellschaft konstruktiv zu gestalten.
Apropos Demokratie: In Österreich fanden soeben Wahlen statt, die zugunsten der Rechtspopulisten ausgegangen sind. Zum ersten Mal wurde die FPÖ stärkste Kraft. Wie hängt das mit der identitätspolitischen Verhärtung zusammen?
Marinić: Identität ist dort der Traum von Homogenität. Diese vielfältigen Einwanderungsgesellschaften in Europa, in denen immer Wandel stattfand, sollen nun schon immer homogene, nationale Einheiten gewesen sein. So mobilisieren Rechtspopulisten Bürger. Der große Fehler der Linken war, die letzten zehn Jahre keine Lösungen anzubieten, sondern mit sich selbst beschäftigt zu sein. Der Bedarf an Einwanderern - im Gesundheitswesen, im Bildungssystem - wäre eine Lösungserzählung, doch durchgesetzt hat sich das Angstszenario.
Allerdings gibt es eine Art antiidentitätspolitische Buchmania. In den letzten fünf Jahren kritisierten zahlreiche Autoren Wokeness und Sprachreglementierungen.
Marinić: Ja, zum Beispiel Yascha Mounk, bei dem ich das Gefühl hatte, der pfeffert die ganze Debatte einfach an die Wand. Mein Wunsch ist hingegen, emanzipatorische Ideen nicht aufzugeben, sondern von innen heraus zu fragen: Haben wir nicht noch bessere Ideen für demokratische Ziele? Der Aktivismus von heute geht lieber auf die Straße, dann kann man schöne Bilder auf Instagram posten. Aber in einer Verwaltungskonferenz zu sitzen, ist nicht sehr glamourös.
Ein Schauplatz der identitätspolitischen Diskurse sind nicht nur soziale Medien, sondern auch der Kulturbetrieb.
Marinić: Der Kultur-und Literaturbetrieb will Vielfalt, meint es aber oft nicht ganz so ernst mit ihr. Man pickt sich einzelne Themen heraus, die zum Feigenblatt für die eigene Weltoffenheit werden. Momentan interessiert sich die Kulturszene mehr für postkoloniale Thesen als etwa für den Rassismus gegen die erste Gastarbeitergeneration. Insgesamt ziert man sich gerne mit Toleranz für Wütende aus den emanzipatorischen Bewegungen. Ich wurde zum Beispiel immer eingeladen, um die wütende Einwanderertochter zu spielen. Dann klopfte man sich auf die Schulter, jetzt den Einwanderern mal die Bühne gegeben zu haben. Die Kultureinrichtungen selbst bleiben aber homogen. Nach dem Motto: Wir sind alle so links, aber wir achten nicht darauf, Führungspositionen mit migrantischem oder weiblichem Personal zu besetzen. Denn die Machtkonstellationen im Kulturbetrieb bleiben starr.
In Ihren Texten gendern Sie nicht. Wieso?
Marinić: Ich hatte sprachlich nie das Bedürfnis danach, ich verwende neben der männlichen noch die weibliche Form. Aber ich bin nicht überzeugt davon, dass die Sprache der große Austragungsort von Gerechtigkeitsfragen ist. Sprache schafft Realität -stimmt, aber nicht zwingend in realpolitischen Auseinandersetzungen. Während über das Gendern diskutiert wurde, sank die Zahl der Frauen in Parlamenten, die Realität wurde also nicht geschaffen. Es gibt 72 akzeptierte Geschlechter derzeit -wir werden nie eine in diesem Sinn gerechte, komplette Repräsentation von allen Minderheiten in der Sprache erreichen. Und wenn ich den Anspruch nicht bis ins Letzte für die Minderheiten umsetzen kann, dann ist er auch für die wenigen reine Symbolpolitik. Die Energie sähe ich dann lieber eingesetzt in der Veränderung von machbaren Gerechtigkeitsanliegen.