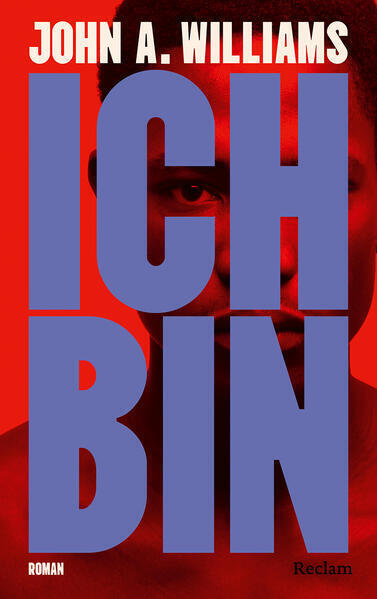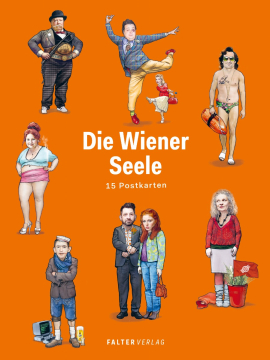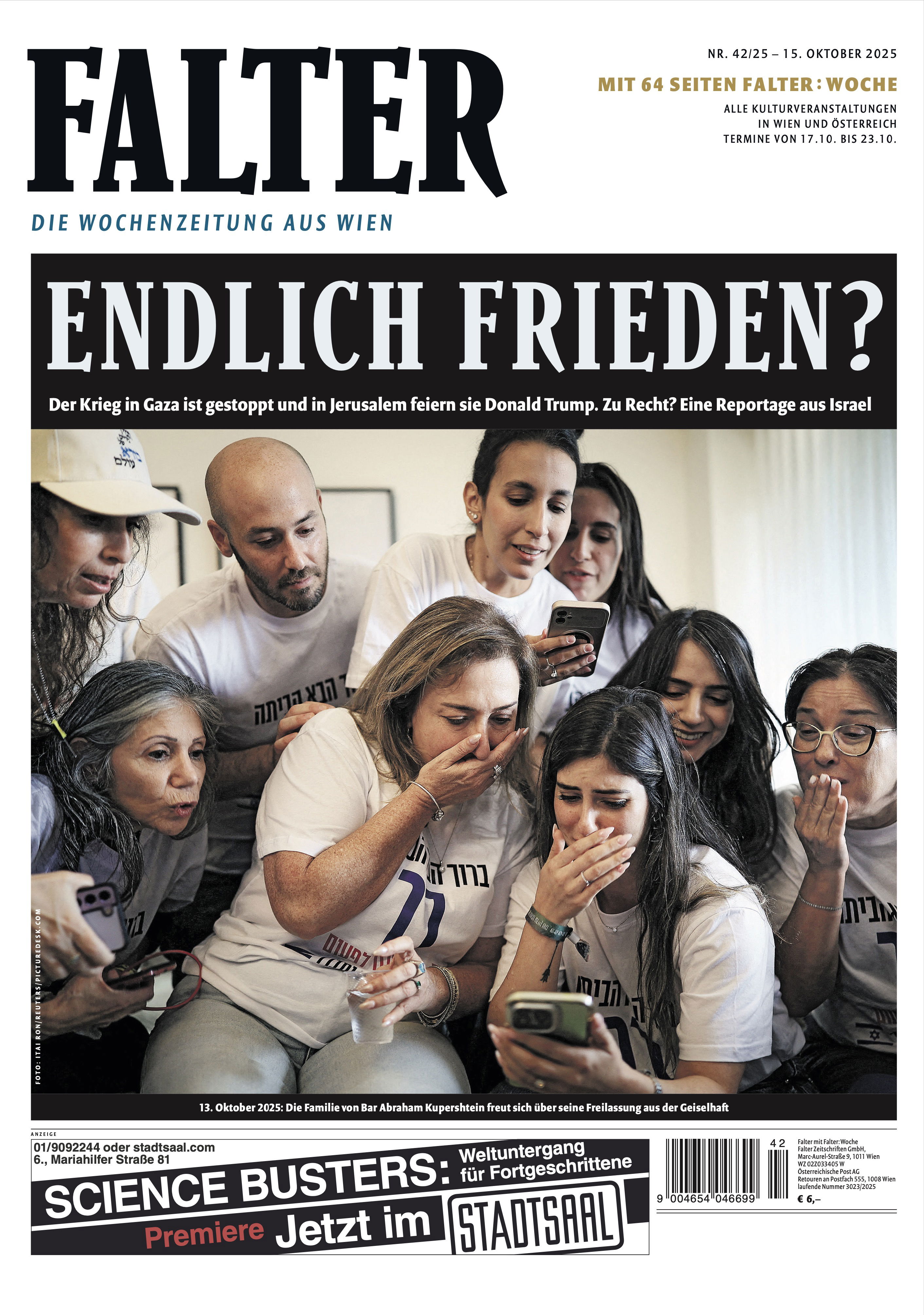
Sechzig Jahre und ein bisschen weiser
Martin Pesl in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 22)
chon vom King-Alfred-Plan gehört? Es handelt sich um einen globalen Entwurf zur Internierung Schwarzer in Konzentrationslagern. Federführend agiert die US-Regierung, ein Aufstand der nicht-weißen Bevölkerung soll damit im Keim erstickt werden.
Sagt Ihnen nichts, überrascht Sie aber auch nicht? Womit bewiesen wäre, dass der Roman „Ich bin“ trotz der fast 60 Jahre, die er am Buckel hat, erschreckend gut in die heutige Zeit passt. Verschwörungserzählungen blühen, und Präsident Trump und dessen Handlangern ist sowieso alles zuzutrauen. Offizieller Anlass dieser erstmaligen deutschen Ausgabe in der Übersetzung von Hans-Christian Oeser ist freilich der 100. Geburtstag des afroamerikanischen Verfassers John A. Williams (1925–2015).
Um es klarzustellen: Den King-Alfred-Plan gibt und gab es nie. Williams hat ihn für seinen vierten Roman, der im Original den Titel „The Man Who Cried I Am“ trägt, erfunden. Vor dessen Erscheinen im Jahr 1967 wurden Auszüge, die den üblen Plan enthielten, in den U-Bahnen Manhattans verteilt. Die Guerilla-Marketing-Aktion erwies sich gleich als doppelt erfolgreich: Das Buch verkaufte sich bestens, und das Gerücht, ein echtes weißes Drehbuch zur Vernichtung aller Schwarzen liege der Fiktion zugrunde, hält sich in den USA bis heute.
Wer jetzt allerdings einen saftigen Politthriller à la John le Carré erwartet, wird enttäuscht oder braucht zumindest viel Geduld, denn die Spionage-Action wird erst als Höhe- und Schlusspunkt im letzten der vier ungleich langen Teile geliefert. Wie die erste Person Singular im Titel andeutet, ist „Ich bin“ vor allem ein Buch über ein Schriftsteller-Ego. Zwar schreibt Williams nicht aus der Ich-Perspektive, aber über die Gedanken des Protagonisten Max Reddick weiß der Erzähler genauestens Bescheid.
Zuerst begegnen wir Max, einem Autor und Journalisten Ende 40, in einem Café in Amsterdam, wo er auf seine Ehefrau Margrit wartet – eine Weiße. Das Paar hat sich einige Jahre zuvor getrennt, weil Margrit mit Max’ Paranoia als Schwarzer in den Vereinigten Staaten nicht mehr umgehen konnte. Die Niederländerin kehrte in ihre Heimat zurück.
Auf den 500 Romanseiten wechselt die Narration zwischen der Gegenwart und dem Was-bisher-geschah. Im Jetzt hat Max Krebs und unerträgliche Unterleibsschmerzen, behält dies aber für sich. Unmittelbar vor seiner Reise nach Amsterdam hat er am Begräbnis seines Mentors Harry Ames teilgenommen, der als Vater der afroamerikanischen Literatur wahrgenommen wurde und ebenfalls mit einer weißen Frau, Charlotte, verheiratet war.
Wir erfahren, wie Max Harry noch vor dem Zweiten Weltkrieg kennenlernt und wie sich die Freundschaft in Briefwechseln festigt, während Max als Soldat in Italien stationiert ist, und wie die beiden die Liebschaften des jeweils anderen kritisch beäugen.
Darüber hinaus begleitet der Roman die berufliche Laufbahn des Protagonisten. Max arbeitet als Quotenschwarzer für mehrere Magazine und plagt sich nebenbei mit dem literarischen Schreiben; er berichtet als Korrespondent aus Nigeria und bekommt einen Job als Redenschreiber des Präsidenten angeboten. Dieser ist mit dem Versprechen angetreten, für die Anliegen der Bürgerrechtsbewegung einzutreten. Doch Max muss feststellen, dass selbst dieser Demokrat es nicht hundertprozentig ernst meint.
„Ich bin“ vermittelt interessante Einblicke in die Welt eines intellektuellen Schwarzen in den 1940er- und 1950er-Jahren. Damals waren die letzten der diskriminierenden Jim-Crow-Gesetze noch in Kraft und die Hautfarbe spielt in jedem Lebensbereich eine Rolle. Wenn es um Frauen und Sex geht, unterscheidet sich Williams’ Roman nicht entscheidend von manch mackerhaften und selbstmitleidigen Arbeiten bekannterer weißer Kollegen.
Zum Zeitpunkt seines Erscheinens galt „Ich bin“ als Schlüsselroman. In der Figur des Minister Q ist ziemlich eindeutig der radikale Bürgerrechtsaktivist Malcolm X zu erkennen, und auch die Personen aus dem amerikanischen Literaturbetrieb haben Entsprechungen im echten Leben, wie etwa die afroamerikanischen Schriftsteller James Baldwin und Richard Wright.
Heute wirkt die Neigung des Autors zum Fake-Name-Dropping eher ermüdend. Die Übersetzung bemüht sich zwar erfolgreich um einen guten Lesefluss, opfert dafür aber viel von der Schärfe, die Williams’ knappes Englisch auszeichnet.