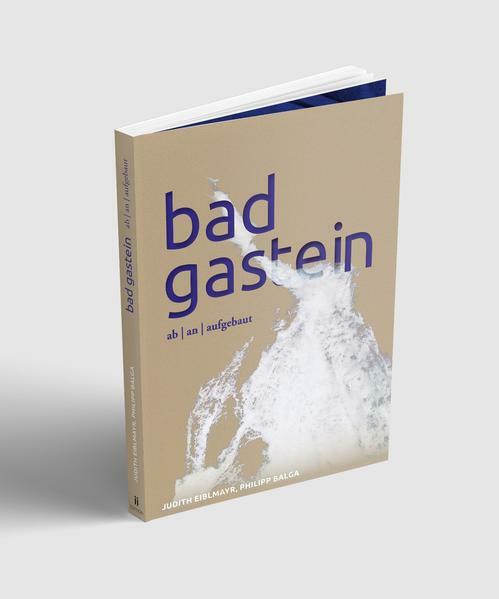Im Manhattan der Alpen wurde planlos gebaut
Maik Novotny in FALTER 42/2021 vom 20.10.2021 (S. 50)
Architektur: Judith Eiblmayr und Philipp Balga erzählen die wild bewegte Geschichte von Bad Gastein
Bad Gastein ist vielleicht der seltsamste Ort Österreichs. Eine enge Schlucht, von einem Wasserfall durchrauscht, in der sich Hotelburgen an den Felshang krallen, die talseits bis zu 50 Meter hoch aufragen. Eine Stadt in den Bergen, aber fast ohne Einwohner. Das eigentliche Dorf Gastein bestand aus nicht mehr als einer Handvoll Häuser um eine einfache Kirche, alles, was dann folgte, verdankt sich zahllosen Spielarten des Tourismus, das Ergebnis von Jahrhunderten voller Begehrlichkeiten und Spekulationen (erst Gold, dann Eisenbahn), Aufschwüngen und Niedergängen.
Nach den 1950er-Jahren begann der lange Niedergang, da der Skitourismus in höhere Lagen abwanderte und die Radon-Kuren sich als nicht ganz so heilsam erwiesen wie erhofft. Kurz nach der Jahrtausendwende wurde der morbide Charme von Hipstern und Architekten wiederentdeckt, die manche alte Hotels neu belebten. Trotzdem wurden immer wieder einst große Häuser wie der Gasteinerhof abgerissen, andere wie das Grand Hotel siechten dahin, und das Herzstück Gasteins, das Ensemble aus Hotel Straubinger, Badeschloss und Post wurde von einem greisen Wiener Investor jahrzehntelang dem Leerstand und Verfall preisgegeben.
Bis das Land Salzburg 2017, mehr oder weniger in letzter Minute, die drei Häuser am Wasserfall erwarb und an einen Hotelinvestor vergab. Jetzt wird renoviert, und im dunklen Tal glimmt wieder ein Sonnenschein der Hoffnung. Das jetzt erschienene Buch „Bad Gastein ab|an|aufgebaut“ kommt also genau zur rechten Zeit. Fast ein Zufall, denn es ist das Ergebnis einer langen Arbeit. Konzipiert wurde es von der Architektin und Publizistin Judith Eiblmayr gemeinsam mit der Kunst- und Architekturhistorikerin Iris Meder, das Duo hatte schon 2009 ein Buch über das Wiener Hochhaus Herrengasse veröffentlicht. Nach dem frühen Tod Iris Meders 2018 tat sich Eiblmayr mit dem Arzt und Fotografen Philipp Balga zusammen, dessen Bildessay das Buch ergänzt.
Die Historie des Ortes wird in einer Art Parallelmontage aus fundiert recherchierter Information und einer überbordenden Fülle von Planmaterial erzählt. Das funktioniert sehr gut, denn die Essays sind lesbar, und die Pläne und historischen Fotos sprechen ihre eigene Sprache, zumal sich Bad Gastein stets selbst bildmächtig inszeniert hat. Man könnte diese Geschichte fast als Roman lesen, mit einzelnen Motiven, die in der Handlung immer wieder auftauchen: Der „amerikanische“ Wildwest-Stadt-Charakter, in der im Wildwuchs gebaut und abgerissen wurde, je nachdem, in welche Richtung die Wegweiser der Wirtschaft gerade zeigten.
Eine Art Zentrum des Plots: der nahezu mythische „Ur-Kern“ des Ortes, das Mitteregg. So hieß der Felsen zwischen den beiden Wasserfällen, der nach und nach überbaut wurde, bis irgendwann nur noch ein Wasserfall übrig war, eingeklemmt zwischen Hotelgebirgen. Auch die Machtkämpfe der lokalen Granden, die wiederum vereint waren in der Rivalität mit Hofgastein und der Verteidigung gegen Neu-Investoren „von außen“, tauchen leitmotivisch immer wieder auf.
Dabei liegt der Fokus des Buches natürlich auf der Architektur, die all diese Dynamiken widerspiegelt und gleichzeitig ihre eigenen Geschichten erzählt: Ländliches trifft auf importiert Urbanes, Fürstliches steht neben Modernem – und mittendrin ein Flugzeugträger aus Beton, das 1974 eröffnete brutalistische Kongresszentrum von Gerhard Garstenauer. Einen wirklichen Plan, der Ordnung in diese wilde Mischung von Baustilen und Bauvolumen brachte, gab es nie.
„Es wurde in Bad Gastein planlos gebaut. Je nachdem, wo gerade ein Baugrund zu kaufen war, entstand ein neues Kurhaus“, stellt Eiblmayr in einem ihrer beiden Essays bedauernd fest. Ihr Fazit: „Bad Gastein wurde es verwehrt, seine natürliche Schönheit neben den grandiosen Bauten weiterhin auszuspielen wie in jener vergangenen Zeit, als das Dorf mit dem Element Wasser zusammenlebte.“
Gegen die Informationsdichte dieser beiden langen Essays und die Fülle an Archivmaterial wirken die anderen Beiträge im Buch eher als Beiwerk, das wenig neue Aspekte in Spiel bringt. Philipp Balgas Fotoessay fängt die zerfurchte Morbidität des Gasteins von heute zwar gut ein, wird aber durch die eingestreuten Zitate aus Songtexten poetisch überfrachtet. Doch in Summe wird hier eine der eigenartigsten Bau-Geschichten Österreichs lesbar und informativ aufbereitet, als Referenz für die Glanzzeiten oder Wildwest-Storys, die noch kommen werden.