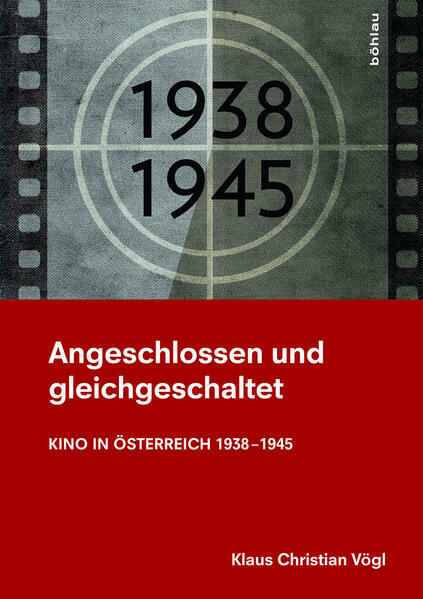Düsternis im Lichtspielhaus
Michael Omasta in FALTER 46/2018 vom 14.11.2018 (S. 38)
Seit ein paar Wochen ziert ein Stein der Erinnung das Trottoir in der Burggasse. „Hier wohnten die Besitzer des Admiralkinos“ heißt es vor Hausnummer 119 in Gedenken an Margarethe und Berthold Ebner, und weiter: „Das Kino wurde 1938 ‚arisiert‘. Der Familie Ebner gelang 1939 die Flucht nach England.“
Damals noch quasi im Handgepäck mit dabei war der zweijährige Sohn des jüdischen Kinobesitzerpaares: Heinz, oder vielmehr Henry, heute 81, Anwalt im Ruhestand, ein hellwacher Mann mit gewinnendem Lachen und dieser Tage wieder einmal zu Besuch in Wien.
Sein Vater, erzählt Henry Ebner in makellosem Wienerisch, habe sich 1938 nach dem „Anschluss“ geweigert, nationalsozialistische Propaganda zu zeigen. „Ende März wurde er verhaftet, nach Dachau und später nach Buchenwald verfrachtet. Er hat nicht viel über diese Zeit gesprochen, wahrscheinlich weil er sie nie ganz verwunden hat. Dabei hatte er großes Glück, er kam im April 1939 frei und zurück nach Wien. Meine Mutter hat das irgendwie arrangiert, aber es dauerte fast vier Monate, sämtliche Formalitäten für die Ausreise zu erledigen. Wir sind zuerst nach Brüssel gefahren, zu einem Verwandten. Am 16. August 39 sind wir in England angekommen.“
In den 1930ern war Kino ein höchst lukratives Geschäft. 1938 verbuchten allein die 186 Lichtspieltheater in Wien rund 30 Millionen Besucher, wobei sich knapp die Hälfte der Hauptstadtkinos in jüdischem Besitz respektive Einflussbereich befand. Eine jüngst veröffentlichte Publikation – „Angeschlossen und gleichgeschaltet. Kino in Österreich 1938–1945“ von Klaus Christian Vögl – zeichnet die „Arisierung“ der Kinobranche als Teil des staatlich legitimierten Raubzugs an jüdischem Eigentum erstmals im Detail nach.
Doch der Reihe nach. Schon sein Großvater Benjamin, der 1910 aus der Bukowina nach Wien kam, erzählt Henry Ebner, sei Rechtsanwalt gewesen. Eigentlich sollte Berthold, sein Vater, in dessen Fußstapfen treten, landete aber schließlich beim Kino. Ludwig, der ältere Bruder des Vaters, erbte 1927 die Konzession des Admiralkinos. Berthold selbst übernahm 1928 jene des Johann-Strauß-Kinos in der Favoritenstraße, an dem später auch die Schwester Melanie beteiligt wurde.
Nicht nur in beruflicher Hinsicht, auch privat hielt die Familie fest zusammen. Margarethe, die Mutter Henrys, hatte jung geheiratet, und zwar Ludwig Ebner, der 1933 an Leukämie starb. 1935 ehelichte sie Berthold, dessen Bruder. 1937 sei dann er zur Welt gekommen, sagt Henry Ebner und grinst. „Also, Sie erkennen das Muster?“
Heute gehört das 1913 gegründete Admiralkino in Wien-Neubau zu den letzten echten Grätzelkinos der Stadt. Zu jener Zeit, als die Familie Ebner es führte, zählten Prominente wie Arthur Schnitzler zu seinen Stammgästen. Margarethe, die vorher in einer Bank gearbeitet hatte, ließ es sich nicht nehmen, den Kassadienst selbst zu versehen, wie eine der wenigen erhaltenen Fotografien aus diesen Jahren bezeugt.
„Meine Mutter liebte das Kino“, erzählt Henry Ebner. „Mein Vater sah es wohl mehr als nützlichen Job. Er mochte Filme. Eines der bestgehüteten Erinnerungsstücke in unserer Familie ist seine Micky-Maus-Uhr, die brachte Disney heraus, als der Tonfilm aufkam. Ich glaube allerdings, dass mein Vater dem Kino abgeschworen hat, als wir nach England kamen. Oder zumindest kann ich mich nur noch an zwei Gelegenheiten erinnern, bei denen er sich jemals wieder einen Film anschauen ging.“
Dank des Jewish Aid Committee kam die Familie aus Wien „in the middle of nowhere“ unter, wie Ebner sich an die Gemeinde Binham in Norfolk erinnert, genauer: im Haus eines anglikanischen Pfarrers. Die Mutter fand dort Beschäftigung als Dienstmädchen, der Vater als Mann für alles. 1940 wurde Berthold Ebner als „enemy alien“ für zwei Monate auf der Isle of Man interniert. Margarethe und Henry kamen in eine Pension in London, die Quäker für Flüchtlinge unterhielten. Als die Familie wiedervereint war, zogen die Ebners nach Guildford, etwa 40 Kilometer südwestlich der Hauptstadt. Dort wuchs Henry auf, besuchte die fortschrittliche, von der emigrierten Soziologin Hilde Lion eingerichtete Stoatley Rough School und brachte es bis zum Schulsprecher.
Um die nach dem „Anschluss“ unter kommissarische Verwaltung gestellten, sozusagen freigewordenen Wiener Kinos rissen sich hunderte von Bewerbern. Branchenspezifische Vorkenntnisse waren nicht vonnöten, Verdienste um die Bewegung dagegen sehr wohl. Nach einem eigenen Punktesystem wurde den Nazis das erlittene Leid in der Illegalität gutgeschrieben, die „Arisierung“ galt der sozialen Absicherung verdienter Parteigenossen. Die Enteignung der jüdischen Besitzer erfolgte unter dem Anschein zivilrechtlicher Korrektheit – nur dass als Bemessungsgrundlage nicht etwa der Verkehrswert eines Kinos herangezogen wurde, sondern lediglich dessen Inventar. „Vorrangig behandelt wurden dabei Juli-Putschisten des Jahres 1934 oder Witwen ‚justifizierter Nationalsozialisten‘“, wie der Kinohistoriker Vögl schreibt. So beispielsweise sollte die Witwe des Dollfuß-Mörders Otto Planetta einen Anteil an dem florierenden Astoria Kino an der Hernalser Hauptstraße erhalten, wurde später aber mit einem Ehrensold abgefertigt.
Unter den „arisierten“ Lichtspieltheatern waren auch die zwei der Familie Ebner. Das Johann-Strauß-Kino ging an Ewald Kloser, „ein hervorragendes Beispiel für ein nationalsozialistisches ‚Protektionskind‘“ (Vögl), seines Zeichens unter anderem Berichterstatter für den Völkischen Beobachter sowie Teil der fünften Kolonne, einer jener Österreicher also, die in Deutschland auf die Machtübernahme hierzulande vorbereitet wurden.
Auch der „Ariseur“ des Admiralkinos, ein gewisser Alois Dworsky, war NSDAP-Mitglied in der Illegalität gewesen. Dass ihm außerdem noch 60 Prozent eines zweiten Kinos zugesprochen wurden, weist ihn wohl als ganz „besonders berücksichtigungswürdig“ aus. Wie das Admiral, das trotz naher Bombentreffer nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde, hat auch Dworsky den Krieg überstanden. In einem Verfahren, das Margarethe Ebner von England aus gegen ihn anstrengte, wurde er als „Reisender“ mit Wohnsitz Attnang-Puchheim geführt.
Bereits am 2. Mai 1945, hat Michaela Englert, die heutige Betreiberin des Admiralkinos recherchiert, übernahm Grete Ragendorf-Mandl, eine Cousine von Margarethe Ebner, die provisorische Leitung des Betriebs. Ihrem beherzten Eintreten ist es wohl zu danken, dass das Rückstellungsansuchen nicht, wie in so vielen anderen Fällen, abschlägig beschieden wurde.
Kinos, die an ihre früheren Besitzer restituiert wurden, stellten die Ausnahme von der Regel dar, vielmehr wurden die vor dem Krieg „arisierten“ Betriebe nach dem Krieg quasi verstaatlicht. „Die kleinliche Rückstellungsgesetzgebung“, resümiert Vögl, „machte eine Revision der durch das NS-Regime erzwungenen Umwälzungen unmöglich, verhinderte weitgehend eine Rückkehr der enteigneten Vorbesitzer und machte den Weg frei zur Etablierung einer großen kommunalen Kinokette, der Kiba.“
„Nahrungsmittel waren in England nach dem Krieg rationiert“, erinnert sich Henry Ebner. „Als ich im März 1948 das erste Mal wieder nach Wien kam, war ich erstaunt: Die Konditoreien waren schon wieder voll – Indianer mit Schlag, Mohrenköpfe, Pardon –, alles hat man bekommen. Ich hab das zuerst gar nicht kapiert: Bei uns gab’s nichts, hier gab’s den Marshallplan.“
Im Fall des Admiralkinos wurde 1951 beim Landesgericht für Zivilrechtssachen ein Vergleich geschlossen, wonach der Antragsgegner Dworsky sich verpflichtete, „das Unternehmen, wie es liegt und steht“, sofort an Margarethe Ebner zurückzustellen.
An eine Rückkehr dachten die Ebners freilich nie. Das Kino wurde verkauft. Henry inskribierte an der London School of Economics und promovierte 1961; vier Jahre später hatte er seine eigene Kanzlei.
Wann immer er heute mit seiner Familie nach Wien kommt, für einen Besuch in der Burggasse 119 und dem neuerdings sanft renovierten Kino seiner Eltern nimmt sich Henry Ebner stets gern die Zeit.