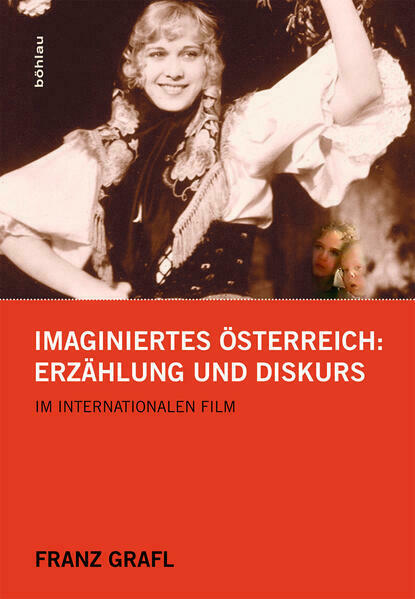Rendezvous in der Kaiserstadt
Michael Omasta in FALTER 47/2017 vom 22.11.2017 (S. 34)
Walzer, Schnitzel und Liebesschwüre: Das Filmmuseum zeigt den Einfluss des Kinos auf die Wien-Klischees
Von Wien sehe man nichts, heißt es in einer Kritik zur New Yorker Premiere von „The Marriage Circle“, aber sei’s drum: „Die Idee von Wien zählt: Liebesschwüre, Walzer, Freiheit, der Schatten von Strauß und Schnitzler.“
Das Jahr ist 1924, der Regisseur besagten Films kein Geringerer als Ernst Lubitsch, deutscher Lustspielspezialist und Neuankömmling in Hollywood. Mit dieser Gesellschaftskomödie feiert er seinen Einstand in Amerika, das Boulevardstück „Nur ein Traum“ dient ihm dabei als Vorlage. Das Erste, was Lubitsch ändert, ist der Schauplatz: Er übersiedelt die Handlung der ausgetüftelten Farce um zwei Ehepaare, ihre diversen Flirts und Treuebrüche von Berlin nach Wien.
„Die authentisch wienerischen Filme entstanden exterritorial“, stellt die deutsche Kritikerin Frieda Grafe in ihrem oft zitierten Essay „Wiener Beiträge zu einer wahren Geschichte des Kinos“ (1993) fest. „Ob sie aus echten Wiener Erfahrungen stammen oder aus begehrlichen Vorstellungen von Fremden, spielt keine Rolle. So oder so nähert das Wienerische sich immer dem Klischee. Da ist das Filmbild dann gleich nebenan.“
Zwei aktuelle Buchveröffentlichungen, Franz Grafls „Imaginiertes Österreich“ und Alexandra Seibels „Visions of Vienna“, plus einer kleinen Filmreihe gleichen Titels docken am Thema an. In beiden geht es um Bilder, nein, Vorstellungen von Österreich, wie sie durch den (internationalen) Film popularisiert, wenn nicht geprägt wurden.
Der jeweilige Zugang indes könnte unterschiedlicher kaum sein. Grafl lotet in seiner Gesamtschau aus, welches Bild nichtdeutschsprachige Produktionen als „kulturelle Botschafter“ Österreichs zukünftigen Generationen vermitteln können. Seibel konzentriert sich auf das Kino der 1920er- und 1930er-Jahre und klopft eine Handvoll Klassiker analytisch nach dem Verhältnis zwischen Wien-Nostalgie und Fragen der Moderne ab: Migration, Urbanismus, Geschlechter- und Klassenverhältnisse.
Viele der berühmtesten Wien-Filme wurden zu 100 Prozent im Studio gedreht, und das nicht selten in Berlin, Paris, London oder Hollywood. In der Regel genügt eine einzige Einstellung – ein Blick auf den Stephansdom, die Oper, das Riesenrad – mit entsprechendem Insert, um Ort und Zeit der Handlung zu etablieren. Wien als Hauptstadt des Habsburgerreiches gehört im Kino bis heute zu den dominantesten Bildern der Stadt: die Figur des greisen Kaisers, die barocke Architektur, üppige Mehlspeisen, die Musik allerorten und die sprichwörtliche Wiener Gemütlichkeit.
Zu den ersten „Exilierten des Wiener Kinos“ kann man Arthur Schnitzler zählen. Schon vor dem Ersten Weltkrieg trägt sich der bekannte Schriftsteller, der zudem ein begeisterter Kinogänger ist, mit dem Gedanken, sein Schauspiel „Liebelei“ auf Leinwand bannen zu lassen. Eine Verfilmung in Wien mit Darstellern vom Burgtheater kommt nicht zustande, stattdessen nimmt sich die Nordisk-Film in Kopenhagen 1913 des Stoffs an.
Das ist der Beginn einer beispiellosen Karriere der Stücke Schnitzlers, selbst Hollywood zeigt sich bald interessiert. Der konservative Monumentalfilmer Cecil B. DeMille macht 1921 mit einer Version des „Anatol“ den Anfang. Jacques Feyder, ein belgischer Regisseur, der zuvor auch in Wien gearbeitet hat, legt 1931 mit dem ersten Tonfilm nach: „Daybreak“ basiert auf Schnitzlers „Spiel im Morgengrauen“ – allerdings inklusive eines romantischen Happy Ends.
Der stilbildende Schnitzler-Wien-Film ist „Liebelei“, 1932/33 von Max Ophüls in Berlin realisiert. Die zur Gänze im Studio entstandene Produktion evoziert die Stadt, indem Fritz und Theo, die männlichen Hauptfiguren, im Stück beides Zivilisten, zu k.u.k. Offizieren werden und die Handlung aus der Privatsphäre in öffentliche Räume mitsamt der typischen Ikonografie transponiert wird: Pferdekutschen, militärisches Personal, aristokratische Interieurs und entsprechende kulturelle Marker – vom Opernbesuch über das Kaffeehaus bis zu Walzerklängen.
Paradoxerweise also lässt Ophüls genau jenes Wien so perfekt wiederauferstehen, in dem er selbst sich, 1925/26 als Regisseur an die Burg verpflichtet, „nie richtig einleben“ konnte. „Das Schicksal“, schreibt er in seiner Autobiografie über seine Wiener Zeit, „hatte mich in eine wunderschöne, vergoldete vierspännige Rokoko-Karosse gesetzt, und ich wollte eigentlich Motorrad fahren.“
Anders als Schnitzler zeichnet Ophüls den Protagonisten Fritz als schwermütigen Gesellen, der schon zu Beginn seiner Liebesgeschichte mit der jungen Christine zu ahnen scheint, dass ihr kein gutes Ende beschieden sein wird. Eventuell steht „Liebelei“, der Film, den melancholischen Abgesängen eines Joseph Roth oder Stefan Zweig ebenso nahe wie Schnitzlers ironischen Porträts der sich überlebt habenden Gesellschaftsordnung des 19. Jahrhunderts.
Das „süße Wiener Mädel“, wie es Christine (Magda Schneider) und mehr noch ihre beste Freundin Mitzi (Luise Ullrich) personifizieren, gewinnt in Seibels präziser Lektüre unerwartete Aktualität. Dabei geht es nicht allein um die Sphäre der Vergnügungsparks und Heurigen, die in der Fantasie männlicher Autoren und Regisseure – sexuelle – Begegnungen zwischen Angehörigen unterschiedlicher Klassen erlaubt, sondern zudem um ein höchst ambivalentes emanzipatorisches Moment: den Bruch mit der vorgezeichneten Rolle als Hausfrau und Mutter und die kurzzeitige Flucht aus Hunger und drückender Armut.
Mithin zählen Unschuld oder Abhängigkeit von männlicher Autorität ebenso zu den Charakteristika des Wiener Mädels wie sexuelle „Mobilität“, die Ausübung eines Berufs und selbstbewusstes Auftreten. Es entwickelt „Techniken der Selbstverteidigung, etwa das Wienerische zu tragen wie eine Maske, die man aufsetzen und wieder abnehmen kann“ (Seibel).
Im Gegensatz zur Figur des Psychiaters aus Wien, der seinen Siegeszug im klassischen Hollywoodkino als Karikatur seines Berufsstandes antritt, ist das Wiener Mädel fast ausnahmslos positiv besetzt. So auch Lena (Esther Ralston), die Titelheldin von Josef von Sternbergs verlorenem Film „The Case of Lena Smith“ (1929). Und das, obwohl der Regisseur sie in seiner Autobiografie geringschätzig als eines jener Mädchen beschreibt, die er als Bub einst im Prater sah, „nichts Eiligeres im Sinn, als sich verführen zu lassen“.
Auffällig übrigens, dass es sich bei den „Viennese girls“ der Stummfilmära u.a. um Schauspielerinnen aus Schweden, Polen, Russland oder Kalifornien handelt, Wienerinnen finden sich kaum darunter. Fay Wray, die Mizzi aus Erich von Stroheims Meisterwerk „The Wedding March“ (1928), ist gebürtige Kanadierin.
Der Film schwelgt in Glanz und Gloria, aber die Darstellung ist durch Witz und Ironie gebrochen. So bekommt der hochwohlgeborene Prinz Nicki (gespielt von Stroheim selbst) von seinen Eltern mehr als einmal mahnende Worte zu hören: „Erschieß dich. Oder – heirate Geld.“
Freilich lässt der adelige Kavallerist sich lieber mit einem Mädel aus der Vorstadt ein. Die berühmteste Szene zeigt Nicki und Mitzi beim Tête-à-Tête in „Dreamy Nussdorf“ unter einem Apfelbaum. Die Blüten, die langsam auf das Paar herunterrieseln, sind aus Papier und Wachs und in tagelanger Arbeit festgeklebt worden.
Regisseur Stroheim immerhin ist Wiener, seiner Familie gehörte eine Strohhutmanufaktur in der Lindengasse. 1908 trat er aus der Israelitischen Kultusgemeinde aus. Im Jahr darauf emigrierte er nach Amerika und kultivierte im Film das Image des exzentrischen Aristokraten von hohem militärischem Rang.
Habsburger-Kitsch und Art déco, Melodram und Screwball-Comedy: All das vereint der Film „Reunion in Vienna“ (1933) auf sich, quasi die Überraschung, mit der die kleine Reihe „Visions of Vienna“ des Österreichischen Filmmuseums eröffnet.
Bei einer Führung durch das Schloss Schönbrunn erinnert sich die ehemalige Hofdame Elena ihrer Liaison mit Erzherzog Rudolf von Habsburg. Als dieser, inzwischen Taxifahrer in Paris, nach Österreich zurückkehrt, um die Monarchie wiedereinzuführen, sieht Elenas Gatte, der Wiener Psychiater Dr. Krug, den Zeitpunkt für therapeutische Maßnahmen gekommen: Elena muss die Vergangenheit erneut durchleben, um mit ihr abschließen zu können.