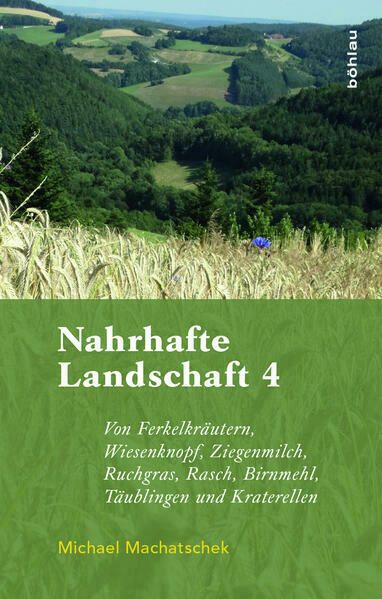„Sie nennen mich den Alm-Papst“
Irena Rosc in FALTER 40/2017 vom 04.10.2017 (S. 52)
Wildgemüse, Wildobst, essbare Triebe, Wurzeln und Rinden – der Vegetationskundler Michael Machatschek kennt sie alle und weiß, wie man sich von der Wildnis ernähren kann. Eine Wanderung über die Almen hinter Österreichs Grenze
An einem sonnigen Tag zu Herbstbeginn bin ich mit Michael Machatschek verabredet, einem ehemaligen Hirten, promovierten Vegetationskundler und Buchautor. Machatschek wohnt im Kärntnerischen Gitschtal. Ich will ihm die Gegend auf der anderen Seite der Grenze zwischen den Steiner- und Sanntaleralpen zeigen und die Velika planina (Großalm), Sloweniens größte und schönste Alm. In dieser Bergregion haben sich noch viele alte Bräuche und Techniken der Lebensmittelgewinnung und Verarbeitung erhalten, auch aus wildwachsenden Pflanzen. Und das sind die Hauptthemen in Machatscheks Büchern.
Michael Machatschek ist Erforscher und Sammler von alten Rezepten und Überlieferungen des ländlichen und bäuerlichen Lebens. Als Ratgeber ist er bei auftretenden Problemen neuerdings immer öfter auf österreichischen Almen unterwegs.
In seiner Buchserie „Nahrhafte Landschaft“ hat Machatschek wie kein anderer eine unglaubliche Fülle von Rezepten, überliefertem und selbst beobachtetem Wissen über die Verwendung von wildwachsenden, essbaren Pflanzen zusammengetragen. Er beschreibt, wie Wildgemüse, Wildobst, Nutz-und Heilkräuter, essbare Triebe, Wurzeln, Rinden und Mehle von Früchten und Bäumen sowie Pilze verkocht, konserviert oder auf andere Art haltbar gemacht werden können. Hat man seine Bücher im Haus, kann man auch in Notzeiten überleben.
Die verkarstete, mit weichem Gras bewachsene Hochebene, auf die wir uns begeben, liegt in einer Höhe von 1600 Metern und wird seit prähistorischer Zeit von Hirten zum Zweck der Wanderweidewirtschaft genutzt. Mit den Reformen Maria Theresias bekamen Bauern aus den umliegenden Tälern festgeschriebene Rechte an der Alm. Deshalb wird die Velika planina bis heute immer noch in einem Atemzug mit der großen Kaiserin genannt. Das Besondere an dieser Alm ist, dass es hier nicht wie sonst üblich einen Hirten für alle weidenden Tiere gibt, sondern jeder Bauer selbst für seine Tiere verantwortlich ist. Auch die Weiderechte können nicht verkauft, sondern nur vererbt werden. Und es gibt ein kleines Bauernparlament für die Belange der Alm.
Die Alm wird ab Juni beweidet. Wenn das erste grüne Gras die violette Safrandecke abgelöst hat, dann kommen sie – an die 300 Rinder und ihre Hirten. Bis September bleiben Tier und Mensch gemeinsam hier oben. Im Winter gehört die Alm dann den Schneewanderern und Skifahrern.
Machatschek spricht wenig und ist mit seiner Fotodokumentation beschäftigt. Ab und zu macht er auf etwas aufmerksam. Zum Beispiel auf eine abseits der Herde stehende Kuh. Er meint, hier könne etwas nicht stimmen, weil eine Kuh nicht grundlos alleine weit weg von der Herde stehen bleibt. Die Kuh will damit auf etwas aufmerksam machen. Oder er zeigt auf eine Linie, die sich im Boden abzeichnet und entlang derer sich jederzeit ein Loch auftun kann, in dem ein ganzes Tier verschwinden kann. Tatsächlich sehen wir dann kreisrunde Absperrungen zum Schutz der Tiere um solche schon vorhandenen Löcher. Am Rand eines steil abfallenden Hanges, an dem die Kühe ihre Schädel immer wieder durch die Sicherheitsabsperrung strecken, um noch köstlichere Gräser zu erreichen, liegt büschelweise Silberwurz, eine Heilpflanze, die bis zu 100 Jahre alt wird. Von den Kühen wurde sie mit Gräsern ausgerupft und nach einer Überprüfung durch das Kuhmaul letztendlich doch verschmäht und liegengelassen. Weil eine Kuh die Vorarbeit geleistet hat, darf ich die geschützte Heilpflanze mitnehmen.
Die Velika planina ist die größte beweidete Alm in Slowenien. Sie ist nicht zuletzt für die architektonisch einmaligen Hirtenhütten bekannt. Das sind zeltartige, ovale Holzhütten, ehemals fensterlos und ohne Rauchfang, mit bis zum Boden reichendem Schindeldach und einer zentralen Feuerstelle. Sie beherbergen neben einer Schlafstelle für den Hirten auch die Rinder. Die ältesten Reste einer fast identen Hütte stammen aus dem 16. Jahrhundert. Die zwei großen Steine neben der Eingangstüre, die das Gebäude stützen, nennt man „Baba“ (Weib).
Die Hirten stellen in kleinen Mengen auch einen winzigen, birnenförmigen Hartkäse her, der Trnič (kleiner Dorn) genannt wird. Mit selbstgeschnitzten hölzernen Stäbchen gestalten sie durch Abdruck in den Käse ihre ganz individuellen Muster. Manche behaupten, der Käse gleiche der Brustspitze einer Frau, und in der Verzierung sei die ganze Sehnsucht des Hirten nach seiner Geliebten eingeprägt.
Auf höchster Stelle der Alm dann die 1938 nach Plänen des berühmten Architekten Jože Plečnik erbaute Kapelle Maria Schnee. Das Original wurde im Winter 1944/45 (genauso wie die meisten Hütten) von deutschen Besatzern niedergebrannt und erst 1988 wieder aufgebaut.
Wir machen Pause bei einem der Hirten. Machatschek ist ein guter Zuhörer. Der eigentliche Plan sah vor, dass er uns alles erklären und viel erzählen wird. Er ging nicht auf. Also liefern wir, Vinko Poličnik, einer der besten Kenner der Velika planina, und ich, die Geschichten für Machatscheks Fundus. Und er? Ist begeistert. Die letzten noch auf der Alm verbliebenen Kühe liegen mit ihren Kälbern in der Sonne. Nur vereinzelt sind Touristen zu sehen. Die zeltartigen Hütten um uns leuchten silbergrau. Sterz, Jota und hausgemachte Bratwürste werden angeboten. Wir entscheiden uns für Buchweizensterz (Hadnsterz oder Ajdovi žganci) mit saurer Milch. Für diese Speise gibt es der Tradition entsprechend handgetöpferte Schüsseln, in denen der Sterz mit Grammeln aufgetragen wird. In einer zweiten Schüssel wird die saure Milch serviert. Eine dicke, fette Haut liegt runzelig über dem halbfesten, geschmackvollen Kern. Es ist wie Himmel auf Erden. Machatschek ist zufrieden.
Der Buchweizen ist den Slowenen heilig und seit Jahrhunderten eines der wichtigsten traditionellen Lebensmittel der Gegend. Der Buchweizen bewahrte die Menschen in der großen Klimakatastrophe von 1816 vor dem Verhungern. Es war das Jahr der Kälte, der Dunkelheit, der Krankheiten und Hungersnöte, die auf den Ausbruch des Vulkans Tambora 1815 in Indonesien folgten. Der genügsame Buchweizen war eine der wenigen Pflanzen, die in der Kälte und Dunkelheit gedeihen konnten. Den entscheidenden Anstoß dazu gab der in Ljubljana lebende Privatgelehrte und reichste Mann des Herzogtums Krain, Sigmund Zois von Edelstein, von den Slowenen schlicht Žiga Zois genannt. Noch heute weiß jedes Kind, das Zois und Ajda zusammengehören. Zois wird in Ehren gehalten, Ajda wird gegessen.
Machatschek, der Erforscher von wild wachsenden Lebensmitteln und von Lebensweisen mit der Natur, hat sich seine Forschungsstelle selbst geschaffen. Voller Stolz sagt er: „Ich bestimme selbst, was ich beforsche!“ In seiner Forschungsstelle entstand die Idee einer „Speisekammer aus der Natur“, ein gemeinsames Ausstellungsprojekt mit Elisabeth Mauthner über die Bevorratung und Haltbarmachung von Wildpflanzen. Die Speisekammer, mit ihren hunderten Gläsern und Flaschen konservierter und haltbar gemachter Wildpflanzen, ist ein großer Erfolg geworden. Heuer wurde sie in der Schweiz ausgestellt. Für alle, die die Ausstellung nicht sehen können, gibt es das gleichnamige Buch mit unzähligen Rezepten und Erklärungen, wie man auf Wiesen oder Weiden sammelbare Kräuter, Wildgemüse und Wildobst mit einfachen Mitteln verarbeitet und haltbar macht.
Machatschek ist nicht zuletzt auch Chronist einer aus der Not geborenen Art der veganen Ernährung unserer Vorfahren. Diese unterscheidet sich grundlegend von dem heutigen veganen Trend, wofür oft Zutaten für eine vegane Speise um die halbe Welt transportiert werden. Bei Machatscheks Beschreibungen der überlieferten Rezepte handelt es sich um Pflanzen und Früchte, die in der freien Natur und in der unmittelbaren Umgebung der Menschen wachsen. Er meint, dass es „eine Enteignung unserer Souveränität bedeutet, wenn wir die Landschaft ohne ihre Gebrauchszusammenhänge wahrnehmen. Die Voyeure und exklusiven Landschaftsbetrachter befriedigen ihre Augen und können doch nichts Nährendes entdecken, da sie keine Ahnung vom Gebrauch der Pflanzen haben.“
Wild- und bitterkräutersatt (essbares Gefundenes siehe Fotos) kehren wir auf dem Rückweg von der Alm noch bei einem Bauern ein und verkosten die luftgetrocknete und kostbare Wurstspezialität „Želodec“, die es nur in dieser Gegend gibt. Dieser Geschmack zaubert dann am Ende des Tages doch noch ein mildes Lächeln auf Machatscheks sonst so ernstes Gesicht.