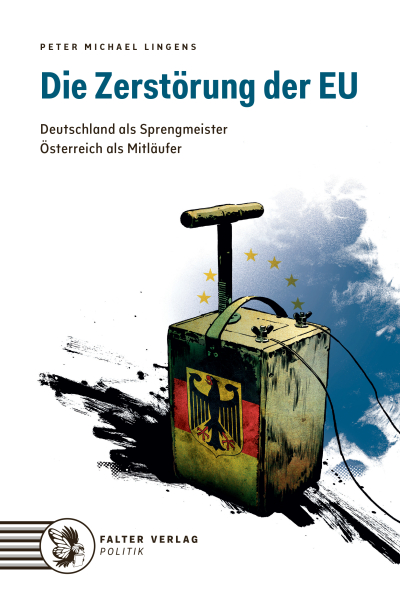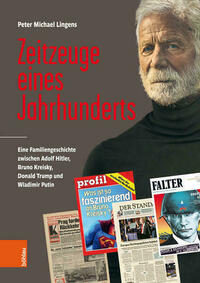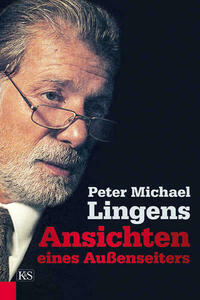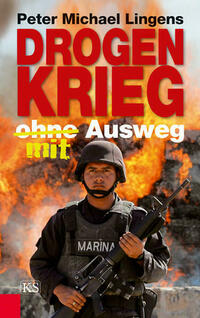"Ich kann nicht mehr, leb du weiter"
Peter Michael Lingens in FALTER 6/2025 vom 05.02.2025 (S. 16)
Die Juden", sagte der Psychiater und KZ-Überlebende Viktor Frankl in einer Fernsehdiskussion nach der Ausstrahlung der Serie "Holocaust", seien "erhobenen Hauptes in die Gaskammern gegangen".
Frankl war drei Tage im Konzentrationslager (KZ) Auschwitz inhaftiert. Dann wurde er in das mit Auschwitz nicht vergleichbare Arbeitslager Dürkheim, ein Außenlager des KZ Dachau, überstellt. Ich habe in den zwei Jahren, die ich in Auschwitz verbringen musste, nur drei Gruppen von Menschen auf ihrem Weg in die Gaskammern erlebt: die Naiven, die noch immer meinten, sie gingen in ein Duschbad. Die Verzweifelten, die vor Angst schrien. Und die völlig Apathischen, die nach einigen Monaten KZ zu willenlosen Skeletten heruntergekommen waren.
Erhobenen Hauptes zu sterben ist unter anderem eine Frage des Blutzuckerspiegels: Wenn er wegen Unterernährung unter ein gewisses Niveau sinkt, kann man den Kopf nicht mehr heben.
Die Vorstellung von Auschwitz als der perfektesten Mordmaschinerie der Weltgeschichte ist Allgemeingut. Auschwitz war aber auch eine Orgie des ganz gewöhnlichen Zugrundegehens. Wer keine privilegierte Funktion hatte, starb spätestens nach vier Monaten an Hunger oder Krankheit.
Es gab Perioden, in denen mehr Menschen an Fleckfieber starben, als selbst in den Gaskammern ermordet wurden. Fleckfieber wird durch Läuse übertragen. Man kann es als Seuche nur durch Desinfektionsmittel in den Griff bekommen, aber wir wagten nicht, eine Desinfektion zu fordern, weil das bloße Eingeständnis, dass es im Lager Fleckfieber gibt, wahrscheinlich dazu geführt hätte, dass alle Kranken "abgespritzt" worden wären.
Doch schließlich uferte die Epidemie derart aus, dass sogar die Wachmannschaften dadurch dezimiert wurden. Daraufhin löste der berüchtigte SS-Lagerarzt Josef Mengele das Problem: Er schickte die Belegschaft eines Blocks vollzählig ins Gas, desinfizierte das Gebäude, desinfizierte dann die Insassen des Nachbarblocks und übersiedelte sie in die leere Baracke. Diese Prozedur reihum, bis alle Blocks desinfiziert waren. So hat Mengele das Fleckfieber besiegt. Mathematisch gesehen hat er einer Vielzahl von Menschen das Leben gerettet.
Als ich selbst Fleckfieber hatte, lag neben mir eine jüdische Pflegerin. Als wir abgefiebert aus der Bewusstlosigkeit erwachten, sprachen wir leise von unseren beiden dreijährigen Kindern, die in Sicherheit waren. Ein Stück Wurst aus Pferdefleisch wurde ausgeteilt. "Du musst essen", sagte ich zu der Kameradin, "wenn du dein Kind draußen wiedersehen willst." Sie hielt ihre Wurstscheibe in der Hand, führte sie zum Mund, aber sie schaffte es nicht. "Ich kann nicht mehr, leb du weiter", sagte sie und hielt mir den Wurstzipfel hin.
Ich aß ganz langsam an meiner eigenen Portion, indem ich kleinste Stücke zerbiss und diese zwischen Schneidezähnen und Zungenspitze zerdrückte. Das war der einzige Teil meiner Mundschleimhaut, der noch heil geblieben war. Denn nach dem Fleckfieber ist der Mund von einer schwarzen Kruste überzogen, unter der, wenn sie beim Kauen unabsichtlich abreißt, das blutige Zahnfleisch hervorkommt.
Erst nach Stunden war ich wieder fähig, mich der jungen Frau neben mir zuzuwenden. Sie war tot. Ihre Hand war noch in meine Richtung ausgestreckt: Ich bog ihre schon erstarrten Finger auseinander und nahm mir die Wurst. Dann schlief ich tief und fest meiner Genesung entgegen.
Neben mir im Krankenblock dämmerten die Verhungernden. Ihre Beine waren auf das Dreifache ihres ursprünglichen Umfangs angeschwollen, weil das Gewebe die Feuchtigkeit nicht mehr zu halten vermochte. Dann platzt das Fleisch und das Wasser rinnt aus. Zurück bleibt ein Skelett in einem Sack aus Haut.
Wenn wir von unserem Krankenrevier, in dem ich als Häftlingsärztin andere Gefangene behandelte, im Lager aus die Züge mit immer neuen "Transporten" an der Rampe ankommen sahen, haben wir uns immer öfter bei einem ungeheuerlichen Gedanken ertappt: "Um Gottes willen, wenn die alle hier hereinkommen, wird man keine Woche mehr überleben können." Nicht herein kamen die Transporte, die direkt ins Gas führten. Im Prozess gegen den Österreicher Franz Novak, der die Züge nach Auschwitz zusammengestellt hatte, habe ich als Zeugin versucht, den Geschworenen das klarzumachen: Der bloße Umstand, dass man so viele Menschen auf einigen wenigen Quadratkilometern konzentrierte, musste angesichts der minimalen ins Lager gelieferten Nahrungsmittel und Medikamente zwingend zu deren Tod führen. Franz Novak wurde von den österreichischen Geschworenen drei Mal freigesprochen.
Auschwitz war nicht nur das Lager des größten Judenmordes der Weltgeschichte. Es hat auch mehr Nichtjuden das Leben gekostet als irgendeine andere Mordmaschine. Auch eine halbe Million Roma und Sinti wurde dort vergast. Es starben dort Bibelforscher und Kriminelle, neben Franzosen, Ungarn, Tschechen, Holländern und Russen nichtjüdischer Herkunft auch unzählige Deutsche, weil sie im Widerstand zu den Nationalsozialisten waren oder auch weil sie von den Nazis aufgrund ihrer homosexuellen Orientierung verfolgt und ermordet wurden.
Als ich am 20. Februar 1943 im Frauenlager Auschwitz-Birkenau ankam, weil ich Jüdinnen und Juden bei der Flucht aus Nazideutschland geholfen hatte und denunziert worden war, bestand mein Transport aus 34 Frauen: zehn nichtjüdische Deutsche (darunter verstand man damals auch die Österreicherinnen), zehn Jüdinnen und 14 Polinnen und Russinnen. Nach einem Jahr waren die zehn Jüdinnen alle tot, von den 14 Slawinnen noch sieben und von den zehn Deutschen außer mir noch eine am Leben - sie war Kapo, Anführerin eines Arbeitskommandos.
Üblicherweise war man vier Monate nach der Ankunft in Auschwitz tot. Bei älteren Frauen, bei psychisch oder gar körperlich Geschwächten oder Erkrankten dauerte es vielfach nur Tage.
Eine von denen, die gleichfalls sofort starben, war Carola, eine nicht mehr ganz junge, aber gesunde, kräftige Krankenschwester aus Wien. Sie erzählte mir, wie sie ihren jüdischen Freund die ganze Zeit hindurch erhalten hatte, wie sie ihm nach Frankreich gefolgt war, um ihn zu heiraten, wie sie dort wegen der Ehe mit ihm verhaftet wurde. Und dann hatte er, der durchkam, sich in die USA in Sicherheit gebracht hatte, ihr geschrieben, er hätte sie nie geliebt, ihre Heirat wäre ein Irrtum, wäre in Wahrheit gar keine echte Ehe gewesen.
Die Frau hat Auschwitz nicht überlebt. Durch einen jener unglaublichen Zufälle, die es nur in der Wirklichkeit gibt, habe ich später ihren Mann kennengelernt. Er hatte ihr den Brief geschrieben, weil er geglaubt hatte, sie könnte damit ihre rassengesetzwidrige Ehe annullieren und ein neues Leben beginnen.
Die Baracken, in denen wir lebten, waren ehemalige Pferdeställe. Sie hatten keine Fenster. Der Boden war festgestampfter Lehm. Selbst die Kranken im Revier lagen zu viert auf mit Holzwolle gefüllten Säcken, und das mehrere Stockwerke übereinander.
Am Ende jeder Baracke war das ehemalige Kutscherzimmer abgetrennt, das ein Fenster in die Baracke und einen Fußboden besaß. In diesem Zimmer wohnte der Kapo (im Krankenblock: die Ärztinnen). Sie besaßen ein eigenes Bett, Leintücher, ein Handtuch, etwas mehr Suppe aus dem großen Kessel, in dem das Essen ausgetragen wurde, etwas mehr Brot, "organisierte" Toilettengegenstände. Das alles war ein gewaltiger Vorsprung im Kampf ums Überleben.
Wenn eine Blockälteste allzu viel stahl, wurde gemurrt. Wirklich etwas gegen sie zu unternehmen war nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Denn mehr noch als in der Freiheit galt im Lager die weise Erkenntnis: "Die hat schon gestohlen, die Nächste muss erst stehlen."
Im Angesicht des Verhungerns ist Stehlen eine absolute Selbstverständlichkeit. Die Vorstellung, dass die SS mit deutscher Gründlichkeit die Ordnung aufrechterhalten hätte, ist grotesk. Wo die Häftlinge aus furchtbarster Not heraus stahlen, stahl die Wachmannschaft aus ungebrochener Habgier.
Es gab den sogenannten Effektenblock, den wir "Kanada" nannten, offenbar weil wir damals mit diesem Land die Vorstellung unbegrenzten Reichtums verbanden. Dort wurden die abgegebenen Kleider und Wertgegenstände der Häftlinge aufbewahrt.
In Auschwitz gab es nicht genug gestreifte Häftlingskleider für die Masse an weiblichen Gefangenen. Also mussten beziehungsweise durften wir Privatkleider tragen. Nicht unsere eigenen, sondern die der vergasten Jüdinnen.
In "Kanada" wurden die Nähte dieser Kleider zuerst von eigenen Kommandos aufgetrennt, um Juwelen zu finden, die viele Jüdinnen in ihren Kleidernähten versteckt hatten, weil in ihren Heimatländern das Gerücht verbreitet worden war, man könnte sich mit diesen Schätzen das Leben retten.
Diese und andere Arbeiten besorgten Häftlinge, und es war dies die privilegierteste Stellung, die man im Lager innehaben konnte. An jedem Morgen marschierten die sogenannten "Rotkäppchen" aus dem Lager nach "Kanada". Diesen Häftlingsfrauen, die für die Arbeit das Lager verließen, hatte ein findiger Kapo rote Kopftücher verpasst, um sie leichter zusammenhalten zu können.
Vor ihrem Ausmarsch wurden ihre Kleidungsstücke gezählt, und sie durften bei der Rückkehr nur genauso viele anhaben. Aber sie gingen hinaus mit dreckigen Fetzen am Leib und kamen zurück in warmen Kostümen und Stiefeln. Sie schmuggelten Goldstücke, Juwelen und Medikamente in der Mundhöhle und tauschten sie bei den Küchenarbeiterinnen in Lebensmittel um.
Natürlich konnte das alles nur geschehen, weil die Aufseherinnen es nicht verhinderten. Und sie verhinderten es nicht, weil sie aufs Heftigste mitstahlen.
Es gab noch eine Möglichkeit, zu überleben, allerdings nicht für Jüdinnen. Das war die Meldung ins Bordell. Irgendwann, ich glaube, es war im Herbst 1943, wurden junge, passabel aussehende Mädchen mit schwarzem Winkel zusammengerufen. Das waren die sogenannten "Asozialen" - teils Prostituierte, teils aber nur junge Frauen, die zur Zwangsarbeit eingeteilt worden waren und ihren Arbeitsplatz verlassen hatten.
Diesen Mädchen erzählte nun der SS-Lagerführer Hössler, sie könnten auch etwas für die deutsche Kriegsanstrengung tun. Rings um das Lager wären rüstungswichtige Betriebe entstanden und die Männer dort könnten viel mehr leisten, wenn sie nicht unter "Spannungen" leiden müssten.
Also habe man im Block 24 des Männerstammlagers in Auschwitz, einem soliden Ziegelbau, ein eigenes Bordell eingerichtet, zu dem sich die Mädchen melden sollten.
Das Bordell bedeutete ein geheiztes Zimmer, ein Bett, heiße Duschen, SS-Verpflegung, kurz: eine Chance auf Überleben. Wenn je Prostituierte behaupten durften, die Not habe sie zu ihrem Beruf gezwungen, so durften sie es in Auschwitz.
Einmal wurde im Block 24 sogar eine Hochzeit gefeiert. Ein Spanienkämpfer von der internationalen Brigade hatte ein Kind zurückgelassen, und die junge Spanierin war mit dem unehelichen Sohn der Schandfleck der Familie.
Sie machte sich auf die Reise bis zum Kommandanten von Auschwitz, den sie bat, den Vater ihres Kindes heiraten zu dürfen. Sei es aus einer Laune heraus, sei es aus Familiensinn, der Kommandant war jedenfalls einverstanden, und die Hochzeit durfte vor der politischen Leitung als Standesbehörde gefeiert werden. Für die Nacht, so hat man mir berichtet, wurde dem Paar ein Zimmer im Bordell zur Verfügung gestellt. Seine Frau durfte dem Häftling sogar ein Hochzeitsessen kochen. Dann kehrte er wieder zurück zu seinen Kameraden mit den Hungerödemen.
Auch außerhalb der Bordelle war hübsch zu sein für eine Frau ein noch größeres Kapital als je in der Freiheit. Es gab nur etwa 50 SS-Aufseherinnen in Auschwitz aber mehrere Tausend SS-Männer. Zwar versuchte man eine strenge Trennung der Geschlechter durchzuführen, aber das gelang nicht. Manche Arbeiten im Frauenlager wurden von Männerkommandos durchgeführt. Das ermöglichte Kontakte, ja sogar richtiggehende Verhältnisse.
Vor allem aber gab es das Leichenkommando: Jede Nacht kam ein Lastwagen und holte die Leichen ab. Der SS-Mann, der es führte, nahm aus Gutmütigkeit oder gegen Bestechung mehr Männer mit, als zum Aufladen nötig waren. Immer ein paar von ihnen konnten sich im Dunkeln mit ihren Partnerinnen treffen. Die anderen warfen inzwischen die steifen Frauenleichen auf den Lastwagen. Dann wechselten sie einander ab. Auch im "Leichenkommando" zu sein war eine "Funktion" und also eine Chance zum Überleben.
Ob man eine solche Funktion erhielt, hing davon ab, ob eine der schon vorhandenen Funktionärinnen einen protegierte. Am besten vermochten das die Kommunistinnen. Vielfach waren sie bereits von der Illegalität her kampferprobt. Fast durchwegs wussten sie um die Wichtigkeit von Funktionen in einem Gemeinwesen, und untereinander hielten sie eisern zusammen.
Obwohl nicht einmal so viel mehr Kommunisten in den Lagern waren als etwa überzeugte Sozialdemokraten oder überzeugte Katholiken, haben sehr viel mehr von ihnen Auschwitz überlebt.
Später wurden manchen dieser kommunistischen Funktionäre Vorwürfe gemacht: Als Lagerschreiber hätten sie beispielsweise ihre Genossen von den Todeslisten gestrichen. Und das bedeutete zwangsläufig: Ein anderer rückte zum Sterben nach. Aber Häftlinge sind eben auch Menschen. Auch für sie ist der konkrete Kamerad, den sie persönlich kennen, näher als die Riesenzahl der anonymen Nummern einer Selektionsliste. Der Druck der wahnwitzigen Verhältnisse lastete auf uns allen.
Umso fantastischer war es, dass es selbst unter diesen Verhältnissen Ärzte gab, die ein Berufsethos bewiesen, das man heute manchen Kollegen in Freiheit wünschen möchte. So gab es etwa eine ausgezeichnete Ärztin namens Adelheid Hautval. Sie war wegen Judenbegünstigung ins Lager gekommen und wurde jenem Block 10 zugeteilt, in dem der Gynäkologe Carl Clauberg, ein buckliger Zwerg, seine Sterilisierungsversuche machte. Hautval weigerte sich mitten in Auschwitz gegenüber einem SS-Arzt, derartige Operationen durchzuführen.
Der Arzt war dermaßen verblüfft, dass er Eduard Wirths, den obersten Lagerarzt, herbeirief. Dieser war ebenfalls fassungslos und fragte: "Was heißt, Sie wollen gesunde Menschen nicht operieren? Wissen Sie nicht, dass es zwischen den Menschen Unterschiede gibt? Das sind Jüdinnen, die Sie operieren sollen."
Hautval sah ihn von oben bis unten an und antwortete vollkommen ruhig: "Doch, auch ich weiß, dass es Unterschiede zwischen den Menschen gibt. Zum Beispiel den zwischen Ihnen und mir."
Diese mutige Ärztin wurde daraufhin zum Tode verurteilt, aber jemand strich ihre Lagernummer von den Listen. Das allgemeine Chaos ließ sie überleben.
Ich selbst habe das Fleckfieber auch nur überlebt, weil mir ein weiterer Zufall zu Hilfe kam: Der SS-Arzt Werner Rohde war während des Medizinstudiums in Marburg an der Lahn in Deutschland mein Studienkollege gewesen. So brachte er mir lebensrettende herzstärkende Medikamente und sorgte dafür, dass ich für einige Monate in das Nebenlager Babice kam, ein landwirtschaftlicher Betrieb, in dem ich mich einigermaßen erholen konnte.
Rohde sah in der Endlösung eine "kriegerische Maßnahme", aber es irritierte ihn, gegen Frauen Krieg zu führen. "Mein Gott, wann werden wir zwei wieder einmal in Pfeifers Weinstube in Marburg an der Lahn sitzen?", fragte er mich einmal. Er hielt es ernsthaft für möglich, dass wir wieder miteinander an einem Tisch sitzen könnten, so wie wir jetzt unter den rauchenden Kaminen von Auschwitz saßen.
Im Männerlager soll derselbe Rohde hingegen gewütet haben. Er wurde nach Kriegsende zum Tod verurteilt und gehängt.
Ärzte wie Klein, Rohde oder gar Mengele waren nicht typisch für die SS in Auschwitz. Viel eher war es ein kleiner SS-Mann, den ich zu Beginn meiner Haft kennenlernte. Damals war ein riesiges Feuer ausgebrochen, das nur mit Mühe gelöscht werden konnte. Ich fragte den SS-Mann, der die Brandruine bewachte, was mit uns geschehen wäre, wenn das ganze Lager niedergebrannt wäre. Er antwortete mit freundlicher Ehrlichkeit: "Wir hätten euch alle abgeknallt, und danach hätten wir endlich heimgehen können."
Dieser Volksdeutsche aus der Ukraine hatte kaum feindliche Gefühle gegen uns. Hätte man uns alle nach Hause geschickt, er wäre durchaus damit einverstanden gewesen. Der KZ-Dienst machte ihn nicht glücklich. Tag und Nacht musste er stundenlang auf den damals noch offenen Wachttürmen stehen. Er muss sich über die Abwechslung gefreut haben, wenn sich ein Häftling dem elektrischen Draht genähert hatte und daher laut Befehl abzuknallen war.
Wieso es dennoch nie zu dieser Revolte kam? Auch das Loslaufen, das Stürmen eines Lagertores bedarf eines gewissen Blutzuckerspiegels. Vor allem aber geben die Menschen auch noch im Angesicht der Gaskammer nie die Hoffnung auf, dass sie zu den wenigen Überlebenden gehören könnten. Ein Aufstand hätte bedeutet, dass die ersten paar Hundert, paar Tausend von den Maschinengewehren auf den Wachttürmen niedergemetzelt worden wären. Selbst angesichts des Mordens um uns waren wir immer noch ganz gewöhnliche Menschen, keine Selbstmörder.
Auch die gefürchtete KZ-Oberaufseherin Maria Mandl war ein ganz gewöhnlicher Mensch. Man konnte sich zu einer Vorsprache bei ihr melden, zum Beispiel wie ich es ein paarmal tat, um die Erlaubnis zu erbitten, meinem kleinen Buben, der damals noch nicht lesen konnte, einen illustrierten Sonderbrief schreiben zu dürfen. Mandl erlaubte es regelmäßig.
Ein anderes Mal erlebte ich die Mandl, wie sie ein paar jüdische Mütter mit kleinen Kindern, die nur durch einen Zufall nicht direkt von der Rampe in die Krematorien geschickt worden waren, zu sich rief. Während die Frauen zitternd draußen standen, bat sie die Kinder in ihr Zimmer und schenkte jedem eine Rippe Schokolade. Am nächsten Tag kam die Mandl mit dem Lagerarzt zur Selektion in unser Krankenrevier. Sie schickte dieselben Mütter mit ihren Kindern ins Gas.
Ich sollte noch einmal von Maria Mandl hören. Eine meiner Kameradinnen, eine Polin aus der Schreibstube, die das Lager überlebt hatte, wurde nach dem Krieg in Krakau von den Kommunisten zum Tode verurteilt. Denn so wie sie gegen die deutschen Besatzer aufgemuckt hatte, wehrte sie sich auch gegen die kommunistischen Unterdrücker.
Das Urteil für die Frau, die drei Jahre Auschwitz überlebt hatte, lautete Tod durch den Strang.
Am Tag vor ihrer Hinrichtung wurde meine Kameradin aus Auschwitz noch einmal in ein Duschbad geführt. Auch die neuen Machthaber sahen auf Ordnung, niemand sollte unsauber ins Jenseits befördert werden. Zugleich mit ihr wurde eine andere Todeskandidatin ins Bad geführt: die Oberaufseherin Mandl. Sie war im großen Auschwitz-Prozess in Krakau ebenfalls zum Tode verurteilt worden. Mandl erkannte den ehemaligen Häftling, und es kam zu folgendem Gespräch:
"Darf ich mit Ihnen sprechen?" "Ja, was wollen Sie von mir?"
"Ich werde morgen sterben, und ich bin froh darüber. Ich bin mir in diesen letzten Wochen bewusst geworden, an welchen Verbrechen ich mitgewirkt habe, und mit dieser Last will ich nicht weiterleben. Ich möchte Sie nur etwas fragen: Können Sie mir verzeihen?"
Meine Kameradin, sie wurde tags darauf zu zehn Jahren Zuchthaus begnadigt, erzählte mir, was damals in ihr vorging: "Ich habe mir gedacht, da sind wir, zwei nackte Weiber, und morgen werden wir beide tot sein. Was soll man da sagen? Also habe ich gesagt: ,Ja, ich verzeihe Ihnen.'"
Das wahre Leben zwischen den Zeilen
Barbaba Tóth in FALTER 51-52/2023 vom 20.12.2023 (S. 27)
Biografien seien entweder indiskret oder langweilig, sagte der kürzlich verstorbene österreichisch-tschechische Politiker Karel Schwarzenberg, deshalb habe er es lange abgelehnt, selber eine zu schreiben. Schwarzenberg, Jahrgang 1937, war ein enger Freund und Wegbegleiter des Journalisten Peter Michael Lingens, geboren 1939. Dieser hat den Rat Schwarzenbergs beherzigt. Seine Memoiren sind durchaus indiskret, daher selten langweilig - wenn auch mit 575 Seiten nicht gerade kurz geraten.
Aber Lingens kann auch aus einem reichen Familien-und Berufsleben schöpfen. Allein die Lebensgeschichte seiner von ihm verehrten Mutter Ella Lingens würde ein ganzes Buch füllen. Die Widerstandskämpferin, Ärztin und in Yad Vashem als "Gerechte unter den Völkern" Ausgezeichnete, hat es auch selber geschrieben ("Gefangene der Angst: Ein Leben im Zeichen des Widerstandes", 2003), Lingens druckt ein Schlüsselkapitel daraus ab, in dem sie den Alltag als Ärztin im KZ schildert.
Lingens verdankt seiner Mutter viel, das ist ihm auch bewusst. Dank ihr wuchs er gut vernetzt in jenem aufgeklärten, sozialistischen, jüdischen Wiener Milieu auf, das in den 1970er und 1980ern Österreichs Modernisierung antrieb. Zuvor erleben wir das Drama eines begabten Kindes, von der Mutter vergöttert, in progressive Schulen geschickt - eines der beeindruckendsten Kapitel erzählt vom Quäkerheim in Neuwaldegg im Wien der Nachkriegszeit -, das in der Adoleszenz nicht so recht weiß, wohin.
Lingens probierte sich in mehreren Studien und Jobs aus, bis er auch dank der Umsicht seiner Mutter letztlich dort landete, wo er seine Intuition und sein Sprachgeschick am besten entfalten konnte: in den Anfängen des kritischen Journalismus in Österreich. Lingens' Name ist untrennbar verbunden mit dem Nachrichtenmagazin Profil und seinem Gründer Oscar Bronner. Er war langjähriger Profil-Chefredakteur, hatte leitende Funktionen in der Wirtschaftswoche und beim Standard inne.
Indiskret und entsprechend saftig geraten dann seine Abrechnungen mit ehemaligen Kollegen und Kolleginnen, den "Hexen" (Lingens nennt seinen Profil-Co-Chefredakteur Gerd Leitgeb als Wortschöpfer). Vor allem die Literaturkritikerin Sigrid Löffler schont er nicht. Überhaupt, Lingens und seine Liebe für "schöne Frauen", seien es seine eigenen, Flirts oder die Frauen seiner Freunde, denen er über die Seiten hinweg Komplimente macht. Auch das Arbeiten mit der mehrheitlich weiblichen Falter-Redaktion -die er als Kolumnist seit 2017 gut kennt - sei für ihn ein "reines Vergnügen, was ich als unverbesserlicher Macho journalistisch wie optisch genieße".
Relevant und treffend hingegen sind Beobachtungen politischer Persönlichkeiten, denen er dank seines Berufes sehr nahe kam, von Bruno Kreisky über Hannes Androsch und Simon Wiesenthal bis hin zu Jörg Haider und Sebastian Kurz. Das sind die interessantesten der insgesamt 84 Kapitel, die dank Personenverzeichnis auch gezielt aufgesucht werden können. Überraschend oberflächlich bleibt seine Auseinandersetzung mit sich in der Rolle als "abwesender Vater", dabei hat er in den Kapiteln zuvor nachdenklich von seinen eigenen Therapieerfahrungen und von der Nichtbeziehung zu seinem Vater erzählt, der seine Mutter verlassen hatte. Leider lassen sich immer wieder auftauchende inhaltliche Redundanzen spätestens ab der Hälfte der Memoiren nicht mehr ausblenden, dazu ärgerliche Tippfehler und Formulierungshoppalas. Eine Persönlichkeit wie Lingens mit solch Erzähl-und Schreiburgewalt hätte sich sicher ein besseres Redigat verdient.