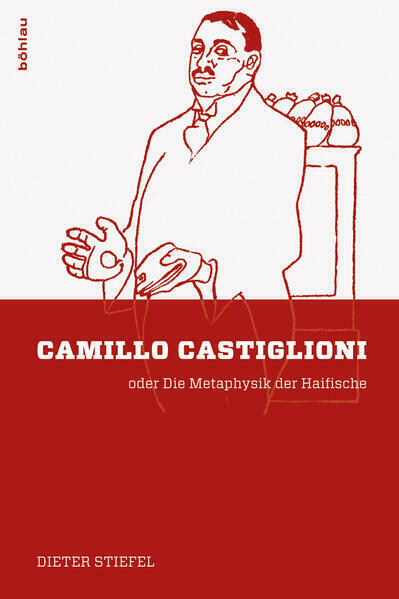Er war überall, wo es etwas zu verdienen gab
Alfred Pfoser in FALTER 41/2012 vom 10.10.2012 (S. 42)
Wirtschaftsgeschichte: Camillo Castiglioni (1879–1957),
das Vorbild heimischer Spekulanten, erhält eine Biografie
Heute ist er weitgehend vergessen, und doch gehört seine Lebensgeschichte, wie jetzt in Dieter Stiefels Biografie nachzulesen, essenziell zur großen Tragödie der Ersten Republik. Camillo Castiglionis Name war einst das Synonym für Börsenspekulation und Betrügereien, für lukrative Devisengeschäfte und brutale Abzocke. Er hat Aktionäre in Abgründe gestürzt, aus der Kronen-Inflation Riesenprofite geschöpft und Firmen in die Pleite geführt, um sie aufzukaufen.
Innerhalb weniger Jahre, von 1919 bis etwa 1924, avancierte Castiglioni zum reichsten Mann Österreichs, kontrollierte mit der Depositenbank eines der mächtigsten Finanzinstitute, war im Besitz der Alpin-Montan, bastelte an einem Automobilcluster Daimler-Fiat-Puch und entwickelte mit dem Konstrukteur Ferdinand Porsche hochfliegende Träume für den Bau eines "Volkswagens".
Sein Hauptbetätigungsfeld war Wien und Österreich, aber er wusste, dass es klug war, sich international zu engagieren, den Geschäftsrayon auf ganz Mitteleuropa auszudehnen. Nach dem Krieg erwarb er sofort die italienische Staatsbürgerschaft, lockte italienisches Kapital nach Österreich, fischte sich die Bayrischen Motorenwerke (BMW) und Brandenburgischen Flugzeugwerke, spekulierte in Paris gegen den Franc, zog während des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz die Fäden zum Aufbau einer Erdölraffinerie.
Castiglioni war hier und dort und überall, wo es etwas zu verdienen gab. Seine Biografie erscheint zur rechten Zeit. Gleichzeitig ist sie ein Beispiel dafür, wie schwierig es ist, über solche Strippenzieher zu schreiben. Sie sind ungreifbar, weil die Aktenlage dürftig ist. Stiefel weicht auf die Zeitungen aus und zitiert ausgiebig – Material ist da ja reichlich vorhanden.
Methodisch ist das problematisch, weil die Zeitungsartikel einander zum Teil widersprechen und oft tendenziös sind. Zeitungsartikel sind kein Beweismaterial. So kann auch Stiefel vieles nicht klären, er muss es bei der Gegenüberstellung von Presseberichten belassen.
Durch Spenden machte Castliglioni sich Politiker gefügig, seine Zuwendungen an christlichsoziale Wahlfonds waren kein bloßes Gerücht. Er diente sich Mussolini an und vertraute auf dessen Interventionen, wenn es in Österreich brenzlig wurde. Er war mit dem steirischen Landeshauptmann Anton Rintelen befreundet, der zuerst beim Heimwehrputsch und später bei der Ermordung von Dollfuß die Fäden zog.
Auch zu den deutschnationalen Industrieeliten verschaffte sich dieser begnadete Netzwerker Zugang: eine Zusammenarbeit mit Hugo Stinnes da, ein Treffen mit Göring dort. Castliglioni kaufte Zeitungen (u.a. das Neue Wiener Journal), um zumindest teilweise eine freundliche Presse zu haben; selbst den linksradikalen Abend spann er in sein Netz der Zuwendungen ein.
Er hatte genug Feinde, aber als die Staatsanwaltschaft zu ermitteln begann und ihm ein Prozess drohte, verschwanden Steuerakten aus dem Finanzministerium, gab es bei behördlich versiegelten Büros eine geheime Tapetentür für die Entwendung von Akten, wurde interveniert, um ihm zwar nicht den Niedergang, so doch den – für so viele unangenehmen – Prozess zu ersparen. Irgendwie kommt einem das bekannt vor.
Mit seinem Temperament war Castiglioni für große, grelle Auftritte bestens geeignet. Beim Marketing griff er auch zu ungewöhnlichen Mitteln: Als die österreichische Armee vor dem Ersten Weltkrieg keine Flugzeuge ankaufen wollte, setzte er sich selbst in eine Maschine, flog im Tiefflug über die Innenstadt, umrundete den Stephansdom und erzwang eine Audienz beim Kaiser.
Sein privates Leben füllte die Klatschspalten: Die Ehe mit dem Burgtheaterstar Iphigenie Buchmann zelebrierte er an schillernden Schauplätzen. Die Villa am Grundlsee, zu der er im ehemaligen kaiserlichen Salonwaggon per Bahn anreiste, und das mondäne Palais in der Prinz-Eugen-Straße 28 (nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen) gaben das Ambiente für einen Renaissancefürsten, der sich mit einer reichen Kunstsammlung umgab. Tout-Vienne verkehrte hier, die Feste waren legendär.
Kulturgrößen bezauberte er als Gastgeber, er spielte für Museen, Universitäten und Theater den Wohltäter, sponserte die Salzburger Festspielte, kaufte gar das Theater in der Josefstadt. Als die Zeitungen über den Konjunkturritter und mutmaßlichen Defraudanten herfielen, rückten Kulturgrößen wie Max Reinhardt oder Richard Strauss aus, um ihm in einem Manifest zu danken und ihn von einem Weggang aus Wien abzuhalten.
Karl Kraus quittierte dies sarkastisch: "Die Kunst gehört den Hyänen."