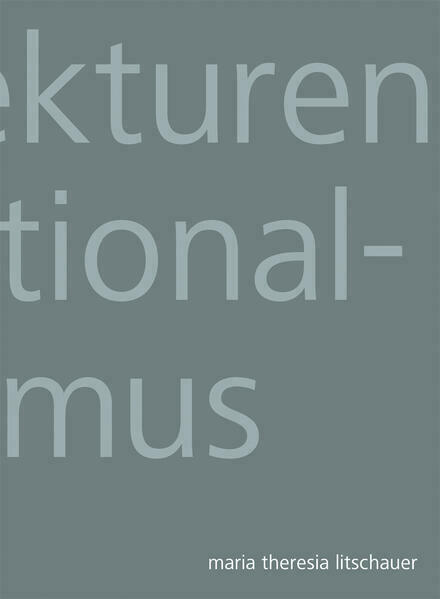Spuren der braunen Moderne
Erich Klein in FALTER 45/2012 vom 07.11.2012 (S. 27)
Kinos, Häuser, Schulen: Ein Künstlerbuch dokumentiert die alltäglichen Bauten der NS-Zeit. Wozu eigentlich?
Hundertsiebenundfünfzig Quadratkilometer Leerraum: Der Truppenübungsplatz (Tüpl) Allentsteig im Herzen des Waldviertels ist einer der größten Europas. In größter Eile unmittelbar nach dem "Anschluss" 1938 "als Aufmarschgelände für die zum Einmarsch in die Tschechoslowakei bereitstehenden Truppen" beschlossen, organisierte die Deutsche Ansiedlungsgesellschaft die Beseitigung von 42 Ortschaften.
Das Vorhaben beschäftigt bis heute die Gemüter. Auf dem renaturierten, seit dem Jahr 1957 im Besitz der Republik befindlichen Terrain forschten in den letzten Jahren Biologen. Der Regisseur Michael Haneke drehte Teile von "Wolfszeit" in der apokalyptisch anmutenden Gegend, der US-Schriftsteller Norman Mailer erging sich 2007 in "Das Schloss im Wald" in kitschigen Tiraden gegen den "Ahnengau des Führers"; Hitlers Vater stammte aus dem dort gelegenen Dorf Strones.
Erst jüngst entschied ein österreichisches Gericht, die Aussiedlung der 7000 Waldviertler falle nicht unter politische Verfolgung. Bei ihren Nachkommen erfreut sich die Nazidokumentation "Die alte Heimat" nach wie vor großer Beliebtheit; sie wird von der Druckerei Berger/Horn nachgedruckt.
Dem Tüpl Allentsteig ist auch ein zentrales Kapitel in Maria Theresia Litschauers monumentaler Studie "Architekturen des Nationalsozialismus" gewidmet. Der sperrige Untertitel lautet: "Die Bau- und Planungstätigkeit im Kontext ideologisch fundierter Leitbilder und politischer Zielsetzungen am Beispiel der Region Waldviertel 1938–1945."
Das rurale Gruselkabinett der Zeitgeschichte im nördlichen Niederösterreich bietet überwachsene Bunkeranlagen, breite Kopfsteinpflasterstraßen samt Wegweiser zu den Schießbahnen, Panzerbrücken, Wohnanlagen im alpinen Blockhausstil mit harmlosen Namen wie "Bozener Siedlung"; seinerzeit für Wehrmachtsoffiziere gebaut, werden sie heute von Soldaten des Bundesheers bewohnt.
Nichts davon gehört zum repräsentativen Pomp à la Albert Speer. Der Künstlerin Maria Theresia Litschauer geht es vielmehr um die alltägliche Bautätigkeit der NS-Zeit, die Errichtung von öffentlichen Einrichtungen und Bauernhäusern bis hin zu Stadtplanung und Industrieanlagen.
In Allentsteig machte sie bemerkenswerte Funde. Die bis vor etlichen Jahren als Alternativkino genutzten "Lichtspiele" dienten seinerzeit der Truppenbetreuung. Von einem Zwettler Naziarchitekten geplant, wurde das Gebäude von der Firma Wenzl Hartl aus dem nahen Echsenbach errichtet, die Arbeiter waren russische Kriegsgefangene.
Bei der Eröffnung des Kinos mit dem Film "Unsterblicher Walzer" im Jahr 1940 erklärte der aus Wien angereiste Vertreter der Reichsfilmkammer: "Wenn Sie ein Kino sehen wollen, wo alles, was es auf dem Gebiet Kino gibt, vorhanden ist, so müssen Sie nach Allentsteig fahren."
Der Bau der Sparkasse Allentsteig folgte auf die "Arisierung" der "Spezerei, Material-, Schnitt und Colonialwaren Handlung" und Vertreibung der jüdischen Familie Kurz. Litschauers Resümee nach dem Lokalaugenschein: "Antike Aufsatzuhren, die heute in den Büroräumen des Gemeindeamtes ganz gegen ihren Dekorationszweck erratisch auf Ablagen zwischen Kanzleiordnern herumstehen, sind ohne Zweifel, abgesehen von in privaten Haushalten zu vermutenden Objekten, Stücke der Sammlung Kurz."
Die Umgebung von Karlstift bis Gmünd, von Drosendorf bis Rosenburg ist nicht weniger ergiebig: Musterhöfe, Grenzhäuser, Molkereien, Schulen, eine Tierkadaververwertung und Hochspannungsleitungen wurden von den Nazis oder für die Nazis gebaut.
Im Fall des Kremser "Gauforums" oder der Hütte Krems sind die "ideologisch fundierten Leitbilder und politischen Zielsetzungen" selbsterklärend. Bei Aufmarschplätzen oder Eisenwerken im Dienste der Kriegsindustrie muss nach dem Geist der Nazis nicht lange gesucht werden. Genügt das aber, um den Albtraum des Tausendjährigen Reiches zu veranschaulichen?
Da liegt das inhaltliche Problem des mit Plänen, Entwurfszeichnungen, historischen und aktuellen Fotos opulent bebilderten "konzeptkünstlerischen Forschungsprojektes", das mehr als nur Regionalgeschichte sein will. Welchen Erkenntnisgewinn bringt die minutiöse stilistische Beschreibung von Wohnanlagen? Oder das Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug, zu dem die Planungen lange vor dem Baubeginn durch die Nationalsozialisten begannen: Stellt das 1959 am Prestigeprojekt angebrachte Nibelungen-Relief – ein läppisches Ornament – tatsächlich braune Barbarei dar? Wollte die Zweite Republik mit oder ohne den Mythos von der Stunde null gen Osten ziehen?
Ein wenig verwunderlich ist auch das Staunen der Verfasserin über die "klaren ästhetischen Prinzipien der Bauhaustradition folgende" Glas-Stahl-Konstruktion des Eggenburger Viktorin-Werks; sie nennt es "avancierte Architektur für den ländlichen Raum".
Natürlich traten die Nazis gegen das Neue Bauen auf und vertrieben berühmte und weniger berühmte Bauhausarchitekten, es gab aber auch Bauhausschüler, die an Konzentrationslagern mitplanten. Und wie verhält es sich mit der verbrecherischen Modernisierung im Nationalsozialismus, der bei der Errichtung seiner Kornspeicher und Lagerhäuser eine internationale Architektursprache benützt, nicht anders als die USA oder die Sowjetunion?
Das größte Rätsel der unzählige Fragen aufwerfenden "Architekturen des Nationalsozialismus" ist schließlich die Feststellung der Autorin, es handle sich bei der "die Medien Schrift und Bild in Montagetechnik diskursiv verbindenden Publikation" um ein "konzeptkünstlerisches Werk". Dies tut der Imposanz der Arbeit zwar keinen Abbruch, weniger hochtrabend hätte es aber auch die Bezeichnung "Dokumentation" getan.