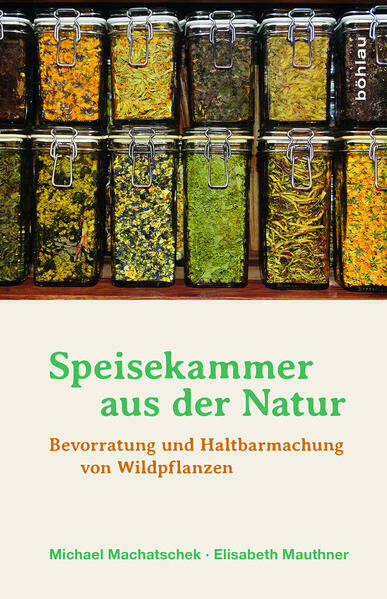Der Geschmack des Holzes
Irena Rosc in FALTER 9/2016 vom 02.03.2016 (S. 51)
Wer über Wurzeln, Rinden und Triebe von Wildpflanzen Bescheid weiß, dem öffnet sich im beginnenden Frühjahr im Wald eine faszinierende Speisekammer. Neue Bücher erklären, wie es geht
Ob auf den Speisekarten der trendigsten nordischen oder Südtiroler Restaurants, ob in ökologischen Manifesten oder in Kulturgeschichten – Holz ist Gegenwart. Wir beginnen wieder, Geschmack an Holz zu finden. Und das Frühjahr ist die beste Zeit, sich durch das Essen von Knospen, Keimen und Trieben der Wildpflanzen etwas von ihrer Vitalität und Kraft zu holen.
Jede Epoche hat ihr eigenes Verhältnis zur Natur, zu Tieren, zu Kräutern und zu Bäumen. Ein Gang durch den Wald kann zu einem Gang durch unsere Geschichte werden, schreibt Alexander Demandt in seiner spannenden Kulturgeschichte des Baumes. Bert Brecht riet dazu, über Bäume zu schweigen und über Untaten zu reden. Demandt kehrt das um. Über nichts wird heute so viel geredet und geschrieben wie über Verbrechen. Deshalb fordert Demandt: Redet über Bäume, damit ihr kein Verbrechen begeht! Solange man über Bäume redet, richtet man kein Unheil an. Aber was, wenn wir von Bäumen nicht bloß reden, sondern sie auch essen wollen?
Zwei Ökologen, die sich mit Holz als Nahrungsmittel befassen, helfen dabei. Der aus dem Salzkammergut stammende Ökologe Michael Machatschek lebt im Kärntner Hermagor und forscht in den Alpenländern. Als Waldläufer kennt er sich aus mit Baum und Laub, mit Gebrauchswissen und fast vergessenen Rezepturen. Als Forscher, Hirte und Senn hat er in jahrelangen Wanderungen, Studien und Gesprächen seine Kenntnisse um das Speisepotenzial heimischer Bäume und Wildpflanzen erworben. Er weiß, was von welchem Baum essbar ist, wofür das Laub geeignet ist, was sich als Ansatz für Liköre eignet, aus welchen Baumteilen Kaffee oder Brotmehlzusätze gemacht werden können, was Tier und Mensch nährt und gesund hält.
Machatschek kennt den Geschmack der verschiedenen Bäume, er kennt die Möglichkeiten, sie zu nutzen, und beschreibt das in seinen spannend zu lesenden und leicht verständlichen Büchern „Laubgeschichten“ und „Nahrhafte Landschaft“. Das Buch „Speisekammer aus der Natur“ hat er mit seiner Lebenspartnerin Elisabeth Mauthner geschrieben. Es liefert beste Tipps, wie wir Wildpflanzen aufbewahren und haltbar machen können. Aber Machatschek geht es um mehr: „Um ein einfaches Leben führen zu können und in Zukunft auch genug zum Essen zu haben, bedarf es einer täglichen Guerillastrategie gegen die Mühlen des Systems. Sie muss auch das Wissen um natürliche Lebensmittel beinhalten und darum, wie man sie herstellt.“
Viel altes Wissen ist in Gefahr, verlorenzugehen. „Fragt man heute auf dem Land Leute, wo man essbare Wildpflanzen finden könne, zucken sie mit den Achseln“, sagt er. Die Menschen kennen die Pflanzen nicht mehr. Andererseits gebe es manche Pflanzen gar nicht mehr, da die meisten Fluren auf höchstem Intensitätsniveau bewirtschaftet werden oder brachgefallen sind. „Beinahe wäre die Lücke zwischen dem einstigen Wissen und dem heute zu groß geworden, beinahe wären die Zusammenhänge zum Gebrauchswissen abgerissen“, sagt Machatschek. Er schließt solche Wissenslücken mit Vorträgen und Kursen. Er tritt gegen oberflächliche Bio-Handhabung auf und will bei Betrügereien die Sache wieder ins Lot bringen. Machatschek ist ein Verrücker oder ein Verrückter, räumt er ein.
„Der Wald als Allgemeingut stand am Beginn unserer Kulturgeschichte“, sagt er. In Krisenzeiten war Holz ein letzter Ausweg. Während großer Hungersnöte streckte man das Mehl zum Brotbacken mit gemahlenen Baumrinden. Der Arzt J.H.F. von Autenrieth gab in der Hungersnot 1816 eine „Gründliche Anleitung zu Brotbereitung aus Holz“ heraus. Um den Sauerteig zu strecken, verwendete man gemahlenes Holz von Birken, Buchen, Fichten, Ulmen oder Ahorn. Durch Wässern, Abkochen und Trocknen entfernte man die Gerb- und Bitterstoffe, die Rinde bekam beim Trocknen am Feuer einen Röstgeschmack und konnte gut vermahlen werden. Das erhaltene Mehl ließ sich als Zutat zu vielen anderen Speisen verwenden.
In wenigen Jahrzehnten, meint Machatschek, könnten Laub oder die Nussfrüchte unserer Bäume den Menschen wieder als Lebensgrundlage dienen. Nebenbemerkung: „Leute, die sich mit den Wildpflanzen ernähren und heilen konnten, waren von den Mächtigen nicht unterdrückbar.“ Er kritisiert auch die Forstwirtschaft, die die Nutzung des Waldes als Speisekammer unterbindet. Das sei nicht nur ökologisch falsch, sondern diene auch dem Zugriff „des Großkapitals auf das im Kleinbesitz befindliche Holz des Bauernwaldes.“
Artur Cisar-Erlach kommt gerade aus dem Lesesaal des Museums für angewandte Kunst, wo er an seinem Buch über den Geschmack des Holzes schreibt. Mit ihm kann man an einem einzigen Nachmittag eine Reise um die Welt zu den ausgefallensten Holzgeschmäckern machen. Nach Gymnasium und Tischlerlehre studierte er in Wien Biologie mit Schwerpunkt Ökologie und schrieb seine Bachelorarbeit über Waldböden und darin lebende Mikroorganismen.
Danach erfüllte sich sein Traum. Er hatte das Glück, an der privaten, im Jahr 2004 von der Organisation Slow Food und den Regionen Piemont und Emilia Romagna gegründeten Universität für Gastronomische Wissenschaften in Pollenzo nahe Bra aufgenommen zu werden. Nur einer von vier Bewerbern schafft das. Dort machte Cisar-Erlach seinen „Master in Food Culture and Communications“. Studenten aus 70 Ländern haben in der kurzen Zeit des Bestehens ein Studium an der Uni abgeschlossen. Die dort entstehenden weltweiten Kontakte zu Gleichgesinnten machen laut Cisar-Erlach einen Großteil der Faszination des Ortes aus. Und die Kantine hat Slow-Food-Gründer Carlo Petrini als die beste der Welt bezeichnet.
Cisar-Erlachs Leben ist von Wäldern geprägt: von denen des Waldviertels, wo seine Familie lebt, und von den Wäldern in Kanada, wo er seine Ferien verbringt. Der Geschmack von Bäumen ist für ihn auch der Geschmack frischen, rauchigen Ahornsirups von kleinen kanadischen Produzenten, die ihn noch in Kesseln zubereiten. „Sobald man von Geschmack redet, muss man auch über Geruch reden“, sagt er und beginnt vom Südtiroler Sarntal zu erzählen, wo sich mehrere Spitzenköche der Latschenkiefer verschrieben haben. Der Koch Gregor Wenter bereitet Safran-Tortellini mit Latschenpesto oder Latschenrisotto mit einzigartig harzig-mediterranem Geschmack zu.
Auf den sauren Böden des Sarntals, bei viel Trockenheit und heißen Sommertagen sowie Schnee und Eis im Winter, entwickelt die Sarner Latsche besondere Kräfte. In der Brennerei von Philipp Eschgfeller wird diese Kraft durch Wasserdampfdestillation in reines ätherisches Öl gebunden. 250 Kilo Nadeln ergeben einen Liter reinsten Öls. Bei Eschgfeller bekommt man Öle aus Wildwuchs mit Bio-Zertifikat nicht nur von der Sarntaler Latschenkiefer, sondern auch von der Zirbelkiefer, der Gebirgslärche, der Gebirgsfichte, der Tanne und vom Wacholder.
Ein Tipp für zu Hause: Das Extrahieren funktioniert gut, wenn man Nadeln oder Holz mit Wasser, Milch, Obers oder Butter aufkocht. In seinem Buch porträtiert Cisar dreißig verschiedene Lebensmittelproduzenten, erzählt die Geschichten ihrer Produkte, die immer auch vom Geschmack des Holzes erzählen. Willi Schmid, Käsemacher aus der Schweiz und einer der größten Meister seiner Zunft, ist einer von ihnen. Seinen Kuhrohmilch-Rotschmierkäse lässt er in frischer Fichtenholzrinde auf Fichtenbrettern reifen. Die ätherischen Öle der Fichte wirken bei der Reifung mit und verleihen dem Käse, der dann auch „Bergfichte“ heißt, die besondere feine Holznote.
Magnus Nilsson, Koch des überaus angesagten schwedischen Restaurants Fäviken, erzählt, wie er mithilfe von Holz einen ganz besonderen, milden und mit leichter Rauchnote versehenen Essig zubereitet. Zuerst wollte er sich ein Fass besorgen, um darin Essig wie Wein oder Sherry reifen zu lassen.
Zu ungeduldig, darauf zu warten, dass ihm ein Fassbinder ein Fass fertigt, holte er mit einem Freund einfach einen Baumstamm aus dem Wald. Die beiden schnitten den Stumpf einer Fichte kurz über dem Boden ab, höhlten ihn mit der Kettensäge grob aus, drehten den Baumstamm kopfüber und brannten die Öffnung mit einem Campingkocher langsam aus.
Den verkohlten Innenraum füllten sie mit Essig und legten als Abdeckung eine Schieferscheibe drauf. Der Baumstamm übernahm die Funktion des Fasses. Nachdem der Baumstumpf monatelang in Nilssons Garage gestanden war, war die Hälfte des Essigs verschwunden. Nilsson füllte den Essig immer wieder auf und wartete ein paar weitere Monate.
Das Ergebnis ist ein besonders milder Essig, der, so Magnus Nilsson, eines der Grundwürzmittel in seinem Restaurant Fäviken Magasinet ist. Das Restaurant befindet sich 600 Kilometer von Stockholm entfernt, hat nur 16 Plätze und zählt zu den besten der Welt. Die Reservierungen für die kommende Saison können am 1. April ab 00.00 Uhr vorgenommen werden.
Heute berühren und schmecken wir wenig Holz in unserem Alltag. Vor dem Kunststoffzeitalter hatten es besonders die Frauen mit verschiedensten Hölzern in der Küche und in der Vorratshaltung zu tun. Holzschüsseln, Holzteller, Holzlöffel, Schneidbretter, die Holzbehältnisse und Holzschaffeln zur Lagerhaltung oder zur Fermentation von Sauerkraut und Rüben, Holzeimer für Milch, Holztröge zum Kneten des Teiges sind nur einige Beispiele. „Doch auch wir berühren mit unserer Zunge immer wieder Holz“, sagt Cisar-Erlach. Das Buchenholz nämlich, das für die Stiele der Eisschlecker verwendet wird.
Bäume gibt es seit 350 Millionen Jahren, lange bevor es Menschen gab. Bäume wird es noch geben, wenn es Menschen und ihre Werke nicht mehr gibt, sagt Alexander Demandt. Schon heute keimen junge Birken in den vom Löwenzahn aufgebrochenen Autobahnen.