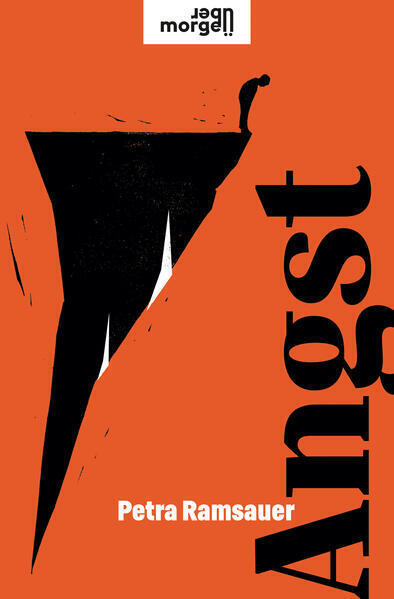Keine Angst vor der Angst
Andreas Kremla in FALTER 51/2020 vom 16.12.2020 (S. 24)
Petra Ramsauer schildert, wie sie mit 144 km/h über die Zufahrt nach Aleppo rast, um den vor der Stadt positionierten Scharfschützen kein Ziel zu bieten; wie sie die dort im Oppositionsgebiet operierenden Ärzte um strikte Anonymität bitten, da sie sonst sofort als „Terroristen“ verfolgt würden. „Erzählen, was ist“, darin sieht die langjährige Reporterin den Sinn ihres Jobs und den Grund, hohe Risiken einzugehen. Erst dadurch würde Krieg greifbar und für den Rest der Welt real. Ihre Berichte aus Krisengebieten liefert sie seit über 20 Jahren an große Blätter wie das Profil, die NZZ oder die Zeit.
Das Grauen krisengeschüttelter Außenwelten bildet nur einen der Fäden, die sie hier zu einem Bild der Angst verwebt. Mit ebenso ehrlicher wie unaufdringlicher Offenheit berichtet sie auch aus ihrer Innenwelt: von ihren eigenen Nöten, rechtzeitig aus gefährlichen Situationen herauszukommen; von dem Moment, als sie beim Umbau ihrer Wohnung in Wien plötzlich glaubte, in einem ausgebombten Haus zu stehen; und von dem Tumor, den sie in noch recht jungen Jahren überlebte.
Zeitgleich mit dem Schreiben dieses Buches hat die Autorin eine Ausbildung zur Traumatherapeutin begonnen. Ein weiterer Strang, dem sie folgt, sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur basalsten unserer Emotionen. Angesichts der Kürze erstaunlich fundiert, zitiert sie aus Untersuchungen zu Angstlust und Katharsis, zu „Sensation Seekers“, die Risiken suchen, um auf ein für sie angenehmes Stimulierungsniveau zu kommen. Sie erklärt das physiologische Alarmsystem der Angst, das weit älter und mächtiger ist als unser rationales Denken, und warum unserem genetischen Programm auch der Mut entspringt, in Krisen etwas Neues zu wagen.
Auch über die ungewöhnlichsten Erfahrungen schreibt Ramsauer in gewöhnlichen Worten und klaren Sätzen. Am meisten Kraft bekommt ihr Buch dort, wo sie die verschiedenen Fäden miteinander verknüpft. Zum Beispiel bei Corona: Wie ein Brandbeschleuniger habe das neue Virus Sorgen und latente Stressfaktoren an die Oberfläche getrieben. Bis zu 2,6 Milliarden Menschen befinden sich zur Entstehungszeit des Buchs gleichzeitig im Lockdown. Aus diesem Krisengebiet ist keine Rückzugsmöglichkeit in Sicht: „Meine beiden Welten, die ich hier zuerst als fein säuberlich getrennt in das „sichere“ Europa und die unberechenbaren Krisengebiete beschrieb, berührten sich plötzlich.“
Womit Ramsauer einen weiteren Erzählstrang eröffnet: Ihre Gedanken zur Macht der Angst. Freiheit und Furcht erkennt sie als ewige Gegenspieler, sowohl im privaten wie im öffentlichen Leben. Die Fähigkeit, mit der Angst zu leben, sei daher entscheidend für den Grad an Freiheit. Im Politischen führt das zur Frage, wie viel Angst Regierende einsetzen dürfen, um die Regierten zur Einhaltung von Maßnahmen zu bewegen.
Was passiert, wenn Politik zu viel Angst macht, zeigen die Zahlen aus den USA: In der Ära Trump stieg die Prävalenz von Angststörungen auf das Doppelte. Überhaupt zeige die Pandemie die „Sollbruchstellen unserer Welt“: Dreimal häufiger als Weiße sind in den USA Afroamerikaner und Latinos mit dem Virus infiziert – Menschen, die auf engem Raum arbeiten und wohnen.
Die Ängstlichsten sind meist nicht Menschen in Gefahr, sondern jene, die sie mit allen Mitteln vermeiden. Die große Warnung der krisengeprüften Journalistin gilt der Angst vor der Angst. Denn daraus entstünde ein Kreislauf aus Vermeidung und ständiger Ängstlichkeit, der letztendlich auch einer Politik der Angst den Boden bereite. Menschen, die in Krisen den Mut haben, etwas zu bewegen, seien jene, die sich ihrer Angst stellen und dadurch handlungsfähig bleiben. „Angst, finde ich, sollte ein ungelebtes Leben machen, nicht der Tod.“