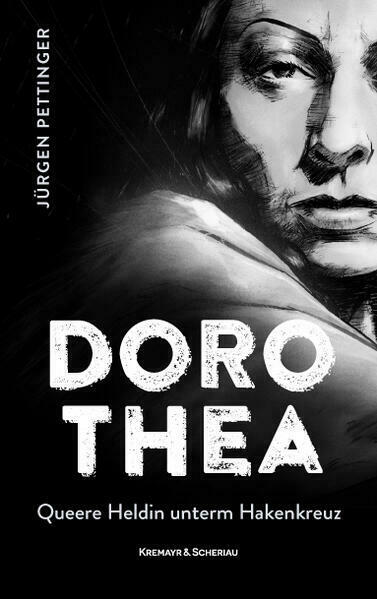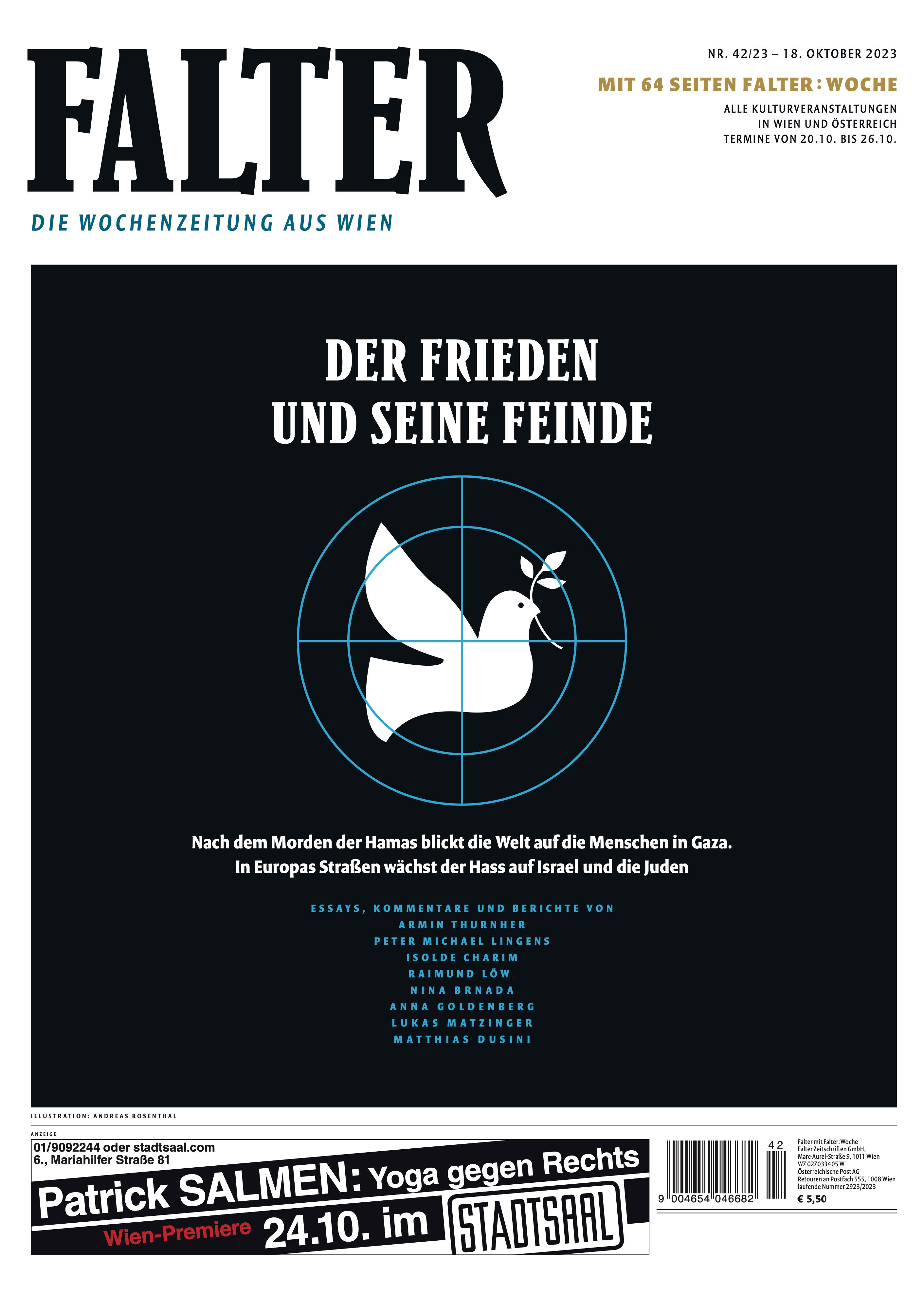
„Du gehst nirgendwo hin. Du tauchst bei mir unter“
Donja Noormofidi in FALTER 42/2023 vom 18.10.2023 (S. 36)
Lilli Wolff hat sich im Kaminschacht in der Wand versteckt, hinter dem prachtvollen Kachelofen. Sie hört jedes Wort, das draußen gesprochen wird. Umgeben von Ruß kann sie sich kaum rühren und darf keinen Mucks machen, schon gar nicht niesen. Draußen im Wohnzimmer empfängt ihre Freundin Dorothea Neff Gäste. Als alleinstehende Schauspielerin ohne Ehegatten muss sie zeigen, dass sie ein pflichtgetreues Leben führt. Die Leute reden ohnehin schon hinter ihrem Rücken. Aber keiner darf wissen, dass Lilli auch da ist. Sie ist Jüdin, und unter dem Nazi-Terror kann man keinem Menschen trauen.
In „Dorothea. Queere Heldin unterm Hakenkreuz“ erzählt der ORF-Journalist und Autor Jürgen Pettinger die Geschichte der bekannten Schauspielerin Dorothea Neff, die in der Wiener Annagasse 8 ihre jüdische Freundin Lilli Wolff vor den Nazi-Schergen versteckte. Beide waren aus Deutschland nach Österreich gekommen „und hatten mit einer gewissen österreichischen ,Aufgelockertheit‘ gerechnet“. Doch sie werden bald enttäuscht. Lilli, ehemals erfolgreiche Modeschöpferin in Köln, muss bald in ein Sammelquartier für Juden umsiedeln. Als das Quartier geräumt werden soll, meint Dorothea entschieden: „Du gehst nirgendwohin. Du tauchst bei mir unter!“ Mehr als drei Jahre lebt Lilli Wolff so im Verborgenen, unter ständiger Angst, entdeckt zu werden.
Pettinger legt mit „Dorothea“ bereits das zweite Buch zum Thema vor. In „Franz. Schwul unter dem Hakenkreuz“ erzählte er die Geschichte des jungen Franz Doms, der von den Nazis als homosexueller Mann verfolgt und hingerichtet wurde. Der Journalist will in seinen Büchern zeigen, dass queere Menschen nicht nur Opfer des Nazi-Terrors waren, sondern auch Helden, die viel riskiert haben, um anderen zu helfen: „Queere Menschen sollen erkennen, dass wir selbst eine Geschichte und Helden haben, auf denen wir aufbauen und auf die wir stolz sein können.“
Wie schon für „Franz“ recherchierte Pettinger auch für „Dorothea“ akribisch die historischen Hintergründe, spürte alte Tonaufnahmen und Fotos auf, von denen einige im Buch abgebildet sind. In der Romanbiografie habe er versucht, „möglichst wenig zu fiktionalisieren“.
Er besuchte sogar die Wohnung in der Annagasse 8, in der Dorothea Lilli Wolff versteckte und die heute noch existiert, um sich einen realistischen Eindruck vom Ausblick zu verschaffen. Zu allem Überfluss waren in die Wohnung auf der anderen Hofseite ein SS-Mann und seine Frau eingezogen, eine der Sekretärinnen des Gauleiters Baldur von Schirach.
Die aufwendige Recherche hat sich gelohnt: Pettinger verleiht seinen Protagonistinnen eine Stimme und führt die Leser direkt in das Grauen der Nazizeit in Wien, in die Gassen und Luftschutzkeller. Die Angst und die Beklemmung der beiden Frauen werden förmlich spürbar. Bei jedem Schritt auf der Treppe fürchten Dorothea und Lilli, dass die Nazis sie entdeckt haben. Jeder Nachbar, jeder Kollege am Volkstheater, wo Dorothea zunächst noch auftritt, könnte ein Verräter sein.
Entdeckt zu werden, hätte für beide den sicheren Tod bedeutet. Dazu kommt der Hunger. „Lilli war ein Geist geworden. Sie existierte, aber niemand außer Dorothea konnte sie je sehen. War Besuch in der Wohnung, versteckte sie sich, war sie alleine, musste sie sich tot stellen.“ Als Lilli ernsthaft krank wird und ins Krankenhaus muss, scheint die Lage aussichtslos. Wäre da nicht der Nachbar, ein Medizinstudent namens Erwin Ringel.
Andreas Brunner, Co-Leiter von „QWIEN – Zentrum für queere Geschichte“, liefert im Vorwort den historischen Rahmen: Queere Menschen wurden vor, während und nach der NS-Zeit strafrechtlich verfolgt, homosexuelle Liebe wurde totgeschwiegen. Zur Zeit des Nazi-Terrors war Dorothea Neff doppelt bedroht: „Einerseits hätte die Aufdeckung ihrer gleichgeschlechtlichen Beziehung weitreichende Folgen haben können – Kerkerhaft, Verlust ihres Engagements am Volkstheater, aber auch Ächtung durch jedes andere Theater im gesamten Reich und damit verbunden sozialer Ausschluss und Abstieg. Noch schwerwiegender wäre aber das Verbrechen der ,Rassenschande‘ gewesen, denn Beziehungen zwischen ,Arier:innen‘ und Juden und Jüdinnen waren nach den nationalsozialistischen Rassegesetzen verboten.“
Auch nach dem Krieg dauerte es ewig, bis Homosexuelle als Opfergruppe anerkannt wurden: Erst im Jahr 2005 wurden sie offiziell ins Opferfürsorgegesetz aufgenommen. Pettinger erzählt in seinem Buch eine lesenswerte Heldinnengeschichte, auf die neue Generationen sehr gut aufbauen können.