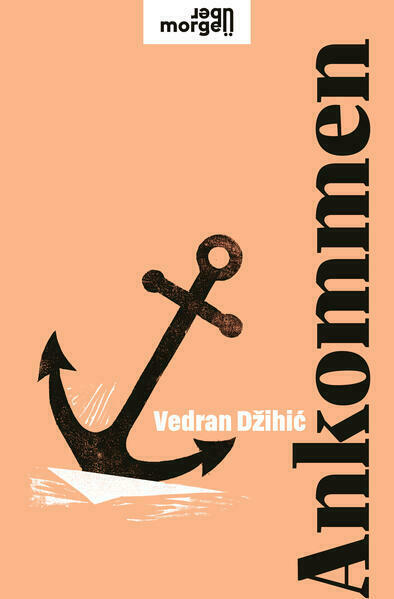Wenn der Krieg kommt
Stefanie Panzenböck in FALTER 38/2024 vom 20.09.2024 (S. 29)
Sein Vater nahm ihn an der Hand. Dann ging der damals 19-jährige Vedran Džihić die Treppe zum Eingang des Hauptgebäudes der Universität Wien hinauf. "Ich habe den Coolen gespielt, aber innerlich gezittert", erzählt er heute. Was würde ihn im Studium erwarten? Und würde er, der Flüchtling aus Bosnien und Herzegowina, den Anforderungen gewachsen sein?
Vedran Džihić, Jahrgang 1976, ist Politikwissenschaftler und seit vielen Jahren einer der gefragtesten Experten für Südosteuropa, vor allem für das ehemalige Jugoslawien. Heute steht er oben an der Treppe und schaut hinunter, auf den Platz vor der Universität, wo er damals mit seinem Vater stand. "Dass mein Vater mich in diesem Moment unterstützt hat, war für mich sehr wichtig", sagt Džihić. Gesten wie diese seien nicht nur innerhalb einer Familie von großer Bedeutung, sondern für die Gesellschaft als Ganzes. "Ohne sie gibt es keine Zwischenmenschlichkeit und somit auch keine funktionierende demokratische Gesellschaft."
Damals, im Herbst des Jahres 1995, ging gerade der Krieg in Bosnien und Herzegowina zu Ende, der im Frühjahr 1992 begonnen hatte (siehe Marginalspalte). 100.000 Menschen waren getötet, mehr als zwei Millionen aus ihrer Heimat vertrieben worden. 700.000 Bosnierinnen und Bosnier flohen ins Ausland. Anfang Jänner 1993 flüchtete die Familie Džihić aus Prijedor im Nordwesten des Landes nach Österreich.
Mehr als drei Jahrzehnte später hat Vedran Džihić in seinem neuen Buch "Ankommen" einen für Wissenschaftler ungewöhnlichen Zugang gewählt. Er verbindet seine eigene Geschichte mit der aktuellen politischen Debatte, in der Menschen mit Migrationshintergrund immer mehr zu Sündenböcken für all das werden, was in der Gesellschaft schiefläuft. Džihić geht es darum, seine eigenen Erfahrungen als Beispiel zur Verfügung zu stellen: Was passiert, wenn der Krieg kommt? Was bedeutet es, aus seiner Heimat vertrieben zu werden und zum Flüchtling zu werden? Was braucht es, damit das Ankommen in einem neuen Land gelingt?
"Der Krieg kommt immer in kleinen Schritten", schreibt Džihić. Und kurz darauf: "Der Krieg kommt dann immer mit seiner ganzen Wucht über uns alle." Das sei nur scheinbar ein Widerspruch, erklärt er im Gespräch. Mit dem Falter hat er sich im großen Hof der Hauptuniversität getroffen. Es ist kalt geworden und der Wind pfeift durch die Arkadengänge. "Bevor einem der Krieg nicht passiert, kann man ihn nicht nachvollziehen", sagt er. Und versucht dennoch, das Unfassbare zu beschreiben. Anhand seiner Erfahrungen zeichnet er die Mechanismen des Krieges und der Flucht nach.
Vedran Džihić wächst in der 65.000-Einwohner-Stadt Prijedor in Bosnien und Herzegowina auf. Er lebt mit seinen Eltern und seinem Bruder in einer Großsiedlung im fünften Stock eines Hochhauses. "Ich habe sehr warme Erinnerungen", sagt Džihić. Viele Kinder, große Freiheit. In der Wohnung war man nur zum Essen und Schlafen.
Džihićs Vater kam aus einer muslimischen Familie, die Mutter wuchs als Angehörige der ukrainischen Minderheit auf. Beide waren Atheisten und glaubten an das Versprechen des jugoslawischen Machthabers Tito, dass ein "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" möglich sei.
Obwohl im Nachbarland Kroatien bereits im Frühjahr 1991 der Krieg ausgebrochen war, waren viele Menschen in Bosnien und Herzegowina überzeugt, dass es ihr Land nicht treffen würde. Vor dem Krieg deklarierten sich zwar 43,7 Prozent als Bosniaken, also muslimische Bosnier, 31,4 Prozent als orthodoxe Serben und 17,3 Prozent als katholische Kroaten. Doch für die Zugehörigkeit des anderen interessierte man sich in der Regel kaum.
"Plötzlich ist mein bester Freund mit Symbolen der Četniks, der nationalistischen Serben, herumgerannt", erinnert sich Džihić. "Er sagte zu mir:'Euch machen wir fertig, genauso, wie wir die Kroaten fertiggemacht haben.'" Džihić war damals 16. Die Bemerkungen nahm er nicht ernst. Auf dem Schulweg standen nun Soldaten an neu errichteten Checkpoints. Muslimische und kroatische Lehrer verschwanden aus den Klassenzimmern, nur die serbischen blieben.
Vom Balkon aus sah Džihić ein nahegelegenes Dorf brennen. Am nächsten Tag lagen Leichenteile auf der Straße. Am 31. Mai 1992 forderten die serbischen Behörden alle Nichtserbinnen und -serben auf, weiße Leintücher aus dem Fenster zu hängen. Wer das Haus verlassen wollte, musste eine weiße Armbinde tragen. Die Botschaft war deutlich: "Du darfst leben und du nicht, du bist der Andere, du musst sterben, dich beugen, egal, was wir mit dir anstellen mögen", schreibt Džihić.
Das Essen reichte kaum noch, Strom und Wasser wurden immer wieder abgeschaltet. Zur Angst kam der Überlebensinstinkt. Die Erwachsenen suchten nach Grundwasser und installierten auf dem Areal der Siedlung Pumpen.
In der Nacht verschwanden Menschen. Die serbische Polizei führte Männer ab und brachte sie in eines der drei Lager, die es mittlerweile in und um Prijedor gab.
Knapp 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs standen wieder Konzentrationslager auf europäischem Boden. Die Fabrik Keraterm in Prijedor wurde zu einem solchen umfunktioniert. 3000 Bosniaken und Kroaten waren dort inhaftiert, 300 von ihnen wurden getötet. Im Dorf Omarska errichteten die Behörden ein weiteres Lager, in dem zwischen 5000 und 7000 Personen gefangen gehalten wurden, 400 bis 500 von ihnen kamen ums Leben. Auch im dritten Lager, das sich im Dorf Trnopolje, dem Heimatort von Džihićs Eltern, befand, töteten die serbischen Machthaber zahlreiche Gefangene.
Im Sommer 1992 schafften es britische und US-amerikanische Journalisten, zu den Lagern vorzudringen. In seiner Ausgabe vom 17. August 1992 zeigte das Time-Magazin einen ausgemergelten Mann hinter Stacheldraht auf dem Titelblatt. Der internationale Druck half, Omarska und Keraterm wurden geschlossen, doch Trnopolje blieb. Vedran Džihićs Großvater und zwei Onkel wurden dort gefangen gehalten.
Die Täter waren Nachbarn, Freunde, Bekannte. Es habe auch Serben gegeben, die sich wehrten und helfen wollten. "Aber die Mehrheit hat mitgemacht."
Dass Menschen, die nicht Serben waren, vertrieben, gefoltert, vergewaltigt und getötet wurden, war Teil der "ethnischen Säuberung", ein euphemistischer Begriff, der auch heute noch in Anführungszeichen für die Verbrechen verwendet wird. Erfunden haben den Begriff die Täter selbst. "Akcija čišćenja" -"Säuberungsaktion" nannten sie ihre systematischen Grausamkeiten.
Džihićs Mutter brachte, wenn es möglich war, Essen zu den Verwandten ins Lager. Die zehn Kilometer dorthin ging sie zu Fuß oder fuhr mit dem Fahrrad. Was sie dort sah, darüber sprach sie kaum.
Die Jugendlichen suchten Schlupflöcher, um sich der neuen Realität entgegenzustellen. Džihić und seine Freunde provozierten serbische Soldaten, die nach der Polizeistunde patrouillierten, bewarfen sie mit Steinen. Ein Nachbar, der gerade von der Front zurückgekehrt war, schoss mit einer Kalaschnikow von seinem Balkon. Dann schmiss er eine Handgranate. Sie explodierte. "Er hätte uns treffen können, aber wir waren gut versteckt. Der Grat zwischen Leben und Tod war sehr schmal."
Anfang Jänner 1993 flüchtete die Familie Džihić aus Prijedor. Um Plätze in den sogenannten humanitären Konvois zu ergattern, die die serbischen Behörden mit dem Internationalen Roten Kreuz organisierten, mussten sie nicht nur viel Geld zahlen, sondern auch schriftlich bestätigen, dass sie auf ihren gesamten Besitz verzichteten. Die Wohnung, Bücher, Schmuck, alles gehörte von nun an den neuen Machthabern.
In den Taschen, die die Familie an diesem Wintertag aus dem Haus trug, befanden sich neben Kleidung und Hygieneartikeln zwei Wörterbücher, eines für Deutsch, eines für Englisch. Der Vater hatte sie eingepackt.
Džihić drehte sich noch einmal um, bevor er in den Bus stieg. Er sah den Park, der zwischen den Hochhäusern der Siedlung angelegt worden war, und den Hang, den sie mit den Schlitten hinuntergesaust waren. Die Soldaten trieben die Leute in den Bus, zwei stiegen mit ein. Die Gewehre hielten sie im Anschlag. "Als wir Prijedor verließen, war die Stadt nicht mehr unsere. Am Ende des Krieges wird man 3167 getötete Menschen in Prijedor zählen, darunter 102 Kinder. Wir waren nicht darunter. Wir wurden zu Flüchtlingen", schreibt Džihić.
Auf dem Weg nach Kroatien passierte der Bus unzählige Checkpoints. "Wir mussten zahlen, damit wir durchfahren durften. Am Ende hatten sie den Leuten ihr ganzes Geld abgenommen." 40 Kilometer, 15 Stunden Fahrtzeit. Am letzten Checkpoint wurde der Vater aus dem Bus geholt. "Diesen Moment werde ich nie vergessen", sagt Džihić. "Was passiert jetzt? Wird er verhaftet? Erschossen?" Doch er kehrte zurück, und der Bus fuhr ohne die serbischen, dafür nun mit Uno-Soldaten über die Grenze.
Zwei Wochen später stand die Familie vor den Toren des Flüchtlingslagers Traiskirchen. "Ich habe gespürt, dass wir in Sicherheit sind. Wir mussten nicht mehr um unser Leben fürchten. Gleichzeitig standen wir vor dem Ungewissen", erinnert sich Džihić. "Diese Mischung aus Gefühlen wird man nie wieder los." Was diese Verunsicherung für das weitere Leben bedeute, wolle er in seinem Buch nachvollziehbar machen. "Du hast gesehen, dass Menschen umgebracht werden. Du hast gemerkt, dass das Leben nichts wert ist. Das Urvertrauen in die Welt ist weg. Und das muss man langsam, Schritt für Schritt wieder aufbauen."
Ist ein Neuanfang möglich, nach all dem, was man durchgemacht hat?
Džihićs Mutter erhielt die Familie am Leben. Während des Krieges in Prijedor versorgte sie die Verwandten im Lager, in Österreich brachte sie das Geld nachhause. "Zuerst wusch sie Teller, dann Autos, lernte Deutsch, arbeitete als Putzfrau und schließlich wieder als Buchhalterin, also in ihrem ursprünglichen Beruf", erzählt Džihić. "Als sie erfuhr, dass Mitglieder ihrer Familie im Krieg erschossen worden waren, weinte sie zwei Tage. Am dritten Tag machte sie sich wieder auf Jobsuche."
Der Vater zog sich zurück. "Als der Krieg kam, stand er mitten im Leben, er hatte studiert und Karriere gemacht." Dann war die Heimat weg, die Wohnung, das Ansehen, das Land, an das er geglaubt hatte. Er kümmerte sich von nun an um den Haushalt und die beiden Söhne. In Traiskirchen drückte er ihnen die Wörterbücher in die Hand und hielt die Kinder an, zu lernen.
"Für meinen Bruder und mich konnte das Leben weitergehen", sagte Džihić. "Wir standen noch am Anfang, hatten noch Raum, die Dinge zu verarbeiten, und Kraft, etwas Neues zu beginnen."
Džihić weiß, was es heißt, willkommen zu sein, aber auch, wie schmerzhaft es ist, abgelehnt zu werden, weil man "der Andere" ist. Als er seine ersten Deutschvokabel lernte, begann eben der Eintragungszeitraum für ein Volksbegehren der FPÖ, "Österreich zuerst". Die Botschaft, vor allem an jene Menschen, die gerade dem Krieg in Ex-Jugoslawien entkommen waren, war unmissverständlich: Wir wollen euch hier nicht.
Džihić und sein Bruder kauften auf Anraten des Vaters jeden Sonntag Kronen Zeitung und Kurier, um ihr Deutsch zu verbessern. Sie strichen Sätze an, schlugen im Wörterbuch nach. Die Berichte über das Volksbegehren verstörten sie. "Unseretwegen gab es dieses Volksbegehren, weil wir nicht da sein sollten."
Doch nicht nur die beiden Brüder im Flüchtlingslager waren irritiert. Weite Teile der österreichischen Gesellschaft lehnten sich gegen die Politik der FPÖ auf. Die NGO SOS Mitmensch wurde gegründet, und am 23. Jänner strömten auf dem Wiener Heldenplatz 300.000 Menschen zusammen, um ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit zu setzen, das "Lichtermeer". "Diese Bilder waren überwältigend und herzstärkend."
In Traiskirchen selbst kümmerte sich die NGO Helping Hands um die Flüchtlinge. Die Mitarbeiter organisierten Deutschkurse und gingen mit den Jugendlichen ins Kino.
Im September 1993 begann wieder der Schulalltag. Die Brüder hatten Plätze am Gymnasium in Eisenstadt bekommen. "Ein paar Buben aus meiner zukünftigen Klasse haben mich zum Klassenzimmer begleitet", erinnert sich Džihić. "Wir standen auf dem Gang, und ich habe versucht, in meinem gebrochenen Deutsch einen Scherz zu machen -und sie haben tatsächlich gelacht."
Sein Banknachbar ist noch heute ein guter Freund, ein Bursche aus der Nebenklasse nahm Džihić mit in die Bibliothek. "Du musst Goethe lesen, hat er mir geraten. Also habe ich mir 'Die Leiden des jungen Werther' ausgeborgt und mich durch den Goethe gequält."
Über den Sportlehrer kam Džihić in den Basketballverein, und langsam wurde die große Sorge, wie es weitergehen könnte, abgelöst von alltäglichen Fragen: Welche Hefte brauche ich für Mathe, was muss ich für den Biotest lernen? Jörg Haider hatte in Džihićs Klasse keine Fans. "Das hat mein Bewusstsein für die Gegensätze in einer Gesellschaft geschärft."
Im Sommer 1995 maturierte Džihić in Eisenstadt, in Deutsch schaffte er ein Gut. "Die Matura war ein erstes großes Aufatmen. Aber nur für zwei Minuten. Denn dann sagte mein Vater: Jetzt kommt aber das Studium. Nach dem Magister hieß es: Ja, das ist super, aber ein Doktortitel wäre auch noch wichtig." Heute ist Džihić Senior Researcher am Österreichischen Institut für Internationale Politik, lehrt an der Universität Wien und in Washington, D.C. Und er gründete den Verein Ariadne -Wir Flüchtlinge für Österreich. Menschen mit Fluchterfahrung helfen Flüchtlingen, die gerade neu ankommen.
Džihić plädiert in seinem Buch für mehr Empathie. Für Gesten der Hinwendung und einfache Hilfen im Alltag. "Diese Gesten auf der individuellen Ebene brauchen dann auch Entsprechungen auf einer gesellschaftlichen Ebene. Man kann Flüchtlinge ablehnen, an den Rand drängen und sie stigmatisieren. Man kann aber auch davon ausgehen, dass sie Menschen sind wie wir, ihr Leben gestalten und Verantwortung übernehmen wollen."
Die große Mehrheit der Migranten, da ist sich Džihić sicher, sieht Österreich als ihre neue Heimat an. "Die meisten akzeptieren unsere Regeln. Für die, die das nicht tun, gibt es den Rechtsstaat."
"Ankommen" erscheint zum richtigen Zeitpunkt. Am 29. September wählt Österreich einen neuen Nationalrat, Migration, Asyl und Integration sind zentrale Themen im Kampf um Wählerstimmen.
In den letzten Wochen kam es vermehrt zu islamistisch motivierten Anschlägen. Außerdem stieg die Anzahl der rechtsextremen Straftaten. Die Angst in der Bevölkerung wird größer.
Wie kann eine Gesellschaft funktionieren? Džihić verwendet das Bild der Agora, des zentralen Platzes, auf dem Menschen zusammenkommen, um zu reden, zu feiern und zu debattieren. "In der Agora braucht es Zugewandtheit zum Mitmenschen, damit Gespräch und Freundschaft entsteht. Welches Ausmaß an Freundschaft brauchen wir?", fragt Džihić. "Wenn jemand kommt, der mit Gewalt droht oder sie ausübt, dann kann er nicht Teil dieser Gemeinschaft sein. Wir können nicht mit jemandem befreundet sein, der ein radikaler Gegner von allem ist, was uns wichtig ist. Aber all den anderen, der großen Mehrheit der Menschen, soll man zugewandt sein, man soll mit ihnen die Freundschaft pflegen. Und wenn man aufhört das zu tun, bricht das Gespräch ab und man erstickt das demokratische Element."
Zum Beispiel mit dem Konzept der "Remigration", das über die rechtsextreme Identitäre Bewegung in die Debatte gekommen ist. Ein Begriff, der eigentlich freiwillige Rückkehr meint, wird hier als Euphemismus für Deportation und Massenabschiebung von Menschen verwendet, die etwa "nicht deutsch genug" sind. "Wenn man anfängt, Grundrechte und Menschenrechte auszuhebeln, dann ist es die Hölle auf Erden für alle. Nicht nur für Flüchtlinge und Migranten", warnt Džihić.
Wann hört das Ankommen auf? Und tut es das jemals? In seinem Buch schreibt Džihić: "Angst und Wunden der Vergangenheit bleiben für immer. Ich frage mich bis heute immer wieder, ob ich jemals ankommen werde." Džihić plädiert für ein Ankommen, das nicht nur Assimilation bedeutet. "Österreich ist meine zweite Heimat, und ich bin hier auch zuhause. Dennoch behalte ich meine bosnische Identität."
Auch Džihićs Vater hat seine Erfahrungen als Flüchtling zu Papier gebracht und begonnen, einen Roman zu schreiben. Er konnte ihn nicht beenden, doch sein Sohn will ihn eines Tages veröffentlichen. Einige Kapitel sind schon fertig. Das erste endet mit dem Satz: "Es gibt aber keinen Flüchtling, der nicht hofft, dass er eines Tages nicht mehr Flüchtling sein wird."