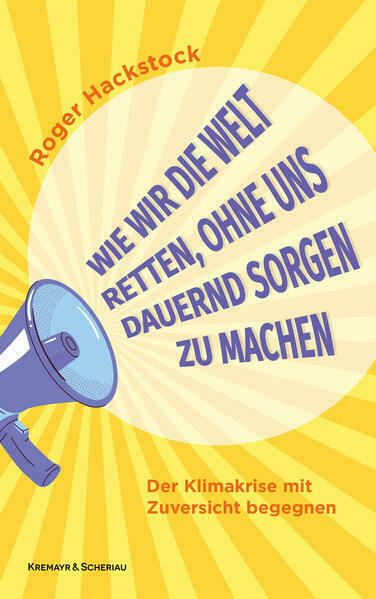Erderwärmung: Genug geraunzt!
Peter Iwaniewicz in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 36)
Roger Hackstock hat nicht nur viel Zeit in seinem Berufsleben in verschiedenen Institutionen des Klima- und Umweltschutzes verbracht, sondern offenbar auch sehr viel Freizeit im Kabarett. Und so beginnt auch das Buch mit humorvollen Szenen. Er zitiert dabei unter anderem aus dem Programm „Das jüngste Gesicht“, in dem Christoph Fritz die Frage stellt, ob das Publikum wisse, dass es inmitten der Klimakrise immer noch Tiere gibt, die jeden Winter mehrere tausend Kilometer in Richtung Süden fliegen. Dieser gibt sich dann selbst in seiner typischen schüchtern-trockenen Art die Antwort: „Die machen das, um Urlaub zu machen. Da frage ich mich schon, können die nicht Bahn fahren? Die heißen doch sogar Zugvögel.“
In seinem Buch mit dem programmatischen Titel „Wie wir die Welt retten, ohne uns Sorgen zu machen“ will er laut Untertitel „Der Klimakrise mit Zuversicht begegnen“. Nach zwei Jahrzehnten der sich verdichtenden apokalyptischen Narrative erscheint dies wie ein rettender Zweig, an dem wir uns aus dem Sumpf der Hoffnungslosigkeit ziehen können.
Hackstock ist Technologie- und Klimaexperte und Geschäftsführer des Verbands Austria Solar, der durch – oder gerade wegen – seiner Berufserfahrungen zur Ansicht gekommen ist, dass man mit Humor Blockaden lösen kann und dies besser als jede Moralpredigt wirkt. Gute Stimmung hilft seiner Erfahrung nach, uns für Alternativen zu öffnen, die es anzupacken gilt, um die Klimakrise zu überwinden. In der Geschichte der Menschheit wären während der ärgsten Katastrophen immer dann Witze gerissen worden, wenn man nicht mehr weiterwusste. Ganz im Sinn eines Alfred Polgar zugeschriebenen Zitats: „Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.“
Davon erzählt er dann auch im Weiteren und zeigt dies anhand vieler popkultureller Beispiele. Was am Anfang des Buchs noch bewitzelt wurde, wird dabei durchaus ernsthaft und auch ernst aufgezeigt. Hackstock reflektiert die gesellschaftlichen Widerstände gegenüber transformativen Prozessen und entlarvt dabei die Widersprüchlichkeiten und Beharrungskräfte, die eine adäquate Reaktion auf die Klimakrise erschweren. Seine Analyse geht über eine bloße Problemdiagnose hinaus und zeichnet sich durch eine feinsinnige Verbindung aus psychologischen, soziologischen und ökonomischen Aspekten aus.
Im Kapitel „Wirtschaft neu denken“ setzt er sich kritisch mit der vorherrschenden Vorstellung auseinander, technologischer Fortschritt allein könne als Heilsversprechen fungieren, und zeigt Möglichkeiten postkapitalistischer Wirtschaftsmodelle auf. Das klingt zwar weniger lustig, aber sein lockerer, in Ich-Form gehaltener Erzählstil ist frei von jeder Lehrbuchhaftigkeit. Statt der von ihm angeprangerten gängigen Lähmung durch Fatalismus und Resignation propagiert er ein Utopietraining, das nicht belehrt, sondern neugierig macht und einlädt, sich die Welt, in der man lebt, einmal anders vorzustellen.
Zwar können Satire und Ironie als Mittel der Bewusstseinsbildung durchaus wirksam sein – aber vielleicht ist im 21. Jahrhundert nicht mehr Religion das Opium des Volks, wie Karl Marx meinte, sondern Humor, der durch Auflösung des Problemstaus die Tendenz zur Verharmlosung fördern könnte. In diesem Buch besteht diese Gefahr jedoch sicher nicht. Hackstocks belesener Überblick zur Geschichte der nachhaltigen Entwicklung, sein interdisziplinärer Ansatz und seine analytische Schärfe machen das Werk zu einer inspirierenden Lektüre für all jene, die sich nicht mit Resignation abfinden wollen.
Wer nach konstruktiven, aber zugleich kritischen Perspektiven auf die Klimakrise sucht, wird in diesem Buch nicht nur wertvolle Denkanstöße finden, sondern auch Hoffnung darauf, dass wir unsere Zukunft erfolgreich gestalten können.