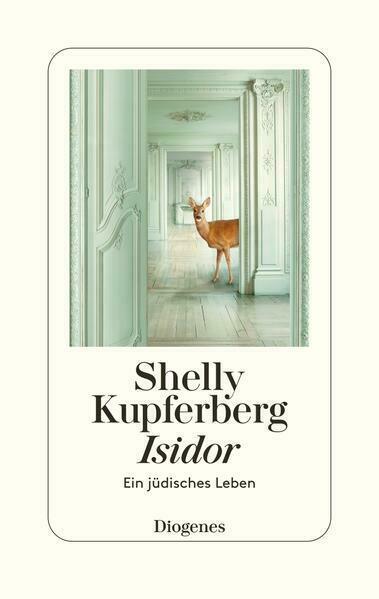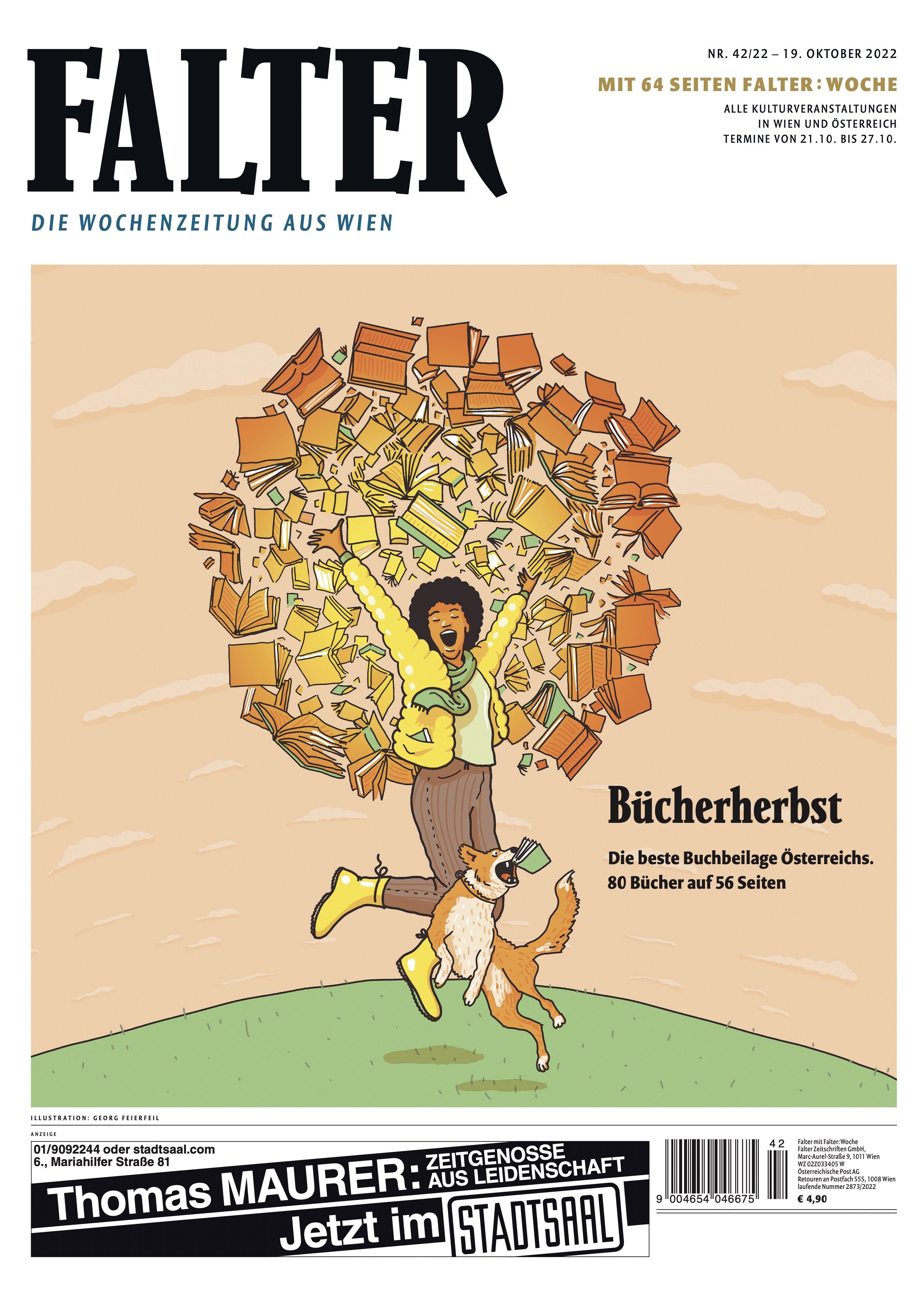
Nur eine Schachtel mit Silberbesteck
Thomas Leitner in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 44)
Einen üppigen Besteckkasten nebst ein paar wenigen Briefen und Dokumenten: Das konnte Shelly Kupferberg von ihrem Urgroßonkel noch aufspüren. Sie fand ihn auf dem Dachboden ihres Großvaters. „Isidors in roten Samt gebettete Silbergarnitur ist das Einzige, was sich aus dem Besitz des reichen Mannes erhalten hat.“ Die Zerstörungsmaschinerie der Nazis hatte gründlich gearbeitet. Im Frühjahr 1938 hatte sie Isidor innerhalb weniger Monate physisch zerstört, er starb mit 52 Jahren. Fast sämtliche Zeugnisse seiner Existenz in Luxus und kultureller Opulenz hatte sie in alle Winde zerstreut. Eines der entwendeten Bücher entdeckte die Autorin ausgerechnet in der Raubbibliothek des Stürmer-Gründers Julius Streicher: ein „Kleines Handbuch der Kunst französischer Höflichkeit und Etikette“ mit einem Exlibris Isidors.
Shelly Kupferberg, 1974 in Tel Aviv geboren und seit ihrer frühen Kindheit in Berlin lebend, befasst sich in ihrem ersten Buch mit der Wiener Vergangenheit der eigenen Familie. Im Zentrum steht die schillernde Figur des Urgroßonkels Isidor Geller. Bei der Erinnerungsarbeit half der Großvater Walter Grab, Gründer des Instituts für Deutsche Geschichte der Universität Tel Aviv – auf seinem Dachboden lagerte der Besteckkasten.
Gellers Geschichte hatte als glänzende Erfolgsstory begonnen: Es war der rasante Aufstieg aus einem ultraorthodoxen Milieu im hintersten Winkel der galizischen Provinz, von wo Lemberg schon als Tor zur Welt erschien, in die Assimilierung hinauf zu Wiens feinster Gesellschaft.
Erfolgreiches Rechtsstudium und geschickte Geschäftstätigkeit als Heereslieferant machten Geller zu einem der wenigen Gewinner nach dem Ersten Weltkrieg. Seinen Reichtum trug er öffentlich zur Schau, der Salon in der von Baron Rothschild gemieteten Beletage in der vornehmen Canovagasse gleich hinter dem Musikverein wurde zu einer gefragten Adresse. Die Bibliothek legte Zeugnis von äußerster Kultiviertheit ab, der Umgang mit Damen der Gesellschaft machte ihn zum Lebemann: Nach zwei gescheiterten Verbindungen, beide gutbürgerliche Töchter, leistete er sich die Liaison mit einem ungarischen Starlet, das es mit Isidors finanzieller Hilfe in die Staatsoper schaffte.
Im Gegensatz zu anderen Juden aus dem Schtetl, die ihre entbehrungsreiche Kindheit romantisch verklärten, hatte er das alles erfolgreich hinter sich gelassen, wie er glaubte. Den sich immer deutlicher breitmachenden Antisemitismus versuchte er zu verdrängen. Bis am 13. März 1938 die Gestapo vor seiner prunkvollen Tür steht: Isidors Chauffeur und die Bediensteten Resi und Mizzi, zu denen er immer äußerst großzügig gewesen war, hatten bereits Monate vor dem „Anschluss“ eine Aufstellung seiner Wertpapiere kopiert und an die „Partei“ weitergereicht.
Nuancenreich beschreibt Kupferberg den reizvollen, aber nicht makellosen Vorfahren, schildert einfühlsam weitere Familienmitglieder wie eben den Großvater Walter, der sein jugendliches Leben in Wien mit unzähligen Fotos dokumentiert hatte, oder den (erfundenen) Schneider Goldfarb. So entsteht ein Sittenbild der Wiener Gesellschaft um 1930, zwischen Kanzlei und Salon, Kaffeehaus und Theater. Die scheinbare Idylle wird abrupt beendet durch die Gräuel der Nationalsozialisten in einer Zeit, in der der aufgehetzte Pöbel eine solche Fortune nicht erträgt.
Dort, wo der Autorin Fakten fehlen, bedient sie sich ausschmückend der Fantasie. Damit changiert der Text zwischen Dokumentation und Fiktion. Das klappt über weite Strecken gut, geht aber zuweilen auch daneben: etwa wenn ein Gauleiter (!) des 20. Bezirks auftaucht. Oder wenn am Grab des Urgroßonkels ein Reh erscheint und Kupferberg schreibt, Reh und Fuchs würden einander hier gute Nacht sagen – auf dem Zentralfriedhof wurde früher gejagt, daher löst dies Assoziationen zu den Judenverfolgungen aus. Aber: „Wichtiger sind die Geschichten, die überlebt haben. Und weitererzählt werden.“ Deren gibt es sicherlich noch einige auf dem Dachboden.