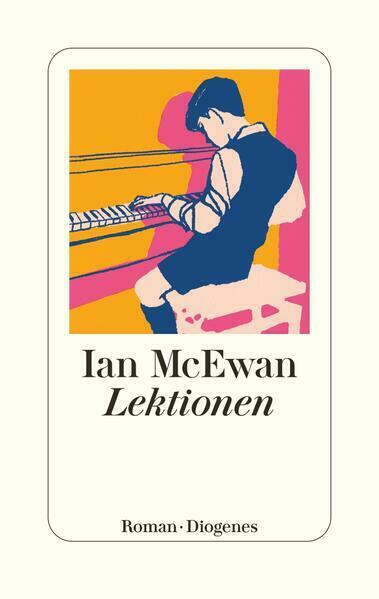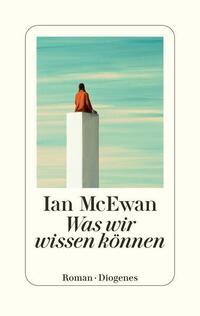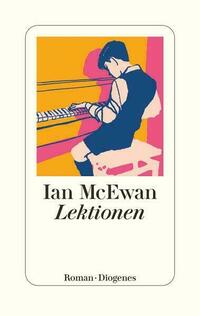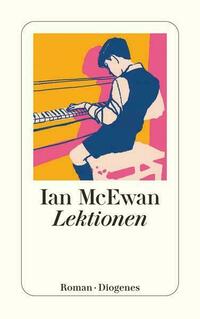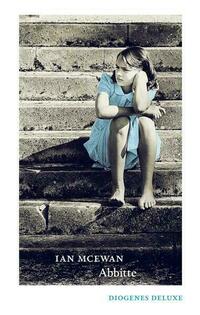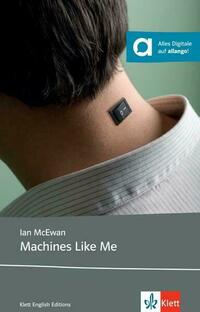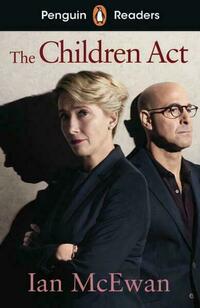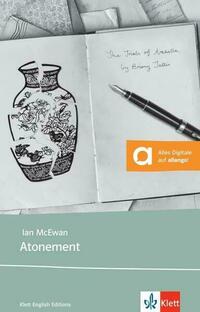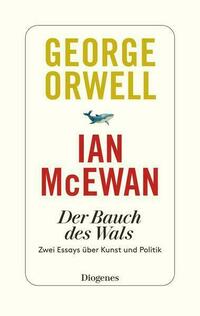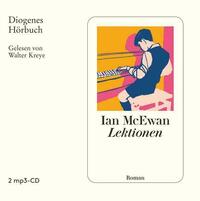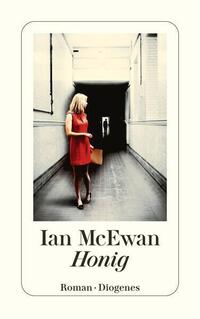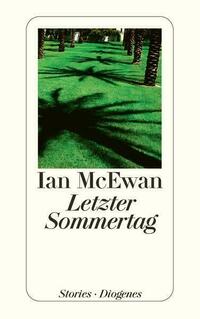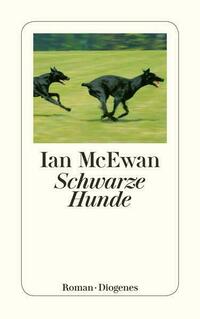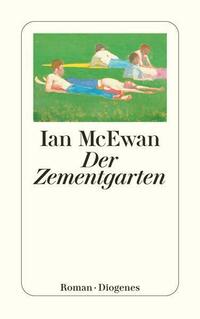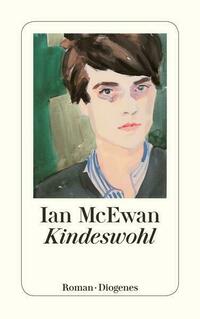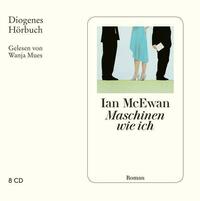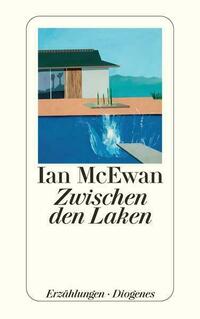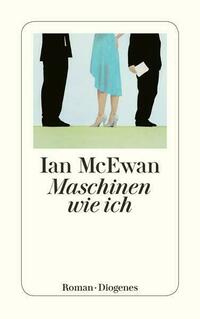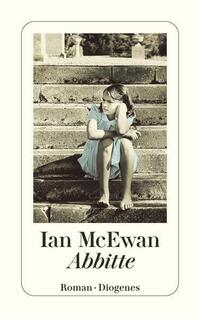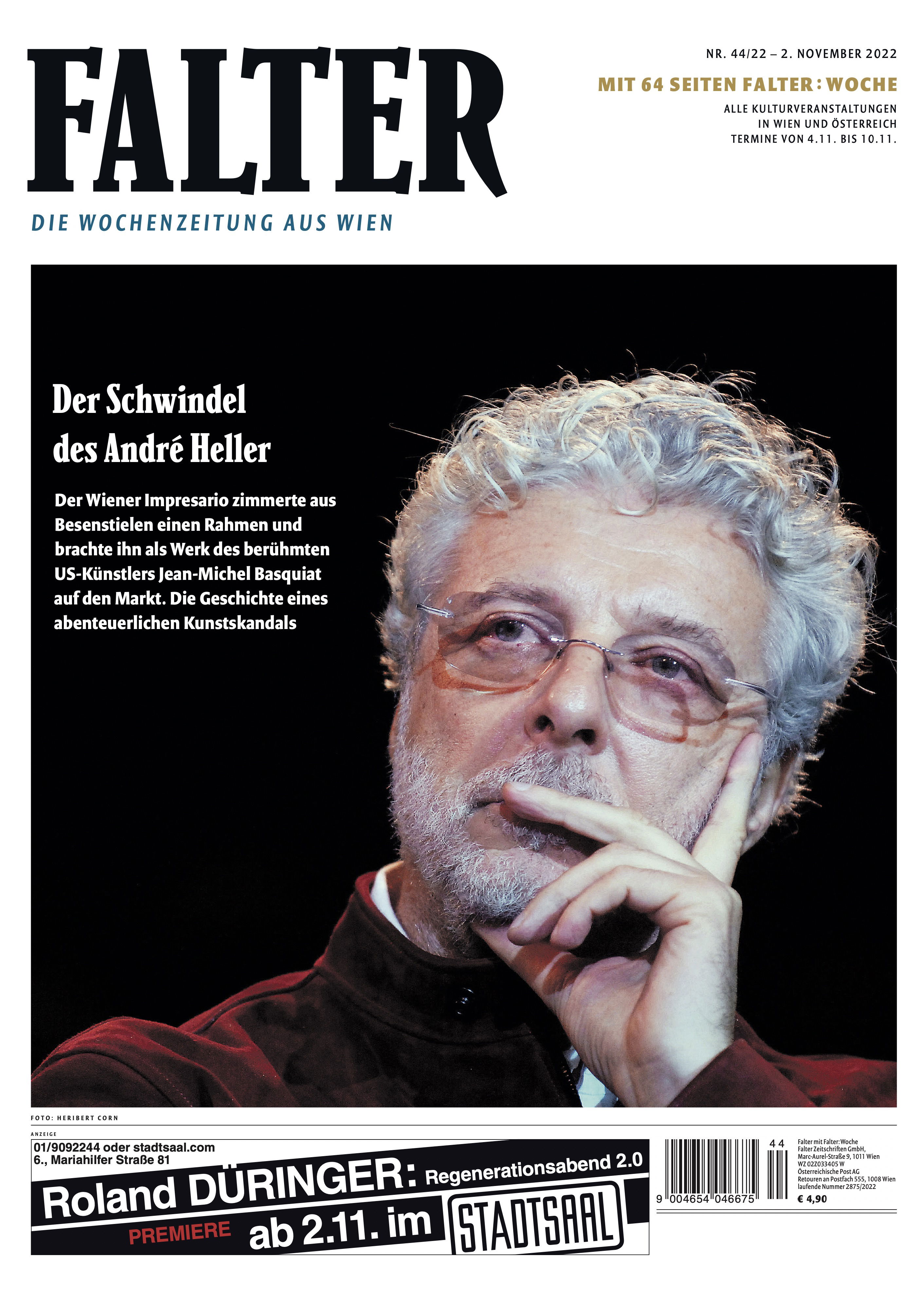
Grenadiermarsch versus Spätantike
Klaus Nüchtern in FALTER 44/2022 vom 02.11.2022 (S. 31)
Julian Barnes und Ian McEwan, die beiden bedeutendsten britischen Schriftsteller zumindest ihrer Generation, haben vieles gemeinsam: Beide sind Kinder der unmittelbaren Nachkriegszeit und blicken auf eine jahrzehntelange, äußerst produktive Karriere zurück; beide wurden mit dem renommierten Booker Prize ausgezeichnet -McEwan bereits 1998 für "Amsterdam", einen seiner schwächeren Romane, Barnes erst 2011 für "The Sense of an Ending", einen seiner besten; und beide sind nicht sonderlich gut in Polit-Satire, wie Barnes mit "England, England" (1998) und McEwan mit "Die Kakerlake"(2019) bewiesen hat.
Wenn die beiden nun mit ihren jüngsten Romanen gegeneinander antreten, ist das, zumindest der Papierform nach, ein Spitzenderby. In beiden steht das Verhältnis des Protagonisten zu einer älteren Frau im Mittelpunkt, beide verhandeln, was man etwas geschwollen als Historizität der Conditio humana bezeichnen könnte. Die Parallelen reichen freilich nicht bis in die Unendlichkeit, was allein schon der Umstand belegt, dass Barnes keine 250, McEwan hingegen über 700 Seiten braucht, um den Sack zuzumachen.
Bereits mit seinem Roman "Flauberts Papagei" (1984), der ihm den Durchbruch bescherte, hat Julian Barnes bewiesen, dass er kein konventioneller Erzähler, sondern ein hochreflektierter Essayist ist, der die Geschichten, mit denen wir Ereignissen einen Sinn verleihen, auf ihre Plausibilität hin abklopft und aus verschiedenen Blickpunkten betrachtet.
Auch in "Elizabeth Finch" kommt dem Fragezeichen tragende Bedeutung zu. Zum einen, weil die titelgebende Protagonistin die erwachsenen Hörerinnen und Hörer in ihrem Abendkurs über "Kultur und Zivilisation" zum eigenständigen Denken anregen will (und dabei alle Fragen, wie banal oder daneben auch immer, als legitim erachtet); zum anderen, weil der Ich-Erzähler Neil, der auch nach dem Kurs Kontakt zu der von ihm bewunderten Dozentin hält, sich nach 189 Seiten selbst fragen muss, "in welche Kategorie [ ] meine Liebe zu EF" fiele, und dies vorerst dahingehend beantwortet: "Tja, ich würde sagen, es war eine romantisch-stoische Liebe."
Wie man es von Barnes erwarten darf, ist damit das letzte Wort noch nicht gesprochen. Neil, ein zweimal geschiedener Schauspieler, der klingt wie der Schriftsteller Julian Barnes, durchforstet die Bibliothek und Notizen, die ihm die ihrem Krebsleiden erlegene EF, wie er sie stets nennt, vermacht hat. Finchs Bruder und eine ehemalige Geliebte Neils, die den Abendkurs ebenfalls besucht hat, bereichern dieses Spiel vom Fragen um weitere Perspektiven.
Der Autor selbst zieht in "Elizabeth Finch" alle Register seines Könnens. Die Dialoge, Beobachtungen, Kommentare und Bonmots der Titelheldin sind brillant, und gewiss hat der römische Kaiser Julian Apostata ( 363 n. Chr.) unser aller Aufmerksamkeit verdient: Als Neffe Konstantins des Großen hat er die Konversion des Onkels zum Christentum nicht mitgemacht und gilt Elizabeth Finch als hellenisch-heidnischer Kronzeuge wider Monotheismus, Monokulturalismus, Monogamie &Co. Der Essay über die Julian-Apostata-Rezeption von Gregor von Nazianz über Montaigne und Montesquieu, Henrik Ibsen und Algernon Swinburne bis hin zu den Österreichern Adolf Hitler (Nazi) und Felix Weingartner, Edler von Münzberg (Komponist), macht ein Drittel des Buches aus -und jetzt einmal ehrlich: Muss man mögen.
Wer's nicht mag, wird vielleicht mit dem ungleich voluminöseren Roman "Lektionen" glücklich, dessen Autor genau den entgegengesetzten Weg beschreitet: Wo Barnes auf Konzentration, Analytik und Fokussierung der Details setzt, da entscheidet sich Ian McEwan für Fülle und Breite. Trägt sich sein Protagonist Roland Baines, dem die große Karriere als Lyriker und Pianist versagt bleibt, mit der Idee einer Gesamtdarstellung des 20. Jahrhunderts, so klappert McEwan entlang von Baines' Biografie zumindest die zweite Hälfte ab und erlaubt sich anhand der Lebensläufe der Elterngeneration auch noch Ausflüge in die 1940er-Jahre.
Was uns der Autor hier vorsetzt, ist eine Art literarischer Grenadiermarsch: Alles, was Küche und Kühlschrank hergeben, muss hinein -also alles, was McEwan in früheren Romanen schon wesentlich überzeugender behandelt hat: sexuelle Obsessionen ("Der Trost von Fremden","Liebeswahn"); der Kalte Krieg ("Unschuldige","Honig"); Schuld, Sühne und Verrat ("Abbitte") und die grausame Kontingenz von Geschichte, die darüber entscheidet, wer die Modernisierungs-und Liberalisierungsgewinne einstreift und wer übrig bleibt ("Am Strand").
Die Hoffnung auf einen spannenden Krimi-Plot wird ebenfalls enttäuscht, denn sehr bald ist klar, dass Roland seine Frau Alissa entgegen dem Verdacht des ermittelnden Kommissars nicht ermordet hat, sondern von dieser ver-und mit dem gemeinsamen Sohn alleingelassen wurde. Alissas Kalkül geht auf: Statt wie ihre Mutter im Familien-und Eheleben zu versumpern, avanciert sie Jahre später zur gefeierten Schriftstellerin.
In McEwans Variante des Dauerbrenners "junger Mann hat Affäre mit älterer Frau" treibt die strikte, ein bissl sadistische und sehr besitzergreifende Klavierlehrerin ihren um elf Jahre jüngeren, gerade pubertierenden Schüler Roland in ein sexuelles Stockholm-Syndrom.
Dass das Jahrzehnte später noch einmal zum Anlass von Ermittlungen wird, ist vollkommen unglaubwürdig und allein deswegen nötig, weil das Thema "Missbrauch" auch noch in den Topf musste -so wie unter anderen auch: Klimakatastrophe und Covid-Pandemie, Kubakrise und Tschernobyl, Falklandkrieg und Mauerfall, das Aufkommen des Internets und der Niedergang des CD-Players.
Der Erkenntnisgewinn dieser Geschichtsrevue ist enden wollend. Darüber hinaus lassen einen aber auch die Ängste und Passionen der Protagonisten einigermaßen kalt.
"Elizabeth Finch" dagegen ist zwar auch gewiss nicht Barnes' bester Roman. Als elegantem Stilisten und Meister des ironisch-distanzierten Räsonnements gelingt es dem Autor aber doch, uns seine hoch idiosynkratische Titelheldin näherzubringen -und sei es bloß, indem er deren Art zu rauchen beschreibt:
"[M]anche tun so, als gehöre Rauchen zu ihrem persönlichen Stil [ ]. EF dagegen ließ keine besondere Haltung zu ihrem Rauchen erkennen. [ ] Sie rauchte, als ließe das Rauchen sie gleichgültig. Hört sich das sinnvoll an? Und wenn man gewagt hätte, sie zu fragen, hätte sie nicht zu Entschuldigungen gegriffen. Ja, hätte sie gesagt, natürlich sei sie süchtig; und ja, sie wisse, dass das schädlich sei und noch dazu unsozial. Aber nein, sie wolle nicht aufhören oder zählen, wie viele sie pro Tag rauchte; dergleichen stehe auf der Liste ihrer Besorgnisse ganz weit unten."
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: