
Eine Mutter sieht rot im Sommer des Hasses
Klaus Nüchtern in FALTER 50/2023 vom 13.12.2023 (S. 33)
Boston, Sommer 1974. Der Vietnamkrieg dauert an und hat das Land zutiefst gespalten; Präsident Nixon steht vor seinem Rücktritt; die Ölpreise sind astronomisch, und in der Wohnung von Mary Pat Fennesy hat der Ventilator den Geist aufgegeben. Der Kühlschrank schwitzt Kondenswasser, und bis sie wieder Kaffee kochen kann, wird Mary Pat noch ein paar Extraschichten in ihrem Zweitjob schieben müssen, um ihre Gasrechnung zu berappen. Und dann ist da auch noch die Sache mit der Protestkundgebung und den Flugblättern, die sie verteilen soll: "KEINE UMVERTEILUNG PER BUS! NIEMALS!"
"Busing" nennt sich die eigentlich gut gemeinte, aber schlecht durchdachte Maßnahme, die der "Rassentrennung" an den Schulen entgegenwirken soll. Die ist zwar de jure seit 1954 verboten, aber de facto noch aufrecht, weswegen afroamerikanische Kinder und Jugendliche mit Bussen in "weiße Schulen" transportiert werden sollen und vice versa. Der Unmut, den das Busing auf beiden Seiten auslöst, droht in einer Welle der Gewalt zu eskalieren.
Der urbane Raum selbst ist von "Rassen"-und Klassengegensätzen definiert. Die weiße Mittelschicht ist in die Vorstädte gezogen, die verwahrloste Innenstadt bleibt jenen, die sich Suburbia nicht leisten können.
Zu ihnen zählt auch Mary Pat. Sie ist eine "Southie", Bewohnerin der gleichnamigen weißen Sozialsiedlung im Süden von Boston, die in der deutschen Übersetzung allerdings umbenannt wurde: "Hier in Smoothie kamen die Kinder schon mit einer Dose Schlitz und einem Päckchen Lucky in der Hand zur Welt." Mary Pat, die an diesen Ernährungsgewohnheiten festhält, ist 42 und eine richtig toughe Mutti, ausgestattet mit einem Mundwerk und zwei Fäusten, die ihr Respekt selbst seitens abgebrühter Kerle verschaffen, wenn sie diesen das Nasenbein einschlägt oder mit einem Teppichmesser an die Eier geht.
Ihr Tochter Jules, 17, ist freilich aus weicherem Holz geschnitzt. Vater und Stiefvater haben sich aus dem Staub gemacht, der ältere Bruder hat zwar Vietnam überlebt, nicht aber das Heroin -all das hat tiefe Spuren hinterlassen. Als Jules eines Abends nicht mehr nach Hause kommt, wird Mary Pat von finsteren Ahnungen heimgesucht, die sich im Zuge der buchstäblich auf eigene Faust betriebenen Nachforschungen nur als allzu berechtigt erweisen.
Die Poetik des Aristoteles definiert die Tragödie durch die Peripetie und die Anagnorisis: Der plötzliche Schicksalsumschwung geht einher mit der schlagartigen Erkenntnis eines furchtbaren Zusammenhangs. In "Sekunden der Gnade", seinem jüngsten Thriller, hat sich Dennis Lehane an dieses Modell gehalten und seiner Protagonistin die Statur einer tragischen Heldin verliehen, der die letzten Hoffnungen und Gewissheiten genommen werden.
"Southie" ist naturgemäß kein Ponyhof, aber die irischen Mobster, die das Viertel kontrollieren, haben sich mit ihrem auf eherner Loyalität und strikten Hierarchien basierenden Regime immerhin um "ihre Leute" gekümmert und für Ordnung gesorgt. Diese erweist sich freilich als bloße Fassade, die den Blick auf einen Abgrund an Verrat und grausamer Verbrechen verstellt, in den auch Tochter Jules geraten ist. Anscheinend hängt ihr Verschwinden mit dem gewaltsamen Tod eines 20-jährigen Schwarzen zusammen, der rein gar nichts mit Drogen zu tun hatte -wie sofort vermutet -, sondern bloß zur falschen Zeit am falschen Ort war.
"Jemanden umbringen ist wie Schneeschaufeln", gesteht eine der übelsten des an üblen Gestalten wahrlich nicht armen Romans. Dass dieser nicht völlig in nihilistischer Finsternis mündet, liegt an dem großartigen, von der hochambivalenten Protagonistin bis in die Nebenrollen blendend besetzten Ensemble. Neben einer Reihe konturstarker Knallchargen gehören diesem auch ein paar Figuren von verlässlicher Humanität an -allen voran "Good Cop" Bobby, der seine Drogensucht überwunden und bei der ebenfalls grundsympathischen Carmen einen Stein im Brett und erste Anstandserfolge im Bett hat.
Mit "Small Mercies", so der Originaltitel, ist Dennis Lehane, dessen Romane "Mystic River" und "Shutter Island" bravourös (Clint Eastwood) beziehungsweise bescheuert (Martin Scorsese) verfilmt wurden, ein makelloser Thriller geglückt. Er besticht nicht nur durch einen rasanten (allerdings ultra-brutalen Plot), sondern auch durch eine soziologisch präzise und dennoch äußerst sinnliche, dichte Beschreibung. Ein historischer Moment, den der Autor selbst hautnah erlebt hat, wird dadurch greif-, ja geradezu riech-und schmeckbar.
Ein absolutes Glanzstück aber sind die messerscharfen Dialoge, die in der mitunter sub-inspirierten Übersetzung leider einiges von ihrem lakonischen Witz einbüßen. Als Cop Bobby wieder einmal versucht, Mary Pat ein Versprechen aus dem Kreuz zu leiern, antwortet diese mit einem Nicken. "Is that a yes?""It's a nod.""As in you'll think about it.""As in I heard the words that left your mouth."
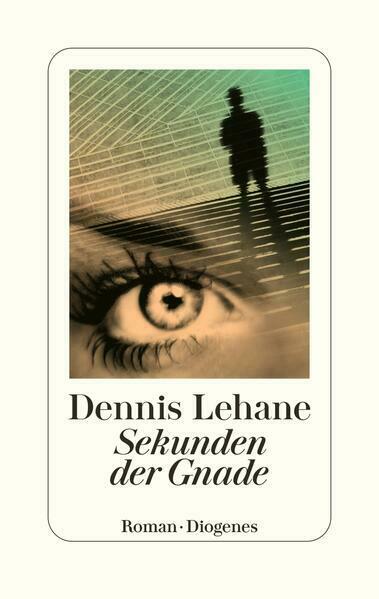



 Lesekränzchen-Rezensionen
Lesekränzchen-Rezensionen