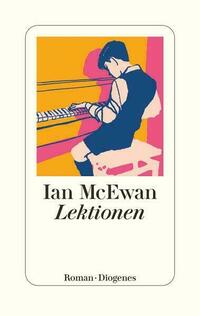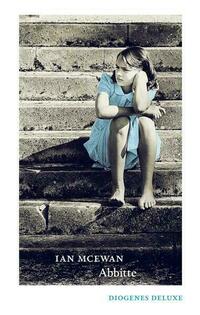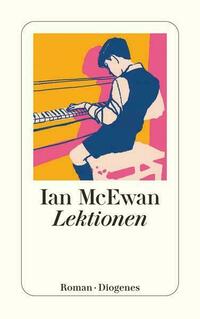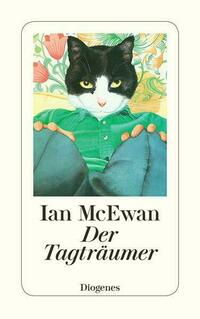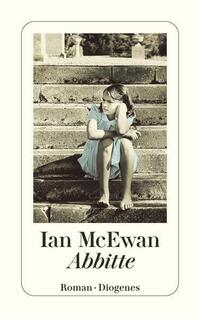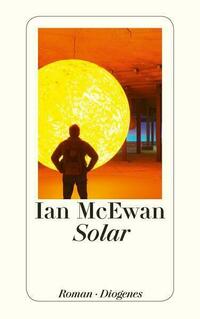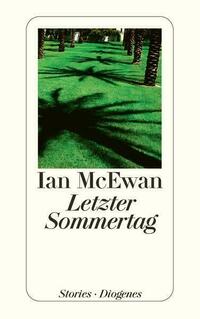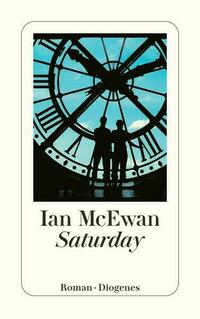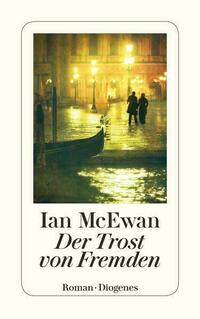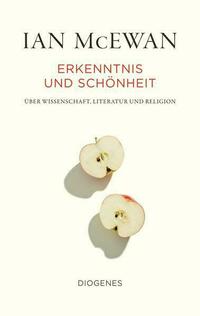Klima, Krise, KI und Krim
Klaus Nüchtern in FALTER 39/2025 vom 24.09.2025 (S. 29)
Mit Romanen wie "Der Trost von Fremden" (1981), "Liebeswahn" (1997) oder "Saturday" (2005) hat sich der Brite Ian McEwan den Rang eines Spezialisten für die dunklen und abseitigen Facetten menschlichen Begehrens und Treibens erschrieben, der ein geradezu wissenschaftliches Interesse an psychischer und neurologischer Devianz in spannende Plots zu packen wusste. Der Ruf des Autors, der 1998 für "Amsterdam" mit dem Booker Prize bedacht worden war, schien unerschütterlich, ehe dieser selbst zur literarischen Selbstdemontage schritt. Im zwangsoriginellen "Nussschale"(2016) belauscht sein Erzähler als Embyro im Bauch der Mutter ein Mordkomplott; die in die 1980er-Jahre zurückprojizierte Dystopie "Maschinen wie ich" war wenig mehr als matte Science-Fiction, und die ebenfalls 2019 erschienene Brexit-Satire "Die Kakerlake" eine so krude wie unlustige Brexit-Satire im Gewand eines Kafka-Remakes.
Drei Jahre später avancierte McEwan mit dem Wälzer "Lektionen" endgültig zum Weltweisen und -chronisten, der von der Kuba-bis zur Klimakrise und vom Aufstieg des Internet bis zum Niedergang des CD-Players alles zu bedenken und beschwatzen hatte, es darob aber verabsäumte, plausibles Personal und packende Plots zu ersinnen.
Die gute Nachricht zuerst: McEwans aktuelles, zeitgleich im englischen Original und in deutscher Übersetzung erscheinendes Opus ist um 250 Seiten kürzer als "Lektionen". Die schlechte Nachricht: Auch die 470 Seiten von "Was wir wissen können" sind sehr, sehr viele und sorgen für eine reichlich strapaziöse Lektüre.
Dem Prinzip, das McEwan spätestens mit "Lektionen" etabliert hat, ist der Autor leider treu geblieben: Die Gewichtigkeit der Themen, die -von der Krim-Krise über die KI bis zum Klimawandel -verhandelt oder halt herbeizitiert werden, soll die Bedeutsamkeit des Unterfanges verbürgen und darüber hinwegtäuschen, dass die Wahl der literarischen Mittel allen Maximen zuwiderlaufen, die in der Einführungseinheit jeder Creative Writing Class durchgekaut werden.
Die vielleicht wichtigste davon lautet: "Show, don't tell"; salopp übersetzt: "Zeig es mir, aber laber mir keine Kante ans Bein!" Nun ist es freilich so, dass schon der McGuffin des Romans, ein vom englischen Lyriker Francis Blundy verfasstes und dessen Frau Vivien gewidmetes Gedicht, zwar ständig als solitäres und visionäres Meisterwerk beschworen wird, aber kein Mensch sagen kann, worum es in der mutmaßlichen Liebeserklärung an die Gattin, die Natur oder was auch immer tatsächlich geht, weil es nie veröffentlicht wurde und die einzige Niederschrift verschollen ist.
Vladimir Nabokovs Roman "Fahles Feuer" (1962) besteht aus einem 30-seitigen Gedicht gleichen Namens sowie 200 Seiten Kommentar eines fiktiven Literaturwissenschaftlers. Ian McEwan hat es sich um einiges leichter gemacht. Blundys Poem ist ein Kranz von 14 Sonetten, wobei keine einzige der insgesamt 196 Zeilen zitiert wird.
Das ist schon ein bisschen faul, aber eben durch das bizarre Schicksal legitimiert, das der Autor über das Opus magnum seines Dichterprotagonisten verhängt hat. Das eigentliche Problem aber besteht in der völlig überhochmetzten und unglaubwürdigen Fiktion, die als Romanplot herhalten muss: Auch McEwan lässt einen fiktiven Philologen von der Leine, bloß dass der im Jahr 2119 auf den Plan tritt und es sich in den Kopf gesetzt hat, das seit 105 Jahren verschollene Manuskript aufzuspüren.
Zu diesem Behufe durchforstet dieser Thomas Metcalfe ganze Terabytewälder an Aufzeichnungen und Korrespondenzen all jener Menschen, die bei dem mythenumrankten "Unsterblichen Abendessen" anwesend waren, im Rahmen dessen besagtes Poem von Blundy vorgetragen wurde.
Nach diversen Kriegen und Katastrophen ist die Weltbevölkerung zwar auf vier Milliarden und die durchschnittliche Lebenserwartung auf 62 Jahre gesunken, "der ganze hochinformative Datenmüll" auf Messengerdiensten und Social Media aber erhalten geblieben.
Vor dieser recht lustlos ausgepinselten dystopischen Kulisse hängt Metcalfe melancholisch-nostalgischen Gedanken über die Zeit vor der "großen Überflutung" von 2042 nach, quält sich durch der nur schwer schiffbare Archipel des Vereinigten Königreichs und die Flauten eines seekranken Beziehungslebens.
Auch im zweiten, gnädigerweise um hundert Seiten kürzeren Teil des Romans sorgt das amouröse Treiben der handelnden und vögelnden Personen für ein wenig Action. Erzählt wird aus der Perspektive Viviens, die ihren an sich wunderbaren, aber an Alzheimer erkrankten ersten Gatten Percy mit dem selbstgefälligen, aber charismatischen Dichterfürsten Blundy betrügt. Aber weder das sich ankündigende Mordkomplott samt ethischem Begleitdiskurs und Selbstzerknirschungsexerzitien noch die Schlusspointe, welche die Quest nach dem Heiligen Sonettkranzmanuskript dann doch noch abwirft, können diesen volle Kanne verbumfiedelten Roman retten. Ob Ian McEwan noch einmal in die Champions League der Literatur zurückkehren wird, bleibt weiterhin fraglich.