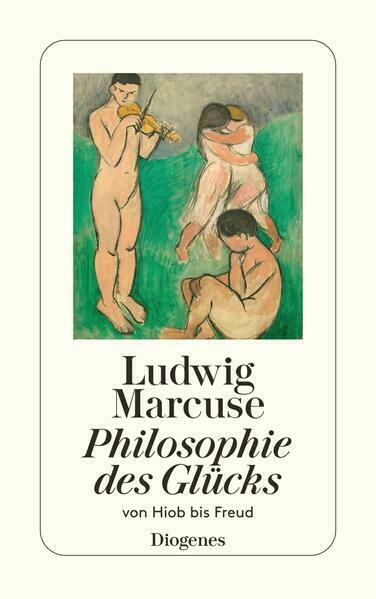He Studierende, leistet euch Umwege!
Barbaba Tóth in FALTER 38/2016 vom 21.09.2016 (S. 40)
Die Studienjahre als wildeste Phase im Leben? Das war einmal. Der Philosoph Robert Pfaller über verschulte Curricula, gestresste Studenten – und Auswege aus dem Ganzen
Wer Neo-Student ist und diese Zeilen liest, ist noch in keiner Vorlesung gesessen, hat aber schon einen wahren Vorstudien-Marathon hinter sich. Einfach nach Wien kommen und einmal schauen, was die Unis so können? Fast undenkbar.
Bis zum 5. September lief die allgemeine Registrierungsfrist für alle Studierenden, noch bis 30. November darf man in Ausnahmefällen nachliefern. Wer Massenstudien wie Informatik, Psychologie, Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Betriebswirtschaft, Biologie oder Ernährungswissenschaften studieren will, hat ohnehin schon ein zweistufiges Aufnahmeverfahren hinter sich – mit Self-Assessment-Test oder Motivationsschreiben.
Das Studieren, aber auch das Studentenleben hat sich massiv verändert. Anlass für eine Interviewserie mit zehn der spannendsten Wiener Vordenkerinnen und Vordenker aus allen Disziplinen. Den Anfang macht Philosoph Robert Pfaller.
Falter: Herr Professor Pfaller, wären Sie heute noch gerne Student?
Robert Pfaller: Das ist eine schwierige Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe. Ich kann dazu eine Anekdote erzählen. Der Soziologe Richard Sennett war vor kurzem in Wien und wurde von Philipp Blom gefragt: „Herr Sennett, mir ist aufgefallen, dass Sie der berühmteste Soziologe unserer Zeit sind, aber gar nicht Soziologie studiert haben“. „Ja, das stimmt“, antwortete Sennett. Ich habe Musik, Geschichte und Politikwissenschaft studiert, und daraus ist dann insgesamt Soziologie geworden.“ „Und was würden Sie heute studieren?“, fragte Blom. „Heute würde ich nicht mehr studieren. Die Universitäten sind so schrecklich geworden. Ich würde mir etwas anderes suchen.“
So geht es Ihnen auch?
Pfaller: Ja. Weitgehend. Ich würde heute wohl nicht mehr Philosophie studieren.
Auch das Studentenleben reizte Sie nicht? Früher ging doch davon eine gewisse Faszination aus, es ist ein ganz besonderer, einmaliger Lebensabschnitt.
Pfaller: Interessant war das Studierendenleben, solange es darin großzügige Freiräume gegeben hat. Das ist in den meisten Studienrichtungen leider verloren gegangen. Die Studenten müssen ihr Curriculum möglichst schnell und ohne Umwege durchlaufen. Das macht die meisten Studien frustrierend langweilig und die Studienzeit zu einer Zeit, die man möglichst schnell hinter sich bringt. Es ist ein fades, abstoßendes Augen-zu-und-durch-Ding geworden.
Die Universität als Verlängerung der Schule mit mehr Komplexität?
Pfaller: In den 1970er-Jahren hat man versucht, die Schulen universitärer zu machen, jetzt hingegen verschult man die Universitäten. Das ist eine völlig verfehlte Politik, die niemandem nutzt, außer den Leuten in den Apparaten, die sie machen. Die Universitätsreformen von 1993 und 2002 mit der Vollrechtsfähigkeit und die Bologna-Reform waren ein Bildungsverbrechen an der Bevölkerung. Ich kann nur hoffen – auch für die vielen hunderttausend streikenden Studenten, die 2009 so tapfer dagegen gehalten haben –, dass die Verantwortlichen noch zu Lebzeiten vor Gericht gestellt werden.
Wie wirkt sich das konkret für Sie in der Lehre aus?
Pfaller: Die Idee der Bologna-Reform war, ein europaweit einheitliches, zweistufiges Bildungssystem zu schaffen. Das gab es damals aber schon. Man hätte nur die gegenseitige Anerkennung beschließen müssen. Stattdessen haben wir heute lauter zwei- oder dreistufige Systeme, die alle nicht völlig kompatibel sind – und mit ihnen telefonbuchdicke Regelungen, wie etwas anzurechnen ist oder nicht. Dafür haben wir sehr viel geopfert. Heute darf kein Studienanfänger mehr in ein Seminar für Fortgeschrittene, auch wenn es ihn noch so sehr interessiert – weil man im zweiten Semester eben nur Kurse des zweiten Semesters besuchen darf. Dass die Universität das Interesse der Studierenden abtötet und sie massiv frustriert, schmerzt mich am meisten.
Dafür können Studenten in Wien beginnen und in Paris weiterlernen, ohne viele Anrechnungen.
Pfaller: Ob das ein so großer Vorteil ist, kann man bezweifeln. Dafür hat man die anderen erklärten Ziele der Reform verfehlt: Die Studierendenmobilität innerhalb des Studiums ist gesunken und die Abbrecherquoten sind gestiegen.
Lässt sich Philosophie in ECTS-Punkten messen?
Pfaller: Natürlich nicht. Aber das gilt nicht nur für die Philosophie. Die Vermessenheit des ECTS-Systems besteht darin, zu glauben, man könne vorhersehen, wie viel Aufwand Studierende auf eine Lehrveranstaltung verwenden. Aber das ist eben nicht vorhersehbar. Ich erfahre von meinen Studenten oft erst Monate später, dass sie in ihrer Wohngemeinschaft noch die ganze Nacht über eine These diskutiert haben, die ich in der Vorlesung vertreten habe. Dafür gibt es natürlich keine ECTS-Punkte. ECTS sorgt dafür, dass sie nie irgendetwas leidenschaftlich und intensiv machen können. Es zwingt sie, von allem immer nur ein bisschen zu machen – wenn zum Beispiel ein Seminar nur ein Fünftel der benötigten Semester-ECTS-Punkteanzahl bringt. So machen wir Studien kaputt. Früher konnte man sich im Philosophiestudium Umwege leisten. Toll, lesen wir ein ganzes Semester nur Spinoza! Gehen wir nur in das eine Seminar und lesen dafür die ganze Sekundärliteratur! Das ist heute undenkbar. Ich habe in meinem Studium immer am meisten von genau solchen, auf den ersten Blick unvernünftigen Umwegen profitiert, die mir niemand empfohlen hat.
Musste man denn nicht mehr vorschreiben und verschulen, um größere Studierendenzahlen zu bewältigen und dafür zu sorgen, dass auch sozial Schwächere eine Chance bekommen?
Pfaller: An diesem Argument von Reformfunktionären und -profiteuren stimmt wirklich gar nichts. Erstens: Schon die Universitätsreform 1975 unter Kreisky und Firnberg zielte auf die Öffnung der Universität für mehr Studierende, auch aus bildungsfernen und sozial schwachen Elternhäusern. Aber dazu hat man vor allem Familien- und Studienbeihilfen geschaffen, die Universitäten demokratisiert und die Studienpläne locker belassen. Die neueren Reformen dagegen haben das Gegenteil gemacht: Erst wurden die Studienbeihilfen gestrichen, dann hat man die Unis hierarchisiert, und dann die Studien verschult. Und zweitens: Die Verschulung nützt auch den sozial Schwachen nicht. Diese dumme Dauerprüferei ist ja auch gar nicht dazu da, den Leuten ein Studium zugänglich zu machen. Vielmehr soll sie es ihnen vermiesen und sie durch Knock-out-Prüfungen vertreiben, damit erst wieder nur wenige übrig bleiben.
Ihr Reformvorschlag?
Pfaller: Würde man die Studierenden nicht dauernd prüfen, dann würden sie auch nicht so viel unsinnigen bürokratischen Aufwand verursachen, und es könnten viel mehr Leute sinnvoll an den Unis studieren. Heute dagegen gehen 70 Prozent der studentischen Aufmerksamkeit allein für die Formalitäten des Studiums verloren – also für die Frage, bis wann man Prüfungen machen muss, in welcher Reihenfolge man sie ablegen muss etc. Das ist wirklich ein Skandal. Für all diese Probleme gäbe es gute Lösungen. Es leben nur leider zu viele Leute gut davon, dass diese Lösungen nicht umgesetzt werden.
Warum begehrt niemand auf?
Pfaller: Wenn man die Universität zu einem unwirtlichen Platz macht, an dem jeder nur schaut, dass er seine Punkte sammelt, senkt man natürlich das Interesse, sich für ihre Verbesserung einzusetzen und für sie zu kämpfen.
Mit der neuen, wenn auch vielleicht nur scheinbaren Kompatibilität der Universitäten kamen auch die Rankings: Welche Universität ist die beste? Wo wird am meisten publiziert?
Pfaller: Zum Glück war ich schon berühmt, bevor dieses System angefangen hat zu greifen. Ich leide aber mit meinen jüngeren Kollegen. Ich kenne Wissenschaftler, die eine gute Idee für einen Aufsatz haben, diese dann aber lieber in mehrere Teile spalten, weil das noch mehr Punkte gibt. Da entsteht, was man im Rauschgifthandel „gestreckten Stoff“ nennt. Auch die Publikationen der sogenannten „Oxbridge“-Mafia sind darum oft äußerst dünn. Da sollten wir in Österreich mehr Selbstbewusstsein zeigen. Wir haben hervorragende Wissenschaftstraditionen; wir müssen nicht nach den Kriterien anderer schielen, die sie in Ausübung ihrer fragwürdigen Privilegien verkünden.
Sie haben „in Ruhe studieren“ ja schon einmal auf Ihre bekannte „Liste der vom Aussterben bedrohten guten Lebensmomente“ gesetzt. Sinnloser Dauerstress mindere unsere Lebensqualität, ist eine Ihrer Kernthesen. Welche studentischen Lebensmomente gehören da noch dazu?
Pfaller: Ein Buch ganz lesen und nicht nur die paar Seiten eines PDF-Dokuments. Über viele Dinge diskutieren. Die Studienzeit als ein Stück lohnenden Lebens begreifen. Auf einen Kaffee oder eine Zigarettenpause gehen. Zu meiner Zeit wurde noch im Hörsaal geraucht. Das war vielleicht nicht immer angenehm, aber doch auch Ausdruck des kritischen Geistes, der damals herrschte. Studierende betrachteten sich damals nicht als Kunden eines Ausbildungsunternehmens, sondern als wache, politische Bürger und die Universität als ihr ureigenstes Forum. Was an der Universität geschah, wurde auch öffentlich wahrgenommen. Wenn es nötig war, hat man gestreikt. Was übrigens viel Arbeit ist und Einsatzbereitschaft erfordert. Ich war einer der Aktivisten des Studierendenstreiks 1987 – gegen das erste sogenannte „Sparpaket“ der damaligen rot-schwarzen Regierungskoalition, das auch die Kürzung der Familien- und Studienbeihilfen beinhaltete.
Moment, Sie sind Studienjahrgang 1981. Sie haben also in Ihrem sechsten Studienjahr gestreikt?
Pfaller: So lange studieren? Damals war das völlig normal. Vor dem achten oder zehnten Studienjahr hat kaum jemand abgeschlossen – mit dem Doktorat. Aber wie wollen Sie bitte eine Disziplin wie Philosophie in sechs Semestern studieren? Dazu gehört auch, ältere Studierende nicht als Störfaktoren, sondern als Ressource zu begreifen. Meine besten Momente erlebte ich an der Berliner Freien Universität in Seminaren mit Teilnehmern, die zwischen 30 und 50 waren. Da saßen keine folgsamen Kinder, sondern Menschen mit Lebenserfahrung. Und Studienabbrecher waren damals keine Versager, sondern sehr oft Menschen, denen das Studium so viel gegeben hat, dass sie ohne Abschluss gute Jobs gekriegt haben. Heute dagegen verpasst man den Leuten Abschlüsse, aber sie kriegen keine Jobs damit – weil sie auch kein sinnvolles Studium bekommen.
Und wenn sie doch einen Job kriegen, klagen Menschen Ende 20 über die Quarterlife-Krise, weil sie seit Schuleintritt nur gelernt, gelernt und gelernt haben, dann gearbeitet – und nach fünf Jahren ausgebrannt sind.
Pfaller: Stress entsteht niemals nur durch hohe Belastung allein, sondern immer durch einen Zusatzfaktor. Zum Beispiel: Man plagt sich mit einem schwierigen Text. Aber man muss gleichzeitig telefonieren und wird dadurch am Schreiben gehindert. Erst das stresst. Gut ausgebildete Menschen können scheitern oder reüssieren, aber Stress und Krise sind etwas anderes. Nämlich Zeichen dafür, dass ihnen etwas fehlt, um sich der Herausforderung angemessen stellen zu können – wohl deshalb, weil sie zu schmal ausgebildet sind und weil sie nicht die Zeit hatten, die persönlichen Reifungsprozesse zu durchleben, die in dieser Lebensphase notwendig sind.
Ein Plädoyer für das Philosophiestudium?
Pfaller: Philosophiestudenten waren früher in der Wirtschaft begehrt. Man hat Leute gesucht, die gelernt hatten zu denken. In Zeiten kurzfristiger Effizienzkriterien aber ist das nicht immer gefragt. Das neoliberale Effizienzfieber beschädigt darum alles, letztlich sogar die Effizienz selbst. Fast alle Parameter, an denen man die Leistungen der Universitäten derzeit bewertet, sind zutiefst sachfremd und kontraproduktiv. Man kann das ganz gut mit dem Fußball vergleichen. Dort wird ja seit einiger Zeit auch ständig alles gemessen und gezählt. Es gab 2014 ein legendäres Spiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Borussia gewann 3:0, und alle Beobachter waren sich einig: völlig zu Recht. Alle Fußball-Parameter aber sagten das Gegenteil. Bayern war mehr gelaufen, hatte mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen, höhere Passgenauigkeit. Aber es geht eben nicht darum, viele Zweikämpfe zu gewinnen, sondern die entscheidenden. Beim Fußball gibt es am Ende ein Ergebnis, das deutlich zeigt, wie unzureichend die Parameter sind. An den Universitäten ist es nicht ganz so deutlich. Darum wird uns – um bei dem Bild zu bleiben – immer noch ständig gesagt, wir bräuchten mehr Ballbesitz und sollten noch mehr laufen. Obwohl wir genau damit längst schon hoch verlieren. Eine Universität, die
innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viele schlecht ausgebildete Leute mit Abschluss produziert, ist deshalb eben noch lange keine gute.
An amerikanischen Universitäten lernen Studienanfänger, wie man korrekt anbandelt und dass Nein immer Nein heißt. Fällt das für Sie auch unter Formalisierung und Lustfeindlichkeit?
Pfaller: Ich halte es für bedenklich, dass wir ständig Standards aus den USA übernehmen, ohne zu berücksichtigen, unter welchen sozialen Voraussetzungen sie dort entstanden sind. Brachiale Faustregeln wie „No means no“ sind nur deshalb nötig, weil es dort eben so gut wie keine Kultur der Konversation, der höflichen Anbahnung oder des Flirtens gibt. Auf so manchem amerikanischen Campus wird leider häufig belästigt, vergewaltigt, beraubt. Bei uns zum Glück nicht. Wer keinen Beinbruch hat, braucht auch keinen Gipsverband.
Aber schützen solche Regeln nicht auch?
Pfaller: Das ist ja das Raffinierte an solchen USA-Importen, gerade an den Universitäten. Sie haben einen emanzipatorischen Beigeschmack: Wir schützen die am meisten Benachteiligten. Aber diese Orientierung an den angeblich ganz Schwachen – die in Wahrheit übrigens meist gar nicht existieren – bedeutet gleichzeitig immer die Zerstörung eines sozialen Standards. Sie zerstören die Universität als einen Ort, an dem erwachsene Menschen wichtige Probleme höflich, aber schonungslos in der Sache erörtern können. Am schlimmsten sind die sogenannten „Trigger Warnings“.
Also die Praxis, vor Seminarbeginn die Studenten davor zu warnen, dass besprochene Texte oder Bilder verstörend oder traumatisierend sein könnten?
Pfaller: Genau. Stellen wir uns vor, wir besprechen „Wilhelm Tell“, und einer der Studenten erklärt, in seiner Verwandtschaft sei auch jemand gewaltsam zu Tode gekommen und das Lesen Tells würde ihn erneut traumatisieren. Dann müsste ich ihn vorher warnen und empfehlen, lieber in ein anderes Seminar zu gehen.
Achtung, Studieren kann Ihre Gesundheit gefährden?
Pfaller: Dieses erstaunliche institutionelle Zartgefühl für alles Mögliche ist die typische Begleiterscheinung der brutalsten sozialen Verhältnisse. Es tritt bezeichnenderweise immer genau dort auf, wo Studieren bedeutet, sich in lebenslange Schulden zu stürzen; wo selbst Absolventen von Eliteuniversitäten in der Obdachlosigkeit landen; und wo ein erschreckend hoher Bevölkerungsanteil in den Gefängnissen endet, wenn nicht überhaupt durch die Todesstrafe.
Genieß das Studentenleben! Wo gilt das dann heute überhaupt noch?
Pfaller: Vielleicht an den Kunstuniversitäten, an denen ich glücklicherweise unterrichten darf. Da sind die Bologna-Schäden nicht ganz so arg.
Der Rat des Philosophen an Studienanfänger?
Pfaller: Lasst euch von euren Zeugnissen und Punkten nicht täuschen. Sondern messt euch an euren eigenen Ansprüchen, nach dem Motto: „Ich gehe heute nicht schlafen, bevor ich das nicht weiß“. Bildet Reserven, um euch für Dinge, die euch wirklich interessieren, mehr begeistern zu können, als es der Lehrplan vorsieht. Und leistet euch Umwege.