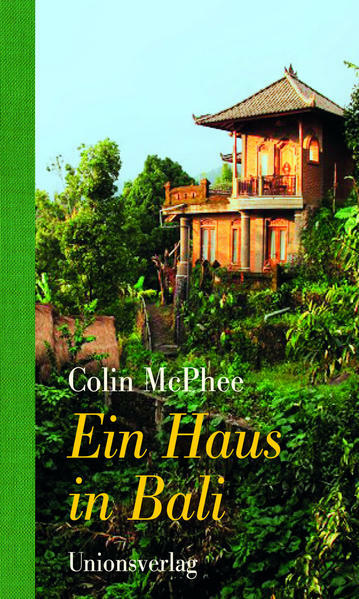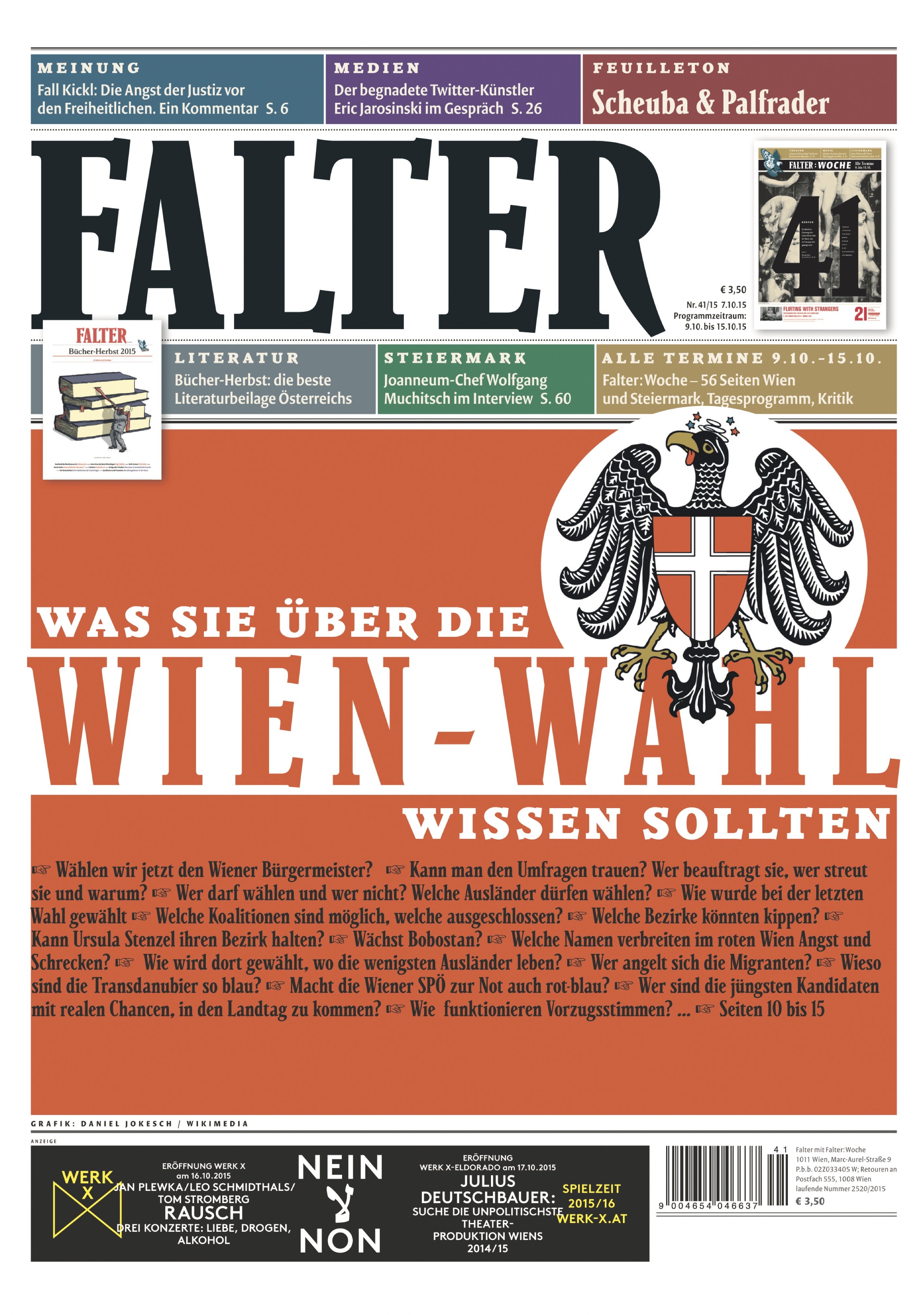
In der Tonlage „Schönes Meer“ und „Verbrannte Tamarinde“
Julia Kospach in FALTER 41/2015 vom 07.10.2015 (S. 8)
Die indonesische Insel Bali hat viele in ihren Bann geschlagen: unter anderen den Komponisten Colin McPhee und den Anthropologen Nigel Barley
Alles begann mit Schallplattenaufnahmen eines balinesischen Gamelan-Orchesters, die der kanadische Komponist Colin McPhee (1900–1964) um 1930 in New York hörte. Der Klang ließ den jungen Avantgardemusiker nicht mehr los. Wenig später betrat er erstmals Bali, wo er bis 1938 den größten Teil seiner Zeit mit der akribischen, fast schon manischen Erforschung der balinesischen Musik verbrachte. Das Buch, das McPhee – nach seiner Rückkehr in die USA – über seine musikwissenschaftlichen und kulturellen Forschungen auf der indonesischen Insel schrieb, gilt als Klassiker der Reiseliteratur. „Ein Haus in Bali“, erstmals 1946 in den USA erschienen, liegt nun – fast 70 Jahre später – auch in deutscher Übersetzung vor.
Es ist ein historischer Reisebericht von großer Farbigkeit, der auf berückende Weise das kulturelle Leben auf Bali in den 1930er-Jahren einfängt. Die überbordend reichen, uralten Traditionen und Riten der Insel, in der die Musik in den meisten Dörfern eine alltagsbestimmende Rolle spielte, trafen in McPhee, wiewohl Musiker und nicht Schriftsteller, auf einen Chronisten mit großem erzählerischem Talent und noch mehr Hingabe.
Seine offensichtliche Begeisterung für die Musik der Insel, sein unbändiger Wunsch, diese zu verstehen, in all ihren Aspekten zu dokumentieren und gegebenenfalls wiederzubeleben, erschließen McPhee den Zugang zu den Menschen. Wie ein Kleinkind, das sprechen lernt, häuft er rasend schnell Wissen über Umgangsformen, religiöse Riten, Kastenwesen, Sprachgebrauch und Weltbilder der Balinesen an. Die Anverwandlung fällt ihm angesichts seiner grenzenlosen Neugier leicht. Die Schranken zwischen Weißen und Einheimischen, die die niederländische Kolonialverwaltung als schicklich ansieht, ignoriert er und macht sich stattdessen mit dem komplexen Regelwerk balinesischer Gesellschaftshierarchien vertraut, damit er Musikern, Komponisten und Tänzern Löcher in den Bauch fragen kann.
Die Unmittelbarkeit seines Zugangs spiegelt sich in seinem Schreiben: McPhee ist kein Anhänger des bei seinen Zeitgenossen so überaus beliebten Exotismus. Er lernt und akzeptiert die kulturellen Regeln, nimmt an Tempel- und Palastaufführungen von Gamelan-Orchestern teil, schaut sich zahllose Schattenspiel- und Tanzaufführungen an, bereist entlegene Dörfer, um die dortigen Dorfmusiker und ihre archaischen Instrumente zu hören und zu sehen, engagiert Tanzlehrer für Dorfkinder und erwirbt Orchesterinstrumente, um die musikalischen Traditionen in dem Dorf, in dem er sich ein Haus baut, wiederzubeleben.
„Ein Haus in Bali“ ist ein bezauberndes Buch – gerade weil es nicht bezaubern will. Es hat handfestere Motive. Sein Autor, der vor allem Musiker ist, will sich eine Klangwelt erschließen, die über vollkommen andere Strukturen verfügt als jene, die ihm von der westlichen Musik vertraut sind. Um sie zu verstehen, taucht er in den Inselalltag ab, in dem nächtliche Dämonen in Form glühender Feuerbälle ebenso normal sind wie angeleinte Bienen, die als Spielzeug ihre Kreise um Kinderfinger drehen, tägliche Bäder für Kampfgrillen, als „Blumen“ bezeichnete tänzerische Handbewegungen oder Gongs, die von Schmieden auf die Tonlagen „Schönes Meer“, „Verbrannte Tamarinde“ oder „Feld blühender Schraubenbäume“ gestimmt werden.
McPhee übernimmt das Selbstverständnis der Balinesen, für die stunden- und nächtelange musikalische und dramatische Darbietungen genauso zum Dorfleben gehören wie Opfergaben oder Reinigungsriten für Häuser an dämonengefährdeten Standorten. Stets aufs Neue überrascht ihn „die natürliche Ruhe, die fast beiläufige Art“ des dörflichen Musizierens. Wer lange, ungeheuer detaillierte Passsagen über Struktur und Wesensart einer – für westliche Ohren – völlig andersartigen Musiktradition lesen will, ist bei McPhee ebenso gut aufgehoben wie alle, die sich in das elaborierte System verschiedener balinesischer Tanzstile und ihrer Abstimmung auf Melodie und Rhythmus der Musik vertiefen wollen.
Als literarische Figur taucht McPhee auch am Rande in einem Bali-Roman auf, den der britische Anthropologe Nigel Barley vor sechs Jahren veröffentlicht hat und der nun ebenfalls auf Deutsch erscheint. Er heißt „Bali. Das letzte Paradies“ und stellt den deutschen Maler, Musiker und Naturforscher Walter Spies (1895–1942) ins Zentrum. Dessen Haus auf Bali war in den 1930er-Jahren ein Ort regen kulturellen Lebens und Anlaufstelle für zahllose westliche Künstler, die der Ruf der Insel als exotisches Paradies in Scharen anlockte – unter ihnen Charlie Chaplin, Vicki Baum, das berühmte Anthropologenpaar Margaret Mead und Gregory Bateson oder die Woolworth-Erbin Barbara Hutton.
Als Roman ist „Das letzte Paradies“ ein seltsames Hybrid, dessen üppig ausgeschmückte Erzählhandlung um eine libertäre Expat-Kolonie wie eine angestrengte Behauptung über einer Vielzahl historischer Fakten, ethnologischer Informationen und kulturgeschichtlicher Details liegt. Diese beiden Aspekte finden nicht recht zusammen. Der begabte, amoralische Charismatiker Walter Spies irrlichtert gutmütig als großer Naiver durch diese spätkoloniale Welt, deren Regeln ihm am Ende den Garaus machen werden. Das Buch hat schöne Stellen, aber Barley findet nicht recht aus der Rolle des Anthropologen und in die des Schriftstellers hinein. Ganz anders als der Musikwissenschaftler Colin McPhee, der in „Ein Haus in Bali“ als Autor eines höchst literarischen Reiseberichts beste Figur macht.