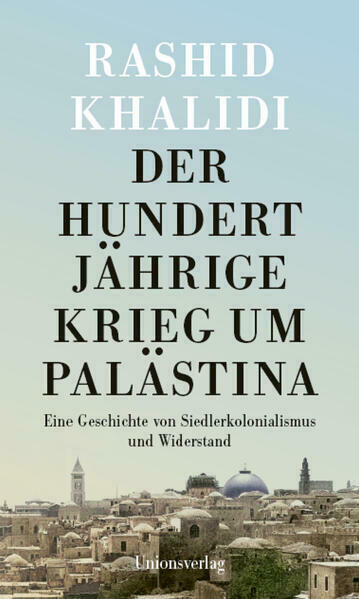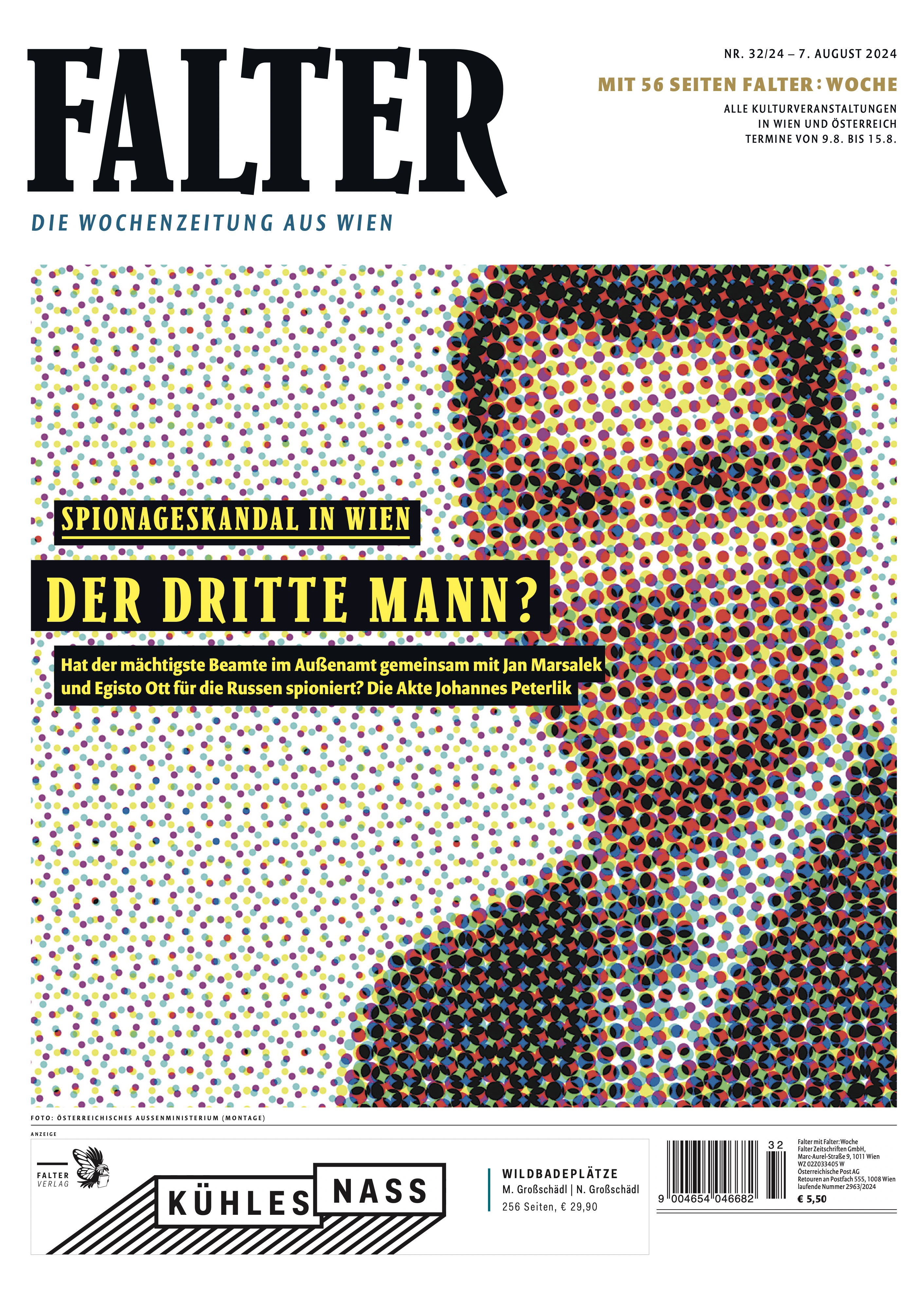
Krieg der Erzählungen im Nahen Osten
Robert Misik in FALTER 32/2024 vom 07.08.2024 (S. 17)
Die zionistische Kolonisation Palästinas war eine friedliche Besiedlung kargen Landes durch europäische Juden, die dieses erst urbar und bewohnbar machten; eine Besiedlung, die durch den Naziterror und den Holocaust beschleunigt wurde; ab der Staatsgründung Israels 1948 sah sich die junge Nation fanatischer Gegnerschaft ihrer Nachbarn ausgesetzt, verteidigte sich aber heldenhaft gegen deren Vernichtungsfantasien. Palästinenser gab es in diesem "Land ohne Volk" sowieso keine, die seien eine Erfindung arabischer Israelfeinde. Ausgestreckte Hände haben die Araber immer zurückgewiesen, anstelle dessen auf Terror und hinterhältige Arglist gesetzt. Wenn gelegentlich auch Israel Blutbäder anrichtet, dann nur, um existenzielle Gefahr abzuwehren.
So in etwa lautet das jahrzehntealte PR-Narrativ, das heute dröhnend die Debatten dominiert. Rashid Khalidi, der palästinensischstämmige Historiker und Professor an der New Yorker Columbia-Universität, erzählt in "Der Hundertjährige Krieg um Palästina" die Gegengeschichte.
Schon die Kolonisation ab 1917 - nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches -war vom Geist der Zeit getragen: Jüdische Siedler brachten die indigene Bevölkerung um ihr Land, hinter sich hatten sie die bewaffneten Truppen des britischen Imperiums, das Palästina besetzt hielt.
Dass die Europäer "den Wilden" den Fortschritt bringen, war sowieso Zeitgeist. Enteignung und Vertreibung nahmen später mit der Staatsgründung Israels rasante Fahrt auf, die sofort zu ethnischen Säuberungen führte. Die "Nakba" ("Katastrophe"), die Vertreibung und Beraubung von Hab und Gut, ist das große palästinensische Trauma. Rashid Khalidi, Nachkomme einer bedeutenden palästinensischen Notabelfamilie, dekliniert diese Geschichte über ihre Stationen hinweg: den Suezkrieg, den Sechstagekrieg, die Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlandes, die illegalen Siedlungstätigkeiten, das Erwachen eines palästinensischen Nationalbewusstseins und die Gründung der PLO bis zur Intifada, den gescheiterten Friedensinitiativen und in die Jetztzeit.
Khalidi zeichnet ein Panorama von Aggression und Entrechtung durch Israel. Die Ereignisgeschichte ist für ihn untrennbar verbunden mit einem Krieg der Narrationen, mit "geschickter, verzerrender Propaganda" Israels. Ein endloser "Strom von Gräueltaten".
Khalidi setzt dem Schwarz-Weiß der Netanjahu-Propaganda eine Gegengeschichte entgegen, die freilich auch ein wenig mit dem Holzhammer zurechtgeklopft ist. Dabei geht Khalidi auch mit den verschiedenen palästinensischen Organisationen hart ins Gericht. Eskalationsstrategien seien dafür verantwortlich, dass Israel als "Opfer irrationaler, fanatischer Peiniger" dastehe. Heute gebe es nun einmal "zwei Völker in Palästina, unabhängig davon, wie sie entstanden sind", die beide legitime Rechte auf Selbstbestimmung hätten und einen Kompromiss finden müssten. Damit hat es sich schon weitgehend mit den Ambivalenzen, letztendlich strickt auch Khalidi an einem "Mythos palästinensischer Nationalgeschichtsschreibung"(Süddeutsche Zeitung).
Dennoch ist Khalidis Buch höchst lesenswert. Einerseits als Gegengeschichte zur heute dominanten Erzählung. Andererseits, weil es in den Krieg der Phrasen Fakten und Nüchternheit bringt. Inwiefern ist der Begriff des "Siederkolonialismus" brauchbar? Was meint er überhaupt? Inwiefern ist der Begriff der "Apartheid" anwendbar auf zerklüftete Geografien, in denen auf Menschen verschiedener Herkunft unterschiedliche Rechtssysteme wirken -die einen also mehr Rechte haben als die anderen? Die Kritik, die Khalidi vorträgt, wird heute viel zu schnell als "antisemitisch" verleumdet.
Zugleich: Die Übung, in einer tragischen Konstellation, in der beide Seiten oftmals auf ihre Weise recht haben, jeweils mit den Augen der anderen zu sehen, die muss der Leser und die Leserin selbst aufbringen.So in etwa lautet das jahrzehntealte PR-Narrativ, das heute dröhnend die Debatten dominiert. Rashid Khalidi, der palästinensischstämmige Historiker und Professor an der New Yorker Columbia-Universität, erzählt in "Der Hundertjährige Krieg um Palästina" die Gegengeschichte.
Schon die Kolonisation ab 1917 - nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches -war vom Geist der Zeit getragen: Jüdische Siedler brachten die indigene Bevölkerung um ihr Land, hinter sich hatten sie die bewaffneten Truppen des britischen Imperiums, das Palästina besetzt hielt.
Dass die Europäer "den Wilden" den Fortschritt bringen, war sowieso Zeitgeist. Enteignung und Vertreibung nahmen später mit der Staatsgründung Israels rasante Fahrt auf, die sofort zu ethnischen Säuberungen führte. Die "Nakba" ("Katastrophe"), die Vertreibung und Beraubung von Hab und Gut, ist das große palästinensische Trauma. Rashid Khalidi, Nachkomme einer bedeutenden palästinensischen Notabelfamilie, dekliniert diese Geschichte über ihre Stationen hinweg: den Suezkrieg, den Sechstagekrieg, die Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlandes, die illegalen Siedlungstätigkeiten, das Erwachen eines palästinensischen Nationalbewusstseins und die Gründung der PLO bis zur Intifada, den gescheiterten Friedensinitiativen und in die Jetztzeit.
Khalidi zeichnet ein Panorama von Aggression und Entrechtung durch Israel. Die Ereignisgeschichte ist für ihn untrennbar verbunden mit einem Krieg der Narrationen, mit "geschickter, verzerrender Propaganda" Israels. Ein endloser "Strom von Gräueltaten".
Khalidi setzt dem Schwarz-Weiß der Netanjahu-Propaganda eine Gegengeschichte entgegen, die freilich auch ein wenig mit dem Holzhammer zurechtgeklopft ist. Dabei geht Khalidi auch mit den verschiedenen palästinensischen Organisationen hart ins Gericht. Eskalationsstrategien seien dafür verantwortlich, dass Israel als "Opfer irrationaler, fanatischer Peiniger" dastehe. Heute gebe es nun einmal "zwei Völker in Palästina, unabhängig davon, wie sie entstanden sind", die beide legitime Rechte auf Selbstbestimmung hätten und einen Kompromiss finden müssten. Damit hat es sich schon weitgehend mit den Ambivalenzen, letztendlich strickt auch Khalidi an einem "Mythos palästinensischer Nationalgeschichtsschreibung"(Süddeutsche Zeitung).
Dennoch ist Khalidis Buch höchst lesenswert. Einerseits als Gegengeschichte zur heute dominanten Erzählung. Andererseits, weil es in den Krieg der Phrasen Fakten und Nüchternheit bringt. Inwiefern ist der Begriff des "Siederkolonialismus" brauchbar? Was meint er überhaupt? Inwiefern ist der Begriff der "Apartheid" anwendbar auf zerklüftete Geografien, in denen auf Menschen verschiedener Herkunft unterschiedliche Rechtssysteme wirken -die einen also mehr Rechte haben als die anderen? Die Kritik, die Khalidi vorträgt, wird heute viel zu schnell als "antisemitisch" verleumdet.
Zugleich: Die Übung, in einer tragischen Konstellation, in der beide Seiten oftmals auf ihre Weise recht haben, jeweils mit den Augen der anderen zu sehen, die muss der Leser und die Leserin selbst aufbringen.
Wie Hamas meine Kinder zu Israelis machte
Tessa Szyszkowitz in FALTER 8/2024 vom 21.02.2024 (S. 34)
Der 7. Oktober verändert uns. Über Identität und Krieg1. Wie wir sindRashid Khalidis Buch liegt bei meiner Tochter auf dem Sofa, als ich in Brooklyn eintreffe. "The Hundred Year's War on Palestine" heißt es, es wird im April auch auf Deutsch erscheinen. Emma liest es mit ihren Freunden in ihrer Buchgruppe. Seit dem 7. Oktober wollen sie mehr dazu wissen, wie es zu einer derartigen Katastrophe wie dem Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten und dem darauffolgenden Krieg Israels gegen die Palästinenser in Gaza kommen konnte. Der in Amerika geborene palästinensische Intellektuelle Rashid Khalidi hat den palästinensischen Nationalismus von Grund auf studiert. Ich habe seine ersten Bücher im gleichen Alter gelesen, in dem Emma jetzt ist. Mitte zwanzig.
Der 7. Oktober ist eine Zäsur. Seit dem Holocaust sind nicht so viele Jüdinnen und Juden auf einen Schlag ermordet worden. In Israel und in der ganzen Welt führt das Pogrom der Hamas gegen Israelis unter der jüdischen Bevölkerung zu einer Re-Traumatisierung. Wenn das in Israel passieren kann, dann ist keine Jüdin, kein Jude mehr sicher auf der Welt. Nicht nur die rechtsextreme israelische Regierung ist der Meinung, man müsse die Hamas jetzt "auslöschen". Unser jüdischer Freundeskreis in Israel, in Amerika und in Europa spaltet sich über diese Frage. Israel muss reagieren, das ist klar. Ein Teil unterstützt den Krieg in Gaza. Ich gehöre zu denen, die es für eine fatale Fehleinschätzung halten, dass man eine politische Bewegung, die so tief verwurzelt ist wie Hamas in Gaza, vernichten kann. Vor allem nicht mit einem Krieg, der auf dem Rücken einer Zivilbevölkerung von über zwei Millionen Menschen ausgetragen wird.
Vier Monate nach dem 7. Oktober stehe ich in einem zerstörten, ausgebrannten Haus im Kibbuz Be'eri. Hier wurde Avshalom Haran von der Hamas erschossen. Seine Frau, die Tochter, ihr Mann und ihre Kinder wurden nach Gaza verschleppt, kamen im November frei. Ein Familienmitglied, Tal Shohan, der einen österreichischen Pass besitzt, ist noch in Gaza. Wie über 100 weitere Geiseln. Es ist unfassbar grauenhaft, was hier passiert ist.
Und auch, was ein paar Kilometer weiter passiert. Alle paar Minuten höre ich Detonationen im Hintergrund. Die israelische Armee bombardiert Häuser im Gazastreifen. Der beginnt direkt hinter dem Stacheldraht des Kibbuz. Bis zu 80 Prozent der Häuser in Gaza, lesen wir, sind zerstört. 28.600 Palästinenser wurden bereits laut Angaben der Hamas-Regierung getötet Die Versorgung ist katastrophal unzureichend. Jetzt droht Benjamin Netanjahu, auch noch die Grenzstadt Rafah im Süden zu bombardieren. Weder werden dabei viele Geisel befreit noch die gesamte Hamas-Führung gefasst. Wir schauen mit Entsetzen auf diese Entwicklung: Israel kämpft einen aussichtslosen, grausamen Kampf.
In Israel steigt die Wut gegen den Regierungschef, der sich mit einem Deal - Geisel gegen Gefangene und Waffenpause - Zeit lässt. Im Kibbuz Be'eri werden die ersten zerstörten Häuser niedergerissen. In Tel Aviv sind die Restaurants wieder voll, nach vier Monaten beginnt so etwas wie Alltag. Auch in Ramallah, der Hauptstadt der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland, wird um ein normales Leben gerungen, obwohl nichts normal ist. "Wieso helft ihr in Europa uns nicht?", fragt mich Shatha Musallam, eine junge Palästinenserin, die in einem Start-up arbeitet: "Eure Regierungen schauen einfach zu, wie die Israelis einen Massenmord an den Palästinensern in Gaza begehen."
Weitab vom Kampfgeschehen, in Europa und Amerika, wird eine hitzige Diskussion darüber geführt, ob die israelische Regierung im Gazastreifen überreagiere. An den Universitäten gehen die Wogen besonders hoch. Jüdische Studentinnen berichten, dass sie angepöbelt werden, weil sie eine israelische Fahne am Rucksack tragen. Gerade noch wurden Studierende als "Schneeflocken" verunglimpft, als übermäßig sensibel. Jetzt haben viele innerhalb weniger Wochen Meinungsgranaten in die Hand genommen, die sie mit Lust explodieren lassen. Die verzweifelte Lage der Palästinenser im Gazastreifen politisiert. Manche der verbalen Auseinandersetzungen enden handgreiflich. In Berlin wird ein jüdischer Student krankenhausreif geschlagen. Ein israelischer Professor an der Columbia University in New York, Shai Davidai, ruft in einem Video, er werde seine Kinder nicht auf diese Uni schicken, weil jüdische Studierende nicht ausreichend geschützt werden.
Rashid Khalidi, der seit Jahrzehnten an der Columbia University lehrt, soll mir Auskunft geben, was da los ist. Meine Tochter und ihre Freunde möchten bei dem Interview dabei sein. Der Professor hat nichts dagegen. So sitzen wir zu fünft beim Interview auf Zoom. Als ich Khalidi frage, was auf dem Campus los ist, antwortet er: "Wir sehen eine zunehmende Unterdrückung pro-palästinensischer Meinungen."
Wir sind überrascht. Werden nicht eher die jüdischen und israelischen Studierenden bedroht?"Nicht nur sie", sagt Khalidi. Er empfindet das akademische, politische, soziale Umfeld, in dem er seit Jahrzehnten lehrt und lebt, als feindselig. "Israelische und palästinensische Studierende sind von den Vorgängen im Nahen Osten traumatisiert. Wir sollten ihnen jede erdenkliche Unterstützung anbieten", fordert der Professor. Wir verlassen das Gespräch nachdenklich. Arabern und Juden geht es ähnlich. Sie fühlen sich alleingelassen. Es geht nicht darum, ihnen vorzuhalten, wie fest die westlichen Regierungen an der Seite Israels stehen oder wie sehr viele junge Studierende in Solidarität mit den Palästinensern auf die Straße gehen. Wer sich bedroht fühlt, dem wird das nicht genügen.
Nach einer Anhörung im US-Kongress muss die Uni-Rektorin der University von Pennsylvania zurücktreten. Liz Magill hat gesagt, dass der Aufruf zum Genozid gegen Juden nicht eindeutig dem Code of Conduct an ihren Unis widerspricht. Juristisch war ihre Antwort richtig, die Freedom of Speech wird in den USA laut Verfassung sehr hoch gehalten und geschützt. Aber in der aufgeheizten Stimmung nach dem 7. Oktober kann Magill von der Abgeordneten, die sie hart verhört hat, leicht instrumentalisiert werden. Elise Stefanik ist eine Trump-Unterstützerin. Sie hat die Anhörung darüber, wie man Meinungsfreiheit und Schutz vor Hate Speech ausbalancieren kann, zum Schauprozess gegen die liberalen Unis an der Ostküste uminszeniert. Mit Erfolg.
Liz Magill hätte das vielleicht verhindern können, wenn sie ganz klar gesagt hätte, dass sie gegen Genozid-Aufrufe ist. Das ist nicht nur eine Frage des Prinzips. Es ist auch so, dass mein Sohn Adam gerade an genau dieser Uni studiert. Seit dem 7. Oktober schickt er uns Videos vom Campus. Einmal marschieren die Palästinenser, dann die Israelis. Die pro-palästinensischen Demonstrationen sind größer, lauter, aggressiver. Da gehen auch viele mit, die sich gerade politisieren. Für Adam sind nicht die israelischen oder arabischen Freunde das Problem. Die Betroffenen sind oft informierter und diskutieren fundierter. Schlimm sind für ihn einseitige Soli-Adressen von Instant-Experten für den Nahostkonflikt auf Instagram. Plötzlich spürt er in den Schächten der sozialen Medien einen kalten Sog. Nicht alle haben Empathie mit den Juden.
Für einen 19-Jährigen ist es nicht so leicht, sich in dieser polarisierten Welt zurechtzufinden. Adam ist in Wien geboren, in Moskau und London aufgewachsen, hat in Israel seine Bar Mitzwa gefeiert. Er hat einen israelischen Vater und eine österreichische Mutter. Am 7. Oktober hat er mich angerufen: "Erklär mir das, wie ist das möglich, wie können Menschen solche Gewalttaten an wehrlosen Menschen verüben?"
Das ist der zweite Krieg nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, den meine gerade erwachsenen Kinder erleben. Ich erinnere mich gut an meinen Schock als junge Reporterin aus dem friedlichen Wien, als ich für Profil Anfang der 90er-Jahre am Balkan die Überlebenden von Vergewaltigungslagern interviewte. Bosnische Frauen waren von serbischen Soldaten systematisch vergewaltigt worden -oft monatelang. Aus der Ostukraine wurde 2022 ebenfalls berichtet, wie russische Soldaten ukrainischen Frauen die Zähne einschlugen, damit sie noch wehrloser sind, wenn sie sie vergewaltigen. Auch am 7. Oktober sticht die Gewalt der Hamas gegen Frauen besonders heraus. Vielleicht geht es mir als Frau besonders nahe, aber die Bilder und Videos, die im Internet von den vergewaltigten Israelinnen kursieren, rauben mir den Schlaf. Für die Jüngeren ist es noch viel schwerer, mit diesen bedrohlichen, aufwühlenden Bildern umzugehen.
Wie so etwas möglich ist?"Gewalt wird dadurch angefacht, dass man leichtgläubigen Leuten, die in die Hände von kundigen Fachleuten des Terrors fallen, ausschließliche Identitäten aufschwatzt", sagt Amartya Sen. Der indische Nobelpreisträger und Philosoph beschreibt in seinem brillanten Buch "Identität und Gewalt", wie er als Kind in den 40er-Jahren erlebte, dass friedliche Nachbarn innerhalb von Monaten zu "rücksichtslosen Hindus und erbitterten Muslimen" mutierten, die sich gegenseitig abschlachteten. Für "die eigenen Leute".
Das Positive einer Selbstbestimmung kann ins Negative verkehrt werden, wenn eine Identität als Ausgrenzung einzementiert wird. Die österreichische Extremismus-Forscherin Julia Ebner hat diese Identitätsfusion ebenfalls untersucht - das einzelne Ich wird mit der Gruppe fusioniert. Hemmschwellen werden im Rudel leichter übersprungen: "Reduzierende Gruppenidentitäten werden von Regierenden oft eher forciert als aufgebrochen", erzählt sie mir in einem Falter-Interview. "Dabei wäre das wichtig, um Radikalisierungen zu verhindern."
Am schlimmsten wirkt sich diese Identitäts-Zementierung aus, wenn sie in Nationalismus aufgeht. Benedict Anderson hat dies in seinem Grundsatzwerk "Imagined Communities" analysiert. Die Erkenntnis, dass geschichtliche Ereignisse rekonstruiert werden, damit sie in nationalistische Narrative passen, war für mich ebenso wichtig wie die Folge daraus: Wie sich auf dieser imaginierten Grundlage Massen dazu bewegen lassen, sich gegenüber "den Anderen" zu verhärten, sie als Feind zu sehen. Ihre Entmenschlichung ist dann nur noch ein kleiner Schritt. Ich habe all das in meiner Dissertation "Trauma und Terror" 2006 verarbeitet, in der ich palästinensischen und tschetschenischen Selbstmordterrorismus erforscht habe. Trotzdem ist es mir immer ein Stück weit unverständlich geblieben, zu welchen Grausamkeiten Menschen in der Lage sind.
Mein älterer Sohn arbeitet als Musikproduzent in London. Er ist fassungslos darüber, dass nicht alle genauso entsetzt sind über das Massaker vom 7. Oktober wie wir. Nicht alle Musiker haben große Sympathien für die Lage der Israelis. Sie stammen oft aus Familien, die vom britischen Kolonialismus geprägt wurden. Manche fühlen sich der Solidaritätsbewegung mit der palästinensischen Zivilbevölkerung näher. Die Israelis und ihre Sympathisanten denken, sie verteidigen die Zivilisation gegen islamistische Fanatiker. Die Palästinenser und ihre Unterstützer aber demonstrieren gegen das Bombardement der Zivilbevölkerung von Gaza, in ihren Protesten kanalisiert sich die Wut gegen jede Unterdrückung.
Wir diskutieren darüber, ob die Videos vom 7. Oktober auf Instagram gestellt werden sollen, um die Weltöffentlichkeit aufzurütteln: "Die Welt muss doch sehen, was da geschehen ist", sagt mein Sohn.
Ich halte dagegen. Gewaltvideos schockieren, traumatisieren. Und sie stumpfen gleichzeitig auch ab, wenn sie neben Katzenvideos laufen. Ich glaube nicht, dass sie die Gegner Israels zu mehr Empathie gegenüber den Opfern anregen. Wir einigen uns darauf, mit größter Vorsicht mit sozialen Medien umzugehen.
In meiner Familie wird vielleicht zum ersten Mal in einem halben Jahrhundert nicht über Politik gestritten. Nicht, weil wir über alles einer Meinung sind. Aber wir gehen vorsichtiger miteinander um. Und wir behalten uns vor, Empathie für die Opfer beider Seiten zu haben. Diese zwei Positionen balancieren wir mit Vorsicht nebeneinander. Und lassen uns nicht von wildgewordenen Massen gegen eine Seite verhärten.
Aber leicht ist es nicht. Denn beide Seiten fahren schweres Geschütz auf. Anfang 2024 bringt Südafrika Israel vor den Internationalen Gerichtshof ICJ -wegen des Vorwurfs des Genozids gegen die Palästinenser im Gazastreifen. Historisch gesehen ist es infam, ausgerechnet den Israelis zu unterstellen, sie begingen Genozid. Aber um der hilflosen Zivilbevölkerung in Gaza zu helfen, werden alle möglichen juristischen Wege beschritten. Es handle sich beim Krieg gegen die Hamas nicht um Genozid, lese ich bei Haaretz-Journalist Anshel Pfeffer, es mache ihm aber große Sorgen, dass "wir hier in Israel Politiker vom messianischen Flügel in der Regierung sitzen haben, die diesen Krieg als Erfüllung des Schicksals des jüdischen Volkes sehen". Sie seien "Génocidaires". So nannte man die Hutus, die 1994 die Tutsi in Ruanda vernichten wollten: Völkermörder. Ende Jänner urteilt der ICJ: Israel muss alles tun, um einen Völkermord zu verhindern.
Umgekehrt werden viele Juden und Israelis nicht müde, den Angriff der Hamas vom 7. Oktober als genozidal zu bezeichnen. Die Angst, als Juden wieder verfolgt zu werden, sitzt tief. Selbst ich spüre sie. Meine Kinder haben neben der österreichischen auch eine israelische Staatsbürgerschaft. Seit dem 7. Oktober wissen sie, dass ein israelischer Pass mit der jüdischen Menora im Staatswappen nicht nur ein folkloristischer Spaß ist. Dass sie Teil einer Schicksalsgemeinschaft sind. Die Hamas hat meine Kinder in gewissem Sinn erst so richtig zu Israelis gemacht.
"Wir konfrontieren uns nicht mehr als öffentliche Bürger, sondern als private Einzelne", schreibt die Philosophin Isolde Charim im Falter. "Jeder Konflikt wird zur Identitätsfrage aufgeladen. Das Ich aber ist unverhandelbar. Daher rührt die Unerbittlichkeit." Wenn es so ist, dass wir über das Grundlegende diskutieren, über unser Ich, dann müssen wir uns auch bewusst sein, woher unsere Identitäten kommen und was wir aus ihnen ableiten. Für mich wird der Begriff Genozid viel zu inflationär angewendet. Denn: Ich habe mich bis heute nicht vom Genozid erholt, den die Generation meiner Großeltern gegen die Großeltern meiner Kinder geplant hatte.
2. Wie wir waren
Als ich 1995 in die Familie Kollek einheiratete, trat ich zum Judentum über. Ich fand das nicht notwendig, aber meine Schwiegereltern schon. Ich bin Atheistin und wäre auch als ewige Schickse gut durchs Leben gekommen. Um aber die jüdische Linie der Familie meines damaligen Mannes nicht zu unterbrechen, trat ich über. Die Religion geht im Judentum über die Mutter. Das gilt auch, wenn die Mutter das atheistische Enkelkind von Nazis ist. Meine Kinder finden es gut, dass sie durch meine Konversion auch vom orthodoxen Rabbinat in Israel als Juden anerkannt sind. Falls sie mal in einer Synagoge heiraten wollen, in die sie sonst fast nie gehen. Das ist alles absurd. Aber Teil dieser Geschichte.
Der Vater meiner Kinder und ich sind längst in Freundschaft geschieden und jetzt fragen mich die Leute öfters, ob ich noch Jüdin bin. Aus Ehen kann man austreten, aus dem Judentum aber nicht. Und: In meinem Fall geht es sowieso nicht um Religion, es geht um Identität. In meiner habe ich mich zurechtgefunden. Ich finde, 2023 kann ich gut eine progressive, feministische Pro-Europäerin sein, plus eine jüdisch konvertierte Atheistin. Ich habe nur ein Bekenntnis. Als kritische Journalistin und Historikerin bin ich schon allein aufgrund der traumatischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts stets auf der Hut vor einer Sache: Vereinnahmungen.
Sich nicht ungeschaut in eine politische Bewegung hineinziehen zu lassen, das hatten meine Eltern in unsere Erziehung gepackt. Sie haben mich mit dieser Vorsicht erzogen. Das hängt direkt mit dem deutschösterreichischen Trauma ihrer Herkunft zusammen. Schließlich waren ihre Eltern Nazis.
Meine Mutter wurde in Zoppot geboren, einem Kurort außerhalb von Danzig. Ihr Vater wurde 1939 Gauhauptmann für Verwaltung und Justiz in Danzig. Es ist nicht leicht, seine Tagebücher zu lesen. Meine Mutter hat sie in ihren Erinnerungen zitiert, die sie für ihre Enkelkinder aufgeschrieben hat. 1918 spricht er sich gegen die Novemberrevolution aus. Aus vielen Gründen. Aber auch, weil "die Juden sich auf einmal in den Vordergrund drängten". Es ist das einzige Mal, dass er etwas Antisemitisches aufgeschrieben hat.
Aber sein Lebensweg spricht Bände. Er geht als junger Jurist nach Danzig, tritt der katholischen Zentrumspartei bei. 1934, da ist er schon Senator für Inneres, wechselt er offiziell zur NSDAP. Er spürt den neudeutschen Aufwind und nennt sich von Wierzinski auf Wiers-Keiser um. Als Justizsenator unterschreibt er die Gesetze zur Rassentrennung gegen Juden. Willibald Wiers-Keiser wird Teil der Bürokratie der Unmenschlichkeit. Da er knapp vor Ende des Krieges im Dezember 1944 an Krebs gestorben ist, habe ich ihn nie fragen können, wie das passieren konnte. Meine Großmutter Elisabeth starb auch vor meiner Geburt.
Mein Vater wurde 1938 in Graz geboren, da hatten sich die Grazer gerade Hitler an den Hals geworfen. Auch Franz und Thessa, meine Großeltern väterlicherseits, waren in der NSDAP. Mein Vater hat Hinweise darauf in ihrer Nachlassenschaft gefunden. Meine Eltern, die sich nur ein gutes Jahrzehnt nach Ende des Krieges beim Studium in Wien kennenlernten, hatten immer eine klare Haltung zu dem fatalen Irrtum ihrer Eltern: "Nie wieder." So bin ich aufgewachsen.
Ich kam nach Israel zuerst als Besucherin und dann als Berichterstatterin, als gerade die erste Intifada tobte. Zum ersten Mal wurde klar, dass man die 1967 besetzten Gebiete Gaza und Westjordanland nicht so einfach kontrollieren konnte, wenn sich die palästinensische Bevölkerung erhob. Aus dieser Erkenntnis speiste sich die Energie für den Oslo-Friedensprozess. 1993 kam es zur gegenseitigen Anerkennung der PLO und Israels. Doch aus den hochfliegenden Friedensplänen wurde nichts. Die Tauben waren zu schwach und die Falken zu stark. Terroranschläge, Siedlungsausbau und gegenseitiges Misstrauen ruinierten die Chance auf eine Zweistaatenlösung.
Drei Jahrzehnte später stehen sich Hamas und die israelische Regierung unversöhnlich gegenüber. Ich habe in all den Jahren unzählige Israelis und Palästinenser interviewt, darunter viele Extremisten, Hamas-Vertreter wie israelische Siedler. Der radikale Rassismus dieser beiden Gruppen ließ mich oft sprachlos zurück. Ich möchte die beiden Ideologien nicht gleichstellen oder vergleichen. Jede für sich ist entsetzlich. Wenn Israel die Siedler nicht aus den besetzten Gebieten holt, das war schon in den 90er-Jahren klar, dann gibt es keine Chance auf eine Zweistaatenlösung.
Die Eskalation scheint jetzt keine Grenzen mehr zu kennen. Eine israelische Freundin, deren Sohn eingezogen wurde, ruft mitten in der Nacht aus Tel Aviv an: "Mein Sohn wird Dinge erleben, die niemand erleben soll. Er wird als ein anderer Mensch zurückkommen." Sie weint. Außer tröstenden Worten bleibt da nichts in dieser Nacht. Kein Kind soll in den Krieg müssen.
Aber ich habe leicht reden. Als ich in Jerusalem gerade 1996 mein erstes Kind bekam, wurde Israel von einer Bombenkampagne palästinensischer Terrorgruppen erschüttert. Palästinensische Selbstmordbomber mit Sprengstoffgürteln und Bomben im Rucksack setzten sich besonders gerne neben junge Mütter mit Kindern in Kaffeehäuser und Autobusse. Die Fenster in unserer Wohnung klirrten, als um die Ecke auf der Jaffa-Straße wieder ein Bus in die Luft flog. Die religiösen Mitarbeiter der Organisation Zaka, die nach jüdischer Tradition alle Leichenteile aufsammeln, um Tote möglichst komplett zu beerdigen, mussten auf die Straßenlaternen klettern, um Hautfetzen einzusammeln. Die Hoffnung auf Frieden, die wir 1993 bis 1995 während der Oslo-Abkommen gespürt hatten, wurde in die Luft gesprengt. Benjamin Netanjahu gewann im Juni 1996 die Wahlen.
1998 nahm ich meine Kinder an der Hand und wir verlegten unseren Wohnsitz von Jerusalem nach Brüssel. Später nach Moskau. Dann nach London. Der Geschichtsunterricht in den Schulen war für meine Kinder eine spezielle Übung. Mein Sohn Adam pflegte zu seufzen: "Wir sollen ein Essay über unsere Familiengeschichte verfassen. Dann schreibe ich eben wieder, dass der eine Urgroßvater den anderen Urgroßvater umbringen wollte, bloß weil der eine Deutsche und der andere Jude war. Das geht immer."
Seinen Sinn für Humor -auch den schwarzen - hat er von seiner jüdischen Großmutter Vita, die vor den Nazis aus Riga nach Palästina flüchtete. Dort gründete sie eine Familie mit Paul Kollek, dem jüngeren Bruder von Teddy Kollek, der später Bürgermeister von Jerusalem wurde. Sie kamen aus Wien, um den jüdischen Staat aufzubauen.
Für mich war jede Geburt eines meiner Kinder ein Sieg über Hitler. Sie feiern jüdische Feste, aber auch Weihnachten. Sie sprechen Deutsch mit mir und radebrechen Hebräisch. Mit dem Englischen haben sie eine neutrale Hauptsprache gefunden. Bis zum 7. Oktober waren sie gut aufgehoben in einer globalisierten Welt an Freundschaften. Die Existenz Israels sollte eine Garantie für die Sicherheit aller Juden bedeuten. Jetzt aber ist klar geworden: Die "Netanjahu-Doktrin", dass man "das Palästinenser-Problem auf kleiner Flamme kontrollieren" könne, hat sich als gefährlicher Blödsinn herausgestellt.
3. Wie wir sein werden
Meine palästinensisch-französische Freundin Nadia Sartawi meldet sich aus Paris: "Wir haben doch gewusst, dass der Status quo nicht zu halten ist." Das stimmt. Ihr Vater Issam hat in den 70er-Jahren versucht, die ersten Friedensgespräche zwischen der PLO und Israel mit Hilfe von Bruno Kreisky in Gang zu bringen. In meinem Buch "Der Friedenskämpfer" habe ich 2011 nachgezeichnet, wie die Versuche eines friedlichen Ausgleichs daran scheiterten, dass viele lieber zu Gewalt als zu Kompromissen griffen. Seit dem 7. Oktober gehen manche weiter in die Sackgasse, in der am Ende, ausweglos, wieder nur Gewalt herrscht.
Unsere Regierungen sollten für das Existenzrecht Israels eintreten, das ist klar. Wenn aber palästinensische Kinder bombardiert werden, kann die österreichische Regierung nicht einfach nur die israelische Fahne hissen. Sie sollte sich auch klar für den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung aussprechen. Und für einen Palästinenserstaat. Das muss sich trotz unserer Geschichte -und wegen ihr - ausgehen. Eine Zweistaatenlösung oder sonst ein friedlicher Ausgleich wird nur mit gehörigem Druck von außen entstehen.
Am Ende unseres Interviews mit Rashid Khalidi an der Columbia University sage ich: "Professor Khalidi, meine Tochter und Sie haben etwas gemeinsam. Sowohl die Khalidis wie die Kolleks haben lange Jahre einen Bürgermeister von Jerusalem gestellt." Yussuf al-Khalidi von 1870-76,1878-79 und 1899-1906. Teddy Kollek von 1965 bis 1993. Ersterer war Rashid Khalidis Urgroßvater. Zweiterer Emmas Großonkel.
Khalidi ist überrascht. Teddy Kolleks Politik, Jerusalem als Hauptstadt Israels auszubauen, lehnte er ab. Aber: "Kollek hat uns geholfen, die Khalidi-Bibliothek in Ostjerusalem zu schützen. Da hat er das Richtige getan." Die Khalidi-Bibliothek hält eine der größten Privatsammlungen an arabischen Texten. Wie schön es wäre, wenn alle es schafften, das Erbe dieses kulturell so reichen Landes gemeinsam zu wahren.
Konstruktiv wird das nur gehen, wenn Israelis und Palästinenser auf Augenhöhe miteinander umgehen. Khalidi sagt: "Heute haben wir ein System, in dem ein Volk das andere dominiert. Solange diese Strukturen der Ausgrenzung von der Macht existieren, kann man keinen echten Dialog führen."
Als Enkelin von Nazis und Mutter von Israelis, das ist mir sehr bewusst, sehe ich die Welt in einer ganz bestimmten Art und Weise. Um zu wissen, wie man zum Mittäter wird, brauche ich nur das Tagebuch meines Großvaters zu lesen. Wohl auch deshalb fühle ich einen starken Instinkt, Schwächeren zu helfen. Wir sollten nicht schweigen, wir sollten nicht wegsehen, wir können uns engagieren, wir können jene unterstützen, die konstruktive Positionen einnehmen.
"Die Freiheit zu haben, sich mit kontroversen Geschichten zu beschäftigen und mit Menschen zu arbeiten, die sich solidarisch, widerständig, empathisch und kreativ mit der Vergangenheit -und Gegenwart - auseinandersetzen, ist ein Privileg", schreibt die Historikerin Mirjam Zadoff. Wir sollten uns diese Freiheit nehmen.
Wenn wir uns im Klaren sind, wer wir sind, können wir die Positionen anderer besser verstehen. "Wenn ich nicht für mich bin, wer wird dann für mich sein?", soll Hillel der Ältere gesagt haben: "Und wann, wenn nicht jetzt?" Der Ausspruch des Rabbiners ist in den "Pirkei Avot" überliefert, religiösen Texten, in denen es um Moral und Ethik des Judentums geht. Der italienische Schriftsteller Primo Levi hat sich den Titel für seinen Roman im Jahre 1982 geborgt: "Wann, wenn nicht jetzt?" handelt von jüdischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg. Levi selbst kämpfte mit, wurde gefangen genommen und nach Auschwitz deportiert. Er überlebte.
Meine Tochter Emma engagiert sich seit dem 7. Oktober in einer Organisation in New York, die sich in diese Tradition jüdischer Ethik und Moral stellt. Sie heißt: "If not now..." Die Gruppe tritt gegen die Besetzung der palästinensischen Gebiete auf und setzt sich für einen Waffenstillstand ein. Denn sie findet: Der Krieg in Gaza bedeutet eine Katastrophe für die palästinensische Zivilbevölkerung. Der Krieg ist auch eine Katastrophe für Israel. Keine Seite kann mit Gewalt Frieden schaffen. Wir müssen uns für Menschenrechte für alle einsetzen. Und wann, wenn nicht jetzt?
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: