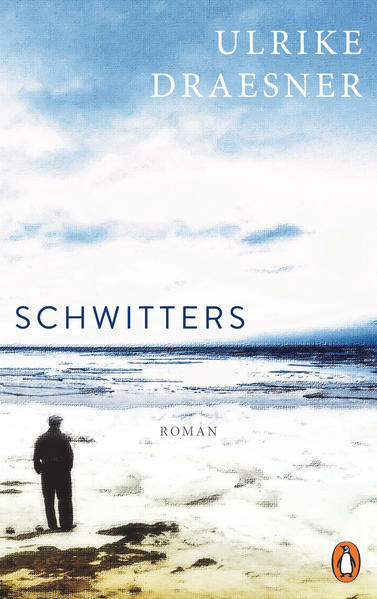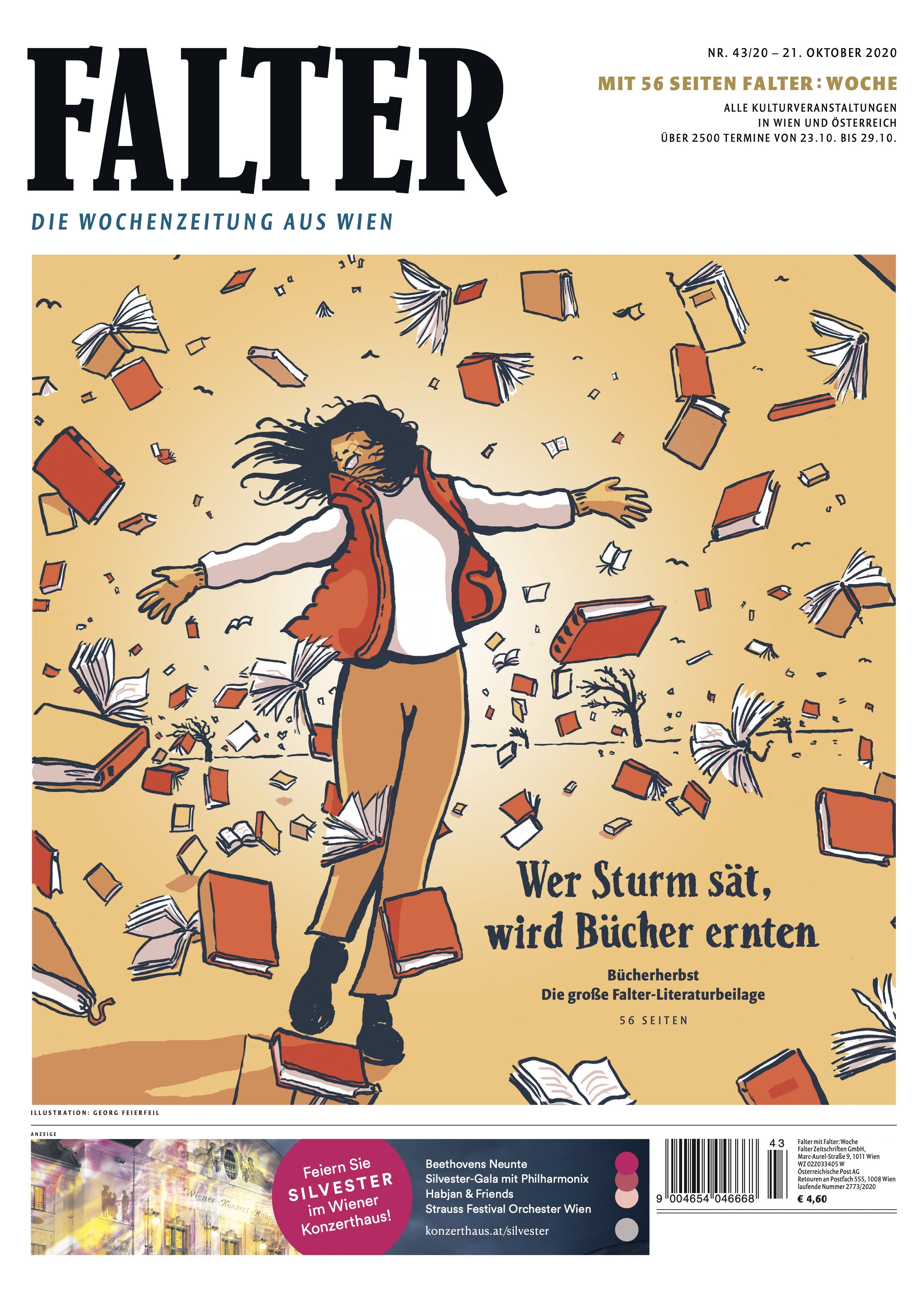
Porträt des Künstlers als älterer Herr
Sigrid Löffler in FALTER 43/2020 vom 21.10.2020 (S. 23)
Bekannt ist Kurt Schwitters, geboren 1887, als Avantgarde-Lyriker mit einem Hang zum gescheiten Geblödel, als Verfasser der experimentellen „Ursonate“ und des irrwitzigen Liebesgedichts „Anna Blume“. Doch außer Sprachkünstler war Schwitters vor allem bildender Künstler. Er stand der Dada-Bewegung nahe und ist der Erfinder eines dadaistischen Gesamtkunstwerks, das er „Merzkunst“ nannte. Leider wurde sein Hauptwerk zerstört. Der „erste Merzbau“ – eine begehbare Raumskulptur, die Schwitters in sein Elternhaus in Hannover hineinbaute und immer weiter in das Innere der Villa hineinwuchern ließ – wurde im Zweiten Weltkrieg durch eine Bombe vollständig vernichtet und existiert nur noch in Fotografien und als kunsthistorisches Gerücht. Gleichwohl ist Schwitters� Rang als Bahnbrecher einer radikalen Moderne, als Vorläufer der Installationskunst und der Pop-Art heute unbestritten.
Nun ist Schwitters selbst in Kunst transformiert worden – in die Wortkunst des Romans „Schwitters“ von Ulrike Draesner. Die Prosaerzählerin, Lyrikerin und Essayistin, Jahrgang 1962, wollte weder einen der üblichen Künstlerromane noch eine zünftige Schwitters-Biografie schreiben. Ihr Buch ist vielmehr ein Hybrid, ein Werk vielfacher Übersetzungskunst.
Ursprünglich auf Englisch geschrieben, doch dann von der Autorin selbst auf Deutsch überarbeitet, sucht der Roman Schwitters�abstrakte Formkunst in Sprache zu übersetzen und konzentriert sich dabei auf die letzten elf Lebensjahre des Künstlers. Es waren Exiljahre – Jahre der Vertreibung, der Flucht, der Krankheit und völligen Verarmung, aber auch kreative Jahre einer neuen Produktivität.
Von den Nazis als „entarteter Künstler“ gebrandmarkt und seiner Brotarbeit als Werbegrafiker beraubt, wurde Schwitters mit fast 50 Jahren aus Deutschland vertrieben. Mit seinem Sohn emigrierte er 1937 nach Norwegen und lebte zeitweise nahe Oslo, zeitweise auf der Insel Hjertøya, die er von Urlauben mit der Familie gut kannte. Dort nahm er in einem Schuppen einen neuen Merzbau in Angriff. Vor dem drohenden Einmarsch der Wehrmacht in Norwegen gelang ihm 1940 mit dem Sohn die abenteuerliche Flucht auf einem Fischkutter nach Schottland. Er wurde zunächst als „feindlicher Ausländer“ auf der Isle of Man interniert, entschloss sich jedoch, nach dem Krieg in Großbritannien zu bleiben.
Mit seiner neuen englischen Lebensgefährtin Edith Thomas, Spitzname „Wantee“, lebte er erst kärglichst in London und zog dann nach Norden in den idyllischen Lake District. In einer Scheune auf einer nassen Schafweide entstand „Merz barn“, sein letzter Merzbau, von dem er nur Teile der Rückwand vollenden konnte. Als Schwitters im Januar 1948 starb, keine 60 Jahre alt, war er weder Deutscher noch Engländer noch staatenlos: Er war nur bereits zu schwach, die soeben eingetroffene britische Einbürgerungsurkunde noch zu unterschreiben.
Aus diesem Stoff hätte sich der herzzerreißende Roman eines tragisch-bitteren Migrantenschicksals machen lassen, in dem eine vielversprechende Künstlerexistenz zerstört wird. Nicht so bei Ulrike Draesner. Deren helles, sprachfreudiges Erzähltemperament widersteht mit heiterer Ironie auf Dauer jeder Kopfhängerei.
Gewiss: „Schwitters“ ist ein Exilroman. Erzählt wird, wie ein vertriebener Avantgarde-Künstler plötzlich alles verliert: seine Heimat, seine Sprache, sein Werk, seinen guten Namen in der Kunstszene. Das erste der drei Romankapitel schildert die letzten sorglosen Tage im deutschen Leben des Merz-Künstlers und ewigen Schürzenjägers Schwitters in Hannover vor dessen Emigration. Seine loyale Ehefrau hütet derweil daheim seine Kunstwerke und schützt mit List seinen Merzbau vor dem Zugriff der Nazi-Schergen. Die vielen faktischen Lücken in Schwitters� deutschem Leben füllt Draesner mit fantasievollen, aber durchaus plausiblen Erfindungen. Im Hauptkapitel „Das englische Leben“ lässt sie das Elend des Exils nie überhandnehmen. Sie erzählt, wie sich Schwitters in England neu erfindet, die Sprache lernt und mithilfe seiner neuen Frau ein englisches Leben zu führen beginnt. Er ist künstlerisch äußerst produktiv. Zahllose Klebebilder und Porträts entstehen, und er lässt sich auch von zwei Schlaganfällen und einem Oberschenkelhalsbruch nicht davon abhalten, am „Merz barn“ weiterzuarbeiten, diesem privaten Erinnerungsschrein, in dem er seine englischen Erfahrungen sublimiert und seine Privatmythologie in abstrakte Kunst übersetzt.
Der Roman ist ein Hohelied auf die Kreativität. An dem „Brodelphänomen“ Schwitters interessieren Draesner vor allem der Witz und der Charme, die Energie, Weltneugier und unbezwingbare Schaffenslust des Künstlers. Sie zeichnet ein liebenswürdiges Porträt Schwitters� als sanftem Kunst-Egomanen und alt gewordenem Enfant terrible. Breiten Raum nimmt dessen Sprach- und Kulturwechsel (in England nur „Körrt“) ein. Während er sich mit Wantee an Übersetzungsspielen von deutschen und englischen Redensarten ergötzt, taucht er immer tiefer in die neue Sprache ein und korrespondiert schließlich sogar mit seinem Sohn auf Englisch.
Das letzte Kapitel, „Nachleben“, ist eine Art Happy End: die englische Auferstehung des Künstlers Schwitters und seiner Kunst. Es geht um die posthume Wiederentdeckung des „Merz barn“ und die wundersame Rettung der Merzwand, die heute als Prunkstück im Museum von Newcastle steht. Der englische Schwitters genießt also ein doppeltes Nachleben – im Museum und nun auch in Draesners fabelhaftem Roman.