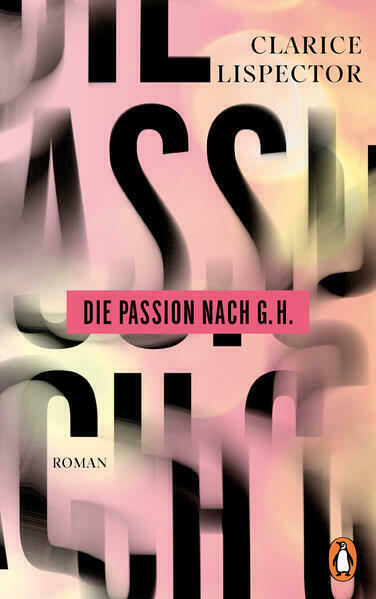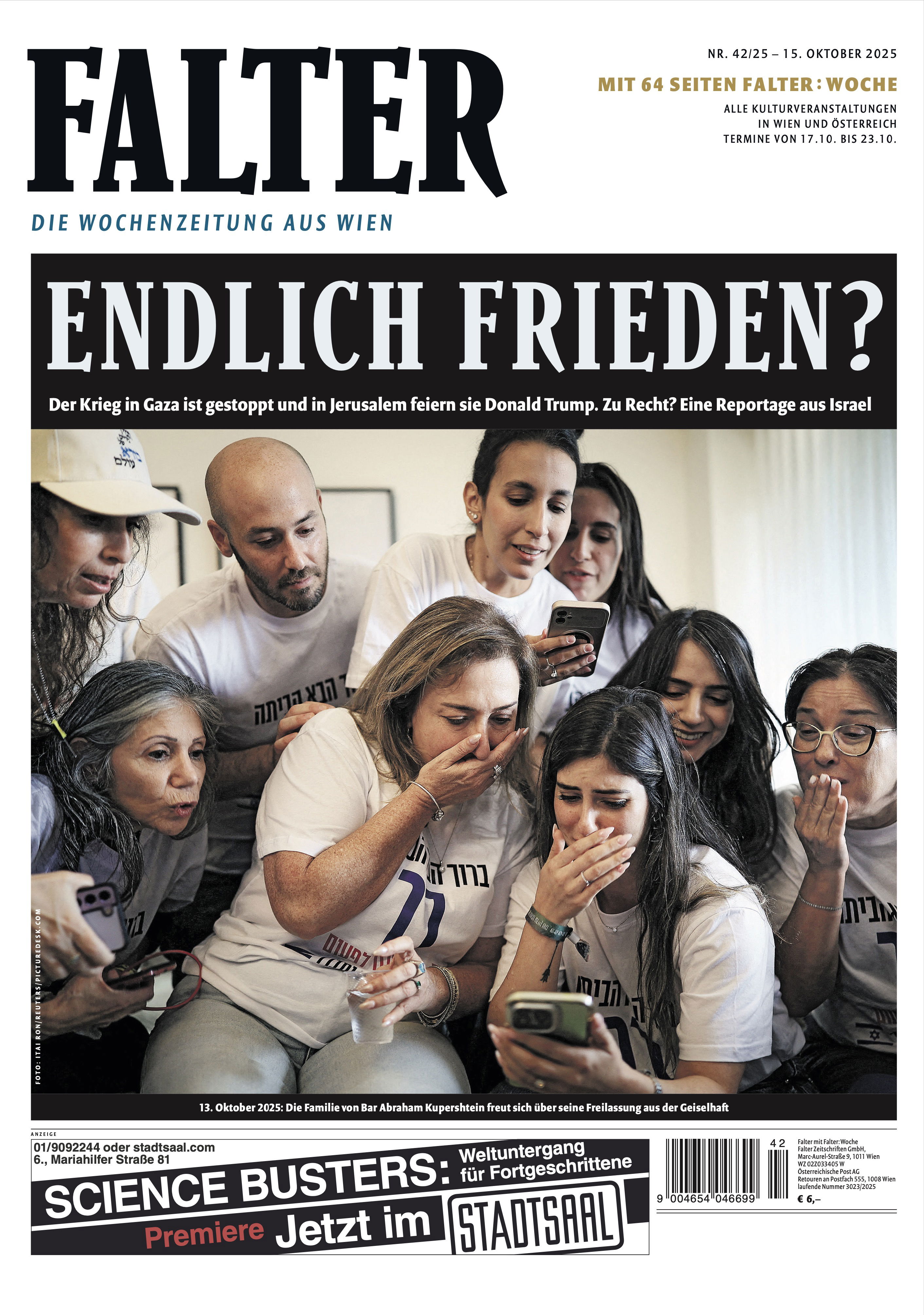
Ich will nicht behalten, was ich erlebt habe
Thomas Heyl in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 19)
Clarice Lispector ist in Brasilien eine nationale Größe. 1920 in der Ukraine geboren, waren ihre Eltern mit ihr zwei Jahre später vor antisemitischen Pogromen nach Südamerika geflohen. Trotz einer Kindheit in Armut konnte sie in Rio de Janeiro Jura studieren – und veröffentlichte 1943 ihren ersten Roman, „Nahe dem wilden Herzen“, angesiedelt irgendwo zwischen James Joyce, von dem sie den Titel entliehen hat, und Virginia Woolf, die sie früh für sich entdeckt hat.
Wenn von Clarice Lispector die Rede ist, fällt oft auch der Name Kafka. Denn immer wieder tauchen in ihrem Werk Kakerlaken auf, die an den Käfer denken lassen, in den sich Gregor Samsa verwandelt hat. „Die Passion nach G.H.“, 1963 zum ersten Mal erschienen, schildert die verzweifelte, existenzielle Auseinandersetzung einer Frau mit einer Kakerlake. G.H., eine erfolgreiche Bildhauerin mit Penthouse hoch über Rio de Janeiro, will das Zimmer ihres Dienstmädchens aufräumen, das ihr eben gekündigt hat. Sie öffnet einen Schrank, eine Kakerlake schlüpft durch den Türspalt, die sie in heller Panik zerdrückt, worauf eine ekelhafte weiße Flüssigkeit aus dem toten Körper tritt.
Mehr Handlung – im traditionellen Sinn – gibt es nicht nachzuerzählen. Der Anblick der toten Kakerlake setzt bei G.H. einen inneren Monolog in Gang, der die Voraussetzungen aller Körperlichkeit reflektiert und zugleich versucht, die menschliche Existenz in Richtung einer Sphäre des Göttlichen zu überschreiten.
Kakerlaken zählen zu den ältesten Tierarten überhaupt, sie ziehen eine Linie vom Beginn allen Lebens bis in die Gegenwart. Und diese weiße Flüssigkeit, die aus ihrem Körper rinnt: Erinnert sie nicht an Milch? Oder an Sperma? Wieder und wieder malt sich die Erzählerin aus, wie es wohl wäre, diese Flüssigkeit zu trinken – am Ende des Romans macht sie Ernst. Eine blasphemische Anspielung auf das Abendmahl?
Das würde zum Titel passen. Man kann „Die Passion nach G.H.“ als einen Versuch lesen, alle Rede über Gott durch eine Imitation derselben ad absurdum zu führen. „Halt es aus, dass ich Dir sage, dass Gott nicht hübsch ist. Und zwar weil er weder ein Ergebnis ist noch ein Schluss, und alles, was wir hübsch finden, ist es nur deshalb, weil es schon abgeschlossen ist.“
Ist das noch Literatur oder schon Mystik? Wenn in diesem Redefluss doch ein roter Faden zu erkennen sein sollte, dann ist es die Anstrengung, die eigene Existenz zu überwinden – aber wohin? Gehen Mystik und Atheismus überhaupt zusammen? Die Passion, das Leiden der G.H. besteht wohl darin, ihre Existenz loszulassen, sich auszulöschen, ohne zu verschwinden. Der Anblick der Kakerlake hat sie auf diesen Weg gebracht.
Spontan würde man als Autorin eines solchen Buches eine Gottsucherin vermuten, Clarice Lispector jedoch war eine mondäne Dame, Gattin eines Diplomaten, und – nach dem Scheitern ihrer Ehe – erfolgreiche Journalistin. Man kann und sollte „Die Passion nach G.H.“ denn auch als einen Roman lesen, der mit allem traditionellen Erzählen bricht, der wieder und wieder verstörende Worte und Bilder findet für innerste Gefühle und Ängste, für Verdrängtes und all das Dunkle, das einen Menschen treibt. Das ist nun nicht mehr Mystik, das ist in seiner Konsequenz und Rücksichtslosigkeit tatsächlich: Weltliteratur.
Man ahnt, welche Schwierigkeiten eine Übersetzung zu bewältigen hat. Luis Ruby, der in Hinblick auf diese Aufgabe 1984 und 1990 schon zwei Vorgängerinnen hatte, nennt das alles „schonungslos, eine Zumutung“. Wer sich auf dieses Buch einlässt, den warnen freilich schon die ersten Sätze: „------ich bin am Suchen, am Suchen. Ich versuche zu verstehen. Versuche, jemandem zu geben, was ich erlebt habe, und weiß nicht, wem, aber will nicht behalten, was ich erlebt habe.“