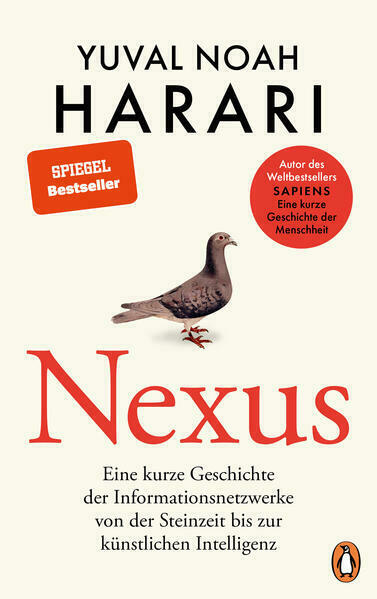Gefährliche Geflechte
André Behr in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 36)
Das destruktive Potenzial des Menschen ist ein verstörendes Phänomen, über das Philosophie, Literatur, Kunst und Wissenschaft schon immer gerätselt haben. Warum ist der Homo sapiens bei seinem Tun oft weniger weise, als sein lateinischer Gattungsbegriff suggeriert? Wie konnte es geschehen, dass sich die Menschheit nach 100.000 Jahren Entdeckungen, Erfindungen und Eroberungen in eine existenzielle Krise manövriert hat, an den Rand eines ökologischen Zusammenbruchs oder gar eines drohenden Weltkrieges?
Der an der Hebrew University in Jerusalem lehrende Historiker Yuval Noah Harari, 48, wurde mit populärwissenschaftlichen Publikationen über die Geschichte der Menschheit wie „Sapiens“ zum Bestsellerautor. In seinem neuesten Werk „Nexus“ versucht er herauszuarbeiten, woher dieser selbstzerstörerische Zug der Menschheit rührt. In den Mittelpunkt stellt er diesmal die Geschichte der Informationsnetzwerke „von der Steinzeit bis zur künstlichen Intelligenz“. Letztere, warnt er eindringlich, „hat das Zeug, nicht nur den Lauf der Geschichte unserer Spezies zu verändern, sondern die Evolution des gesamten Lebens“.
Der Begriff „Nexus“ stammt aus dem Lateinischen und meint das Zusammenknüpfen, allgemeiner auch „binden“ oder „verknüpfen“. Harari benennt damit seine zentrale These, „dass die Menschheit gewaltige Macht erwirbt, indem sie kooperative Netzwerke aufbaut, dass jedoch die Konstruktionsweise dieser Netze dem unklugen Gebrauch dieser Macht Vorschub leistet“. Als krasse Beispiele dafür führt er den Nationalsozialismus und den Stalinismus an, zwei der verheerendsten Netzwerke, die Menschen je erschaffen haben.
Wie stark auf Wahnvorstellungen basierende Netzwerke werden können, fällt uns schwer zu verstehen, weil wir laut Harari einem „Irrtum aufsitzen, wie große Informationswerke – ob wahnhaft oder nicht – funktionieren“. Wir gehen davon aus, so Harari, „dass große Netzwerke mehr Information verarbeiten können als Einzelpersonen und auf diese Weise Fortschritte auf Gebieten wie Medizin, Physik, Wirtschaft und so weiter ermöglichen“. Netzwerke scheinen dadurch nicht nur mächtig, sondern auch weise zu sein. Probleme beim Erwerb oder der Verarbeitung von Information lassen sich beheben, so der Glaube, indem man schlicht mehr Daten sammelt.
Tatsächlich gibt es viele Fälle, in denen mehr Information unser Verständnis der Welt verbessert. Ein Beispiel aus der Medizin, so Harari, ist der dramatische Rückgang der Kindersterblichkeit. Noch im 18. Jahrhundert erreichten selbst in wohlhabenden Familien nur drei von zwölf Kindern das Erwachsenenalter. Heute befindet sich auf jedem Handy mehr Information als in der legendären antiken Bibliothek von Alexandria. Aber „trotz – oder gerade wegen dieser Datenmenge – stoßen wir nach wie vor Treibhausgase in die Atmosphäre“, mahnt der Israeli, „zerstören wir Lebensräume und produzieren immer mächtigere Massenvernichtungswaffen – von Atombomben bis zu apokalyptischen Viren“.
Im ersten Teil des Buches schildert Harari die historische Entwicklung von Informationsnetzwerken, von den Mythologien der Antike bis zu Bürokratien moderner Staaten. Dabei nimmt er sich des Problems von falscher Information an und zeigt Unterschiede auf, wie demokratische und totalitäre Systeme Informationsnetzwerke nutzten.
Der zweite Teil ist dem Informationsnetzwerk gewidmet, das wir gerade schaffen, inklusive der KI-Systeme, sowie der Rolle von Social-Media-Algorithmen. Zum Schluss arbeitet er heraus, welche Gefahren und Chancen in unterschiedlichsten politischen Systemen auszumachen sind.
Man mag dem Buch gewisse formale oder sprachliche Schwerfälligkeiten anlasten. Inhaltlich legt es eine sehr ernstzunehmende Basis für eine enorm wichtige Diskussion darüber, wie wir unsere (technologiegetriebene) Zukunft gestalten wollen