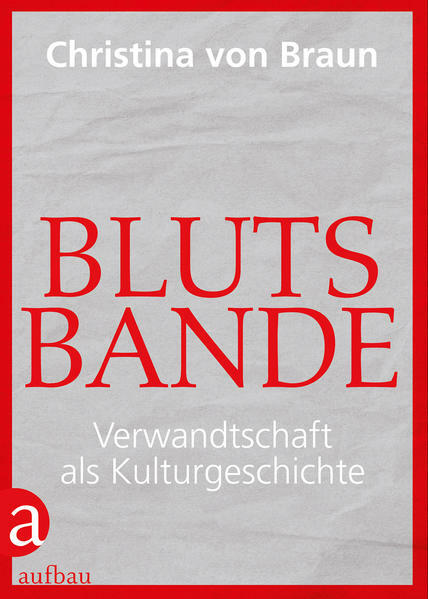Die rote Tinte der Patrilinearität
Stefanie Panzenböck in FALTER 11/2018 vom 14.03.2018 (S. 37)
Wurzeln: Christina von Braun durchforstet in „Blutsbande“ Gegenwart und Vergangenheit unserer familiären Herkunft
Christina von Brauns „Blutsbande“ beginnt mit dem Suizid des rechtsextremen französischen Intellektuellen Dominique Venner in der Kathedrale von Notre Dame im Jahr 2013 und endet mit einer Zukunftsprognose: „Die moderne Gesellschaft wird auf sozialen Verwandtschaftsverhältnissen beruhen – oder sie wird nicht sein.“
Die 1944 in Rom geborene Kulturwissenschaftlerin, Gendertheoretikerin und Filmemacherin Christina von Braun legt mit ihrer Kulturgeschichte der Verwandtschaft das Ergebnis einer Durchforstung des Konzepts der familiären Zugehörigkeit vor. Die zentrale These lautet, dass das, was wir heute als Natur wahrnehmen, kulturell geformt wurde. Von Braun erklärt die Entstehung des Konzepts der Blutsverwandtschaft, seine Grundlagen und Zwänge und wie sie sich heute auflösen. Für die Kulturwissenschaftlerin ist klar, dass soziale Bindungen, die etwa in Patchworkfamilien oder über neue Reproduktionstechniken entstehen, das neue Konzept von Verwandtschaft bestimmen werden oder schon bestimmen. Dafür liefert sie ein über 500 Seiten starkes Beweisstück.
Dabei geht sie von aktuellen Debatten aus und zitiert neben Venner, der für sich eine Art Märtyrertod für das Abendland – oder was er in Rassen- und Reinheitswahn dafür hielt – in Anspruch nahm, auch die Büchner-Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff. In einer Rede bezeichnete sie Kinder, die über reproduktionstechnische Maßnahmen entstanden sind, als „Halbwesen“. Lewitscharoff hat diese Aussage mittlerweile zurückgenommen. Auf der anderen Seite beschreibt von Braun die Demonstration in Paris im Jahr 2013 für die Einführung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Auf einem Schild stand: „Jesus hatte zwei Väter und eine Leihmutter.“
Die zentrale Frage lautet, wie das Konzept der Blutsbande entstanden ist. Verwandtschaft sei „eine Form von Sprache oder Kommunikation“, schreibt von Braun. „So liegt es nahe, dass die Verschriftung der Sprache Einfluss auf die Verwandtschaftsdefinition ausübt“. Ein ausschlaggebendes Analyseergebnis lautet: Gesellschaften, in denen die Blutsverwandtschaft gilt, sind auch Schriftgesellschaften.
„Das Blut erfüllt offenbar eine wichtige Funktion für diese Gesellschaften (…), diese scheint darin zu bestehen, den abstrakten phonetischen Zeichen, die dem Körper die Sprache entreißen und in ein körperfernes visuelles Zeichen überführen, eine neue symbolische Leiblichkeit zuzueignen: durch Blut, das Leben ist und Leben symbolisiert. Kulturen mit oralen Traditionen sind auf diese Symbolik weniger angewiesen, da die mündliche Sprache ohnehin den Körper nicht verlässt.“
Von der Entwicklung der Schrift über die Entstehung der monotheistischen Religionen folgt sie sodann zwei Konzepten von Blutsverwandtschaft: der Matrilinearität im rabbinischen Judentum der Diaspora und der Patrilinearität im Christentum. Ersteres führt von Braun auf die Staatenlosigkeit der Jüdinnen und Juden nach ihrer Vertreibung aus Jerusalem zurück. Die Mutterschaft, die schon immer sicher nachweisbar war, diente als Ersatz für den Verlust des Territoriums. Der Mutterleib wurde zur Heimat.
Das Christentum hielt sich hingegen weiterhin an die geistige Vaterschaft, die nur vermutet werden konnte. Dieses Konzept nennt von Braun „rote Tinte“: Blutsverwandtschaft, die auf schriftlichen Dokumenten beruht. Das Buch endet mit der Auflösung von Matrilinearität und Patrilinearität in der modernen Gesellschaft. Der Staat Israel wird gegründet, und mit der seit 1984 genetisch nachweisbaren Vaterschaft verliert diese ihre geistige Überhöhung.
Von Braun nimmt in „Blutsbande“ Gewissheiten und schafft gleichzeitig eine stabile Grundlage für das Verständnis von Veränderungen. Nichts war schon immer und nichts wird immer bleiben. Deshalb gibt es auch wenig Grund, sich zu fürchten. Aber nachdenken sollte man. Und dafür liefert von Braun einen so umfangreichen wie wertvollen Anstoß.