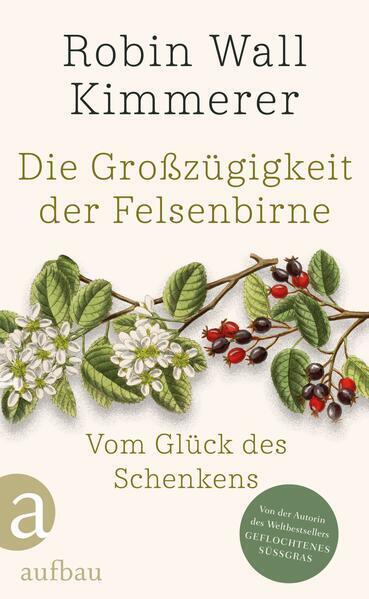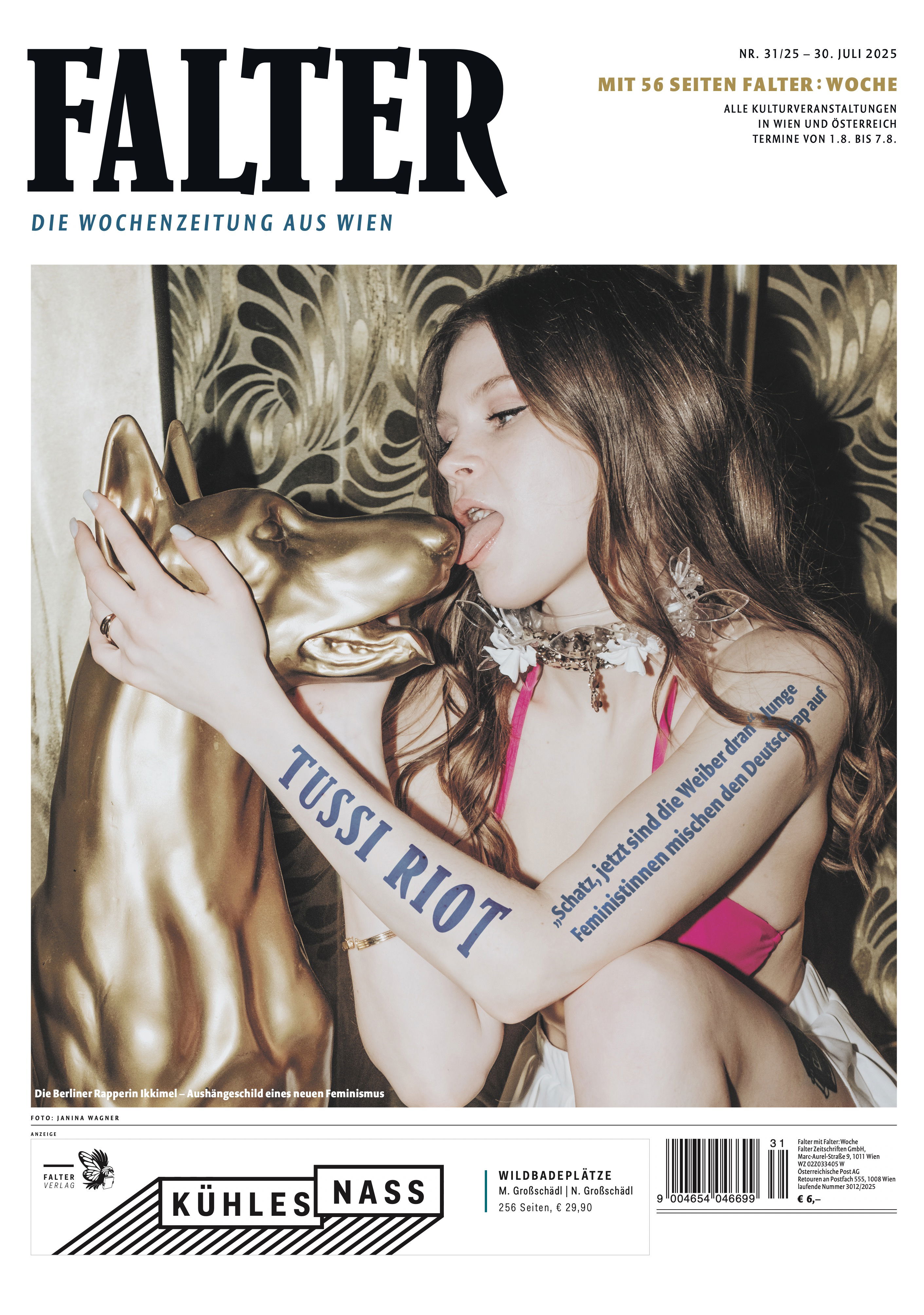
Zurück in die Zukunft
Patricia McAllister-Käfer in FALTER 31/2025 vom 30.07.2025 (S. 43)
Ein putziges außerirdisches Wesen, das auch ganz schön garstig sein kann, landet auf Hawaii. Dort findet es bei einer verwaisten Sechsjährigen eine Familie. Das ist - in aller Kürze -die Handlung des Disneyfilms "Lilo und Stitch". Derzeit als Realverfilmung in den Kinos, war die Geschichte gleichen Inhalts dort schon im Jahr 2002 als Animation zu sehen.
Remakes wie dieses sind heute kein Zufall, sondern die Regel. Ob Barbie, Harry Potter oder die Avengers: Alle Top-Blockbuster zwischen 2000 und 2024 -also die umsatzstärksten Filme des jeweiligen Jahres -basierten auf einem bereits bekannten Film, Buch oder Charakter, so eine Analyse des britischen Guardian. Zwischen 1975 und 1999 hingegen entstanden 17 der 25 jeweils umsatzstärksten Filme aus originären Drehbüchern.
Genau diese Entwicklung könnte im Moment eines der größten Probleme der Menschheit sein. Das beobachten aktuell gleich vier Denkerinnen und Forscher: Florence Gaub, Forschungsdirektorin der Nato-Militärakademie in Rom, plädiert in "Zukunft. Eine Bedienungsanleitung" (2023) für ein stärkeres Anzapfen unserer Vorstellungskraft. Die beiden US-Journalisten Ezra Klein und Derek Thompson fordern in "Abundance" (2025) eine neue "Politik der Fülle", die Erfindergeist und Innovation stärkt. Wie uns die Natur dazu inspirieren könnte, beschreibt die indigene Autorin Robin Wall Kimmerer in "Die Großzügigkeit der Felsenbirne"(2025). Ihre These? Uns fehlt die Fantasie für eine lebenswerte Zukunft.
Doch es müsste nicht so sein. Ein erstes Bild dafür liefern Klein und Thompson mit ihrer Forderung nach einer "Abundance" (englisch für "Fülle" oder "Überfluss") an sauberer Energie, öffentlichem Verkehr und erschwinglichem Wohnraum - aber auch an kreativen Zugängen in der Forschung und Wissenschaft, die zu mehr Innovationen führen. "Abundance" zeichnet aber nicht ein Überfluss an materiellen Gütern aus. Sie verstehen ihn als einen Zustand.
So laden Klein und Thompson zu einer Zeitreise ins Jahr 2050 ein. In dieser Version der Zukunft machen "vertical farming"(also Landwirtschaft in mehrstöckigen, urbanen Gebäuden) und die Erzeugung von Laborfleisch anstelle "echter" Tierhaltung riesige landwirtschaftliche Flächen für Renaturierung frei. Entsalzungsanlagen liefern in jenen Weltgegenden Trinkwasser, in denen dieses sonst knapp wird. Damit E-Autors, E-LKW und Lieferdrohnen durch die Gegend fahren und fliegen können, erzeugen Kraftwerke aus erneuerbaren Quellen riesige Mengen Energie.
Für Österreich bräuchten wir dafür fünfmal so viele PV-Anlagen und viermal so viel Windkraft, wie im Moment verfügbar ist. Denkbar ist das aber allemal, meint die Klimaökonomin Sigrid Stagl. Die Wissenschaftlerin des Jahres 2024 forscht an der Wirtschaftsuniversität Wien zu einer ökologischeren Ökonomie. In einigen Bereichen würde der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energiequellen unseren Bedarf automatisch reduzieren, weil elektrische Geräte effizienter funktionieren -etwa, weil (anders als beim Verbrennungsmotor) weniger Abwärme anfällt. Gleichzeitig bräuchte die Industrie mehr Energie, um Wasserstoff als Energieträger nutzen zu können.
Dazu müssen Netze und Speicher ausgebaut werden. Letztere könnten etwa in Containern in der Landschaft stehen und eine stabile Stromversorgung garantieren. "Das alles kostet uns jetzt eine Anstrengung", so Stagl, "aber dann steigt die Versorgungssicherheit."
Das deckt sich mit dem Zugang von Klein und Thompson, die eine Kurskorrektur fordern: "Wir haben einen verblüffenden Überfluss an materiellen Zeug, das unsere Wohnungen und Häuser füllt, bei gleichzeitigem Mangel dessen, was es braucht, um ein erfülltes Leben zu leben", schreiben sie. Doch um ein solches "erfülltes Leben" leben -und darin auch wirtschaften - zu können, müssten wir es uns erst einmal vorstellen können.
Auch Sigrid Stagl forderte Anfang des Jahres positive Zukunftsbilder. Bei Vorträgen hat sie es sich angewöhnt, Teilnehmende zu bitten, ihre Augen zu schließen und sich ein Zukunftsbild für Österreich im Jahr 2040 auszumalen. Wenngleich ihr als Wissenschaftlerin es manchmal selbst eigenartig vorkomme, zu einer solchen Methode zu greifen. Der Falter hat die Visionen von Gaub, Kimmerer, Klein und Thompson mit Sigrid Stagl abgeklopft.
1. Sich ein Beispiel an der Natur nehmen
Die indigene Amerikanerin Robin Wall Kimmerer ist Mitglied der Citizen Potawatomi Nation. In ihrem Buch setzt sie auf Biomimikry: Das ist eine Methode, sich von der Natur beim Problemlösen inspirieren zu lassen. Kimmerer schlägt etwa vor, Gemeinschaften als Ökosysteme zu begreifen -auch solche, die Handel miteinander treiben.
Dies könnte zu mehr Tauschökonomien führen und herrschende Wettbewerbsprinzipien hinterfragen. Wettbewerb koste in der Natur jede Menge Ressourcen und senke damit die Belastbarkeit der Beteiligten. Mutualismus -eine Beziehung, von der alle (Handels-)Partner etwas haben -und Kooperation seien in sich verändernden Umwelten die viel besseren Handlungsprinzipien, so Kimmerer.
Das gilt auch in unserem Wirtschaftssystem, sagt Stagl: In diesem Konzept ist Wirtschaft ein Teil der Gesellschaft; Menschen und Umwelt werden als relevante Größen besonders berücksichtigt.
Die für Kimmerers Buch titelgebende Felsenbirne versorgt in Nordamerika mit einer Fülle an Früchten Vögel wie die Wanderdrossel (in deren Darm die Felsenbirnensamen zum Keimen angeregt werden), aber auch Hirsche, Elche und Menschen. Sie ist eine der ersten Pollenquellen im Jahr für Bestäuber und Wirtspflanze für verschiedene Schmetterlingslarven. Kimmerer sieht auch darin eine Lektion für unser Wirtschaftssystem: Gerade, wenn man nicht weiß, wie die Zukunft aussieht, sei man mit verschiedenen Kooperationspartnern flexibler.
2. So wirtschaften, als gäb's nur einen Löffel
Im deutschsprachigen Raum ist der Begriff "Nachhaltigkeit" abgenutzt. Ursprünglich stammt er aus der Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts: Es sollte nur so viel Holz geschlägert werden, wie in einem angemessenen Zeitraum im Wald auch wieder nachwächst.
Kimmerer erzählt von einem ähnlichen Grundsatz der indigenen Volksgruppen in der Region der Großen Seen Nordamerikas: Lange vor Ankunft der Siedler schlossen die Haudenosaunee-Konföderation und die Anishinaabe-Nationen dort ein Abkommen namens "Dish with One Spoon Treaty". Darin garantierten die Unterzeichnenden, den gemeinsamen Jagdgrund umsichtig oder eben nachhaltig zu nutzen. Also so, als gäbe es nur einen Löffel, der abwechselnd für einen gemeinsamen Teller Essen benutzt wird. Das förderte Teilen und Verantwortungsbewusstsein, so Kimmerer. Und so bleibt immer eine Fülle an Ressourcen übrig.
Für ein solches "systemisches Denken" und entsprechende Abkommen ist auch Sigrid Stagl zu haben. Sie bringt ein Beispiel: In der Kärntner Gemeinde Ferlach hat sie ein Jahr lang einen Prozess begleitet, bei dem eine möglichst repräsentative Gruppe Bürger befragt wurde, wie sie sich die Zukunft ihres Ortes vorstellen. Konfrontative Ja-oder Nein-Abstimmungen, etwa über Windkraft-Projekte kurz vor Baubeginn, hält Stagl hingegen für wenig sinnvoll. In frühen Projektphasen lassen sich schließlich selbst skeptische Parteien ins Boot holen - auch mit dem Argument eines besseren Lebens für alle.
3. In Ruhe simulieren
Wenn es darum geht, kreativ in die Zukunft zu denken, bietet Florence Gaub eine "Bedienungsanleitung". Und beruhigt zuerst einmal: "Wenn man an eine andere Zukunft denkt, muss man immer zuerst mit der Gegenwart brechen, sich vom Bekannten oder Erwarteten lösen und Raum für Möglichkeiten schaffen -selbst für die absurdesten." Es brauche einen möglichst ausgeglichenen Gemütszustand, um zu sinnvollen Lösungen zu kommen. Quasi das Gegenstück zur damals 16-jährigen Klimaaktivistin Greta Thunberg, die 2019 beim Weltwirtschaftsforum in Davos forderte: "I want you to panic!"
Dafür müssen wir, so Gaub, divergentes Denken zulassen, also die Gedanken mit großer Offenheit und ohne Ziel wandern lassen. Oder anders gesagt: tagträumen. Diese Empfehlung würde man nicht von einer ehemaligen Reserveoffizierin und Militärstrategin erwarten. Aber als sicherheitspolitische Beraterin (etwa der EU) empfiehlt sie, diese Fähigkeit zu verinnerlichen, um zu faktenbasierten, durchdachten "Lagebildern der Zukunft" zu kommen.
Für eine Fülle der Zukunftsideen brauche es außerdem eine "Vielfalt der Informationseinflüsse". Soll heißen: Keine Algorithmen, die einen immer wieder in die selben, eingefahrene Bahnen lenken. In Künstlicher Intelligenz hingegen sieht Gaub nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine Chance. Sie könne sich etwa an die Bedürfnisse Jugendlicher anpassen, die anders denken und lernen als andere -und damit frische Perspektiven liefern, die sie selbst aber vielleicht nicht verständlich ausdrücken können.
Bei einem solchen Erdenken der Zukunft, so Gaub, dürfe man weder in reines Wunschdenken verfallen noch aufgeben. "Aufgeben spielt's sowieso nicht", sagt auch Stagl. Außerdem müssen Zukunftsbilder "für die Menschen reale Optionen" darstellen, sonst bleiben sie Luftschlösser. Das kann mittels Modellen und Simulationen gelingen: Die Stadt München testet etwa derzeit mithilfe eines "digitalen Zwillings", wo ihre Hitzeinseln liegen und wie sie klimaresilienter werden kann.
4. Regeln achten, Risiken eingehen
US-Journalisten Ezra Klein und Derek Thompson kritisieren in ihrem Buch insbesondere die Bürokratie staatlicher Prozesse (in den USA), zum Beispiel beim Bau neuer Infrastruktur. Stagl hält dagegen: "Von mir werden Sie keine Forderung nach ,Entbürokratisierung' hören", sagt sie. Wir leben in komplexen Gesellschaften, die differenzierte Regeln brauchen.
Stattdessen benötigen wir eine "agile Stabilität". Gemeint ist ein solides Regelwerk, das Sicherheit gibt, aber auch ein Ausverhandeln zulässt, wenn sich die Gegebenheiten ändern. So sollen für alle die gleichen Verkehrsregeln gelten. Verantwortliche müssen diese aber anpassen, wenn plötzlich etwa E-Scooter auf den Straßen auftauchen.
Für diese agile Stabilität jenseits eines kurzfristigen Denkens nennt Stagl Dänemark als Vorbild: Dort hat man sich etwas getraut und ein gemeinsames Ziel gesetzt: bis 2030 die Emissionen um 70 Prozent zu reduzieren. Laut eigener Angaben erreicht das Land das für heuer selbstgesteckte Ziel von minus 55 Prozent. Politik, Verwaltung und Wirtschaft arbeiten dafür zusammen. Parallel wurden Ökosysteme geschaffen, die Innovationen fördern. Es brauche Politiker als "Talente-Scouts mit einer Vision"(Zitat Klein und Thompson). Das stärke die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes.
Hat Sigrid Stagl das Bild einer Politik vor Augen, die verantwortungsbewusst und mutig in die Zukunft denkt?"Auf die USA können wir die nächsten drei Jahre nicht zählen", sagt sie. In Österreich gehe es immer weniger um ein "Ausverhandeln". Stattdessen werde die Regierungsarbeit portioniert und jeder Minister betreibe Klientelpolitik.
Was es hingegen bräuchte, wäre ein "Whole of Government"-Ansatz, wie ihn auch Dänemark praktiziert: Alle Minister müssen die Klimaagenden ressortübergreifend stets mitdenken. Klingt fast schon nach einem gesunden Ökosystem.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: