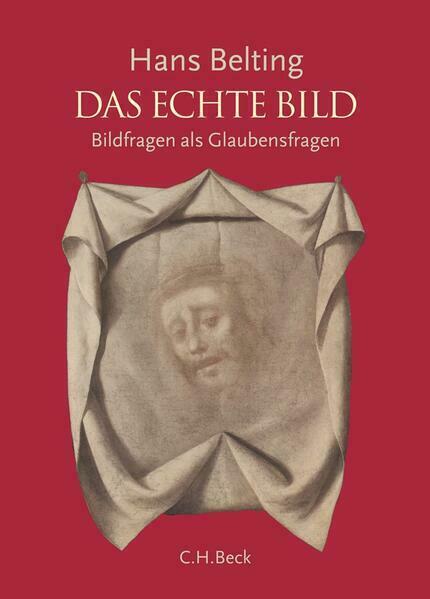Matthias Dusini in FALTER 1-2/2006 vom 11.01.2006 (S. 60)
Jesus bin Laden
Hans Belting schreibt darüber, dass die Kunstwissenschaft heute nur Teil einer Bildwissenschaft sein kann. Im Interview spricht er über unbefleckte Empfängnis, Osama bin Ladens Jesus-Imitationen und die Unsterblichkeit John Lennons.
Der Kunsthistoriker Hans Belting war von 1992-2002 Professor für Kunstgeschichte und Medientheorie an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Seit 2004 ist er Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften (IFK) in Wien, wo er Mitte Jänner ein Symposium über Museen veranstaltet (siehe Kasten). Zu Beltings wichtigsten Publikationen zählen: "Bild und Kult" (1990), "Das Ende der Kunstgeschichte" (1995), "Das unsichtbare Meisterwerk" (1998), "Bild-Anthropologie" (2000) und "Hieronymus Bosch. Der Garten der Lüste" (2002). In seinem neuesten Buch, "Das echte Bild", geht Belting der Frage nach, warum wir Bilder für authentisch erachten, obwohl es sich dabei doch um Blendwerk handelt. Der Falter besuchte den emeritierten Professor Anfang Dezember in seinem Wiener Büro.
Falter: Werden Sie morgen in die Kirche gehen?
Hans Belting: Nein, ich bin auch erstaunt, dass der 8. Dezember hier in Österreich noch ein kirchlicher Feiertag ist. Aber ich freue mich immer über das Thema der unbefleckten Empfängnis, weil ich als Agnostiker mit der kirchlichen Geschichte so vertraut bin, dass ich Leute korrigieren kann, die nicht wissen, dass es nicht um die unbefleckte Empfängnis Jesu durch Maria geht, sondern um die Empfängnis Marias durch deren Mutter.
Man kann sich so eine Art der Befruchtung schwer vorstellen. Gibt es in der Kirchengeschichte Bilder davon?
Es wurde im Barock eine Bildformel dafür gefunden, von der jeder sagte: Das ist die unbefleckte Empfängnis - obwohl da gar keine Empfängnis dargestellt wird. Man sieht Maria auf einer Mondsichel. Ich habe mal im Buch "Bild und Kult" ein Kapitel darüber gemacht, wie diese Figur in der Spätantike aufgebaut wurde. Die Kirchenväter diskutieren im vierten Jahrhundert vollkommen inkompetent über gynäkologische Vorgänge. Jetzt sind wir aber in den Fächern Kirchengeschichte und Religion, wofür ich als Kunsthistoriker nicht ganz zuständig bin.
Ihr neues Buch vermittelt aber einen anderen Eindruck ...
Ich hab schon zornige Briefe von Theologen bekommen, die sagen, ich hätte alles missverstanden. Vor allem die evangelischen Theologen sind über die Bildhaftigkeit meiner Darstellung der Religion ziemlich entsetzt.
Beim Weihnachtsfest geht es um die Geburt von Jesus. Stimmt es, dass es das einzige Mal ist, bei der er mit seinen Geschlechtsteilen dargestellt wird?
Ja, und als Toter. Das ist beides ungefährlich: der Besitz der sexuellen Veranlagungen ohne deren Benutzung.
Gibt es Hinweise darauf, dass Jesus sexuell aktiv war?
In der alten Literatur wird verteidigt, dass er ein vollkommener Mensch ist. Und das würde ja nicht klappen ohne Sexualität. Auf der anderen Seite wurde peinlich vermieden, dass er sich mit Sexualität befleckt.
Und in Bildern?
Es gibt zum Beispiel sehr viele Darstellungen des Babys, das mit seinem Penis spielt. Auch die Beschneidung ist sehr wichtig, denn wenn der Penis von jemandem beschnitten werden kann, der muss einen haben. Michelangelo stellt Christus nackt, mit allen Geschlechtsmerkmalen, dar, aber als Auferstandenen. Ich hab immer Vergnügen an solchen Paradoxa: Auf der einen Seite besitzt Jesus Sexualität, auf der anderen Seite wird sie vermieden.
Ist das nicht das Paradoxe an jedem Kirchenbesuch: Man sieht sadomasochistische Inszenierungen, aber jeder tut so, als wäre nichts.
Der Blick ist doppeldeutig und auch verschwiegen. Der heilige Sebastian war für weibliche Besucher ein fabelhaftes Modell, die Magdalena war es für männliche Christen.
Und im Blick der Barockheiligen spiegelt sich ja auch so etwas wie Ekstase ...
Absolut. Besonders in Berninis Skulptur "Ekstase der heiligen Theresa". Da ist ja nach übereinstimmender Meinung ein richtiger Orgasmus dargestellt, wenn auch ein metaphysischer.
Für viele Menschen ist der 8. Dezember jener Tag, an dem John Lennon ermordet wurde. Musste Lennon sterben, um unsterblich zu werden?
Er stirbt ja nicht nur für sich, sondern für etwas. Auf der Titelseite des Time Magazine stand zu Mel Gibsons Film "The Passion of the Christ": "Warum musste Jesus sterben?" Das ist die zentrale christliche Opfer- und Märtyrerthematik. Er musste einen echten Körper haben, denn nur dieser konnte sterben. Aber was mich mehr interessiert hat: Wir reden immer von der postmodernen Problematik des Körpers, als wäre früher der Körper unproblematisch gewesen, und als wären wir nur durch die Neuen Medien und die Digitalisierung vom Körper abgerückt. Ich setze dem entgegen, dass der Körper in der christlichen Kultur, also seit fast 2000 Jahren, ein Modell in jenem Jesus hat und dass dessen Körper fast unmöglich zu definieren ist.
Zahlreiche Prominente wurden schon von scheinbar unmotivierten Attentätern angegriffen. Wollten jene vielleicht testen, ob diese Stars zu Göttern und damit unsterblich geworden sind?
Eigentlich ist ja ein Attentat nur die andere Seite des Kults. Der Kult(-gegenstand) wird attackiert und damit auch bestätigt. Mythische Personen leben weiter, quasi ohne Körper oder mit einem medialen Körper. Bei Jesus ist dieses Problem von den Evangelien nicht gelöst, sondern durch 2000 Jahre Theologie immer weitergeschrieben worden.
Um die Perspektive umzukehren: Wie geht das Kultobjekt mit dieser medial erzeugten Unsterblichkeit um? War es für Jesus einfacher, mit seinem göttlichen Status umzugehen, als etwa für John Lennon?
Ja, weil er sich von einem sterblichen Menschen in einen Mythos verwandelt hat, während Jesus ja die Legitimation für sich in Anspruch nahm zu sagen: "Wer mich sieht, sieht Gott."
Das darf einem Medienprofi nicht passieren. Und wenn es ihm passiert ...
... dann hat er ein Problem. Er ist nicht legitimiert dazu.
John Lennon ist eine popkulturelle Erlöserfigur, Osama bin Laden eine politische. In einer Videobotschaft trat er auf wie Jesus auf dem Ölberg - mit einem Stock in der Hand. Muss ein radikaler Muslim auf die christliche Ikonografie zurückgreifen, um in der Mediengesellschaft kommunizieren zu können?
Ich würde sagen, ja - weil er in seiner eigenen Kultur keine Bildtradition hat. Inzwischen ist er ja zu einer eher unsichtbaren Ikone geworden, und zwischen dem Ölberg mit dem Stock und der heutigen Unsichtbarkeit, gibt es jenes Brustbild in El Dschasira, das mit arabischer Schrift kombiniert ist: Damit erhebt Bin Laden den Anspruch, eine Bildpräsenz in den heutigen Medien zu bekommen und sich durch die Schriftbänder wieder auf seine eigene Kultur zu beziehen.
Die TV-Stationen weigern sich inzwischen, solche Botschaften auszustrahlen. Halten Sie so ein Bilderverbot für ein probates Mittel?
Ein Bilderverbot hat immer den umgekehrten Effekt: Es steigert die Erwartungen. Verbotene Bilder sind die allerbegehrtesten.
Sie sagen, dass es die vielzitierte Bilderflut zwar gibt, uns aber die Werkzeuge fehlen, mit ihr umzugehen. Was schlagen Sie vor?
Die Kinder erwerben ja eine unbewusste Bildkompetenz durch ihre Bildpraxis; dazu müsste noch die kritische Distanz kommen. Wir lernen alle, Texte zu lesen. Wir sollten in der Schule aber auch lernen, Bilder zu "lesen". Unsere Textkultur wird durch die neuen Massenmedien zwar erheblich bedrängt, in den akademischen Ausbildung hat sie dennoch ein fast vollständiges Monopol. Die meisten Geisteswissenschaften leiten zum Textstudium an.
In einem Ihrer Bücher sprechen Sie vom Ende der Kunstgeschichte. Was tritt an ihre Stelle?
Angeblich habe ich ja die Kunstgeschichte an die Bildwissenschaft verraten. Ich habe aber immer dafür plädiert, dass die Kunstgeschichte an der heutigen Bildfrage teilnimmt, auch wenn diese nicht ihr Hauptthema ist. Es geht darum, ob die Kunstgeschichte über die geschützte Zone der Werkpflege und -geschichte hinausgeht.
Die Farbe kommt in Ihren Büchern nur spärlich vor. Hat das einen bestimmten Grund?
Ich habe gerade in Berlin einen Vortrag gehalten über Blut und Farbe. Anscheinend beginne ich mich damit zu beschäftigen. Aber Dingen gegenüber, die ich liebe, wahre ich auch lieber eine gewisse Distanz; ich kann sie mit Erklärungen nicht ganz knacken und bin darüber eigentlich auch ganz froh.
Sie haben im Büro auch kein von Ihnen gemaltes Bild hängen ...
Um Himmels Willen!
Könnten Sie dennoch beschreiben, was Sie malen?
Ich würde das ungern tun, weil ich das nur als Tätigkeit schätze. Für mich ist es wunderbar zu malen, egal, was dabei rauskommt. Ich habe zwei Polkes hier hängen. Das ist ein Maler, der mir sehr viel bedeutet, nicht so sehr in seinen thematischen und satirischen Seiten, sondern in seinem leidenschaftlichen Verhältnis zur Farbe.
Ihr zentrales Thema ist das Porträt. Sind Sie jemals auf eines gestoßen, das Ihnen geglichen hat?
Als ich ein Semester in Harvard lehrte, habe ich das venezianische Porträt eines Franziskanermönchs, Petrus Martyr, entdeckt, der ein Messer im Kopf hat. Ich habe gebeten, es über meinen Schreibtisch zu hängen. Ich glich ihm so sehr, dass die Besucher von dem Mönch an der Wand und mir darunter höchst irritiert waren.
Wie würden Sie einem Blinden Ihr Äußeres beschreiben?
Sie wissen, mein Lebensthema ist es, etwas beschreiben zu wollen, was man nicht beschreiben kann. Das gilt für alle Bilder. In dem Moment, wo ich mich beschreibe, beschreibe ich ein Bild, das ich von mir habe, obwohl ich derjenige Mensch bin, der mich nie sieht.