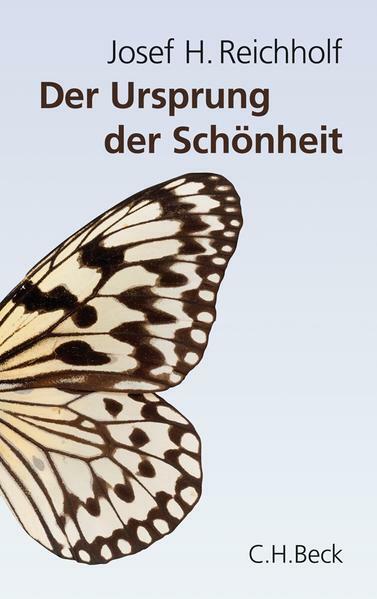Pfauenfedern oder vom Nutzen der Schönheit
Peter Iwaniewicz in FALTER 10/2011 vom 09.03.2011 (S. 44)
Josef H. Reichholf erklärt, warum
Schönheit nicht nur im Auge des Betrachters liegt
Von nichts wimmelt unsere Zeit so sehr", merkte Jean Paul 1804 in seiner "Vorschule der Ästhetik" sarkastisch an, "wie von Ästhetikern." Das mag vielleicht damals für den Bereich der Geistes- und Kulturwissenschaften gegolten haben, aber die
sachorientierten Naturwissenschaftler hüteten sich lange Zeit, an einem scheinbar nur von subjektiver Betrachtung und Bewertung geprägten Thema anzustreifen.
Der deutsche Zoologe Ernst Haeckel gab zwar Ende des 19. Jahrhunderts einen Bildband mit dem scheinbar
widersprüchlichen Titel "Kunstformen der Natur" heraus, doch dieses hatte mehr Einfluss auf die Künstler des Jugendstils als auf die Naturforscher dieser Epoche.
Erst in den 1980er-Jahren begann sich die humanorientierte Verhaltensforschung mit dem Phänomen der Schönheit von Menschen und den Mechanismen der Attraktivität zu beschäftigen, und auch die Biologie widmete sich dem seit Darwin bekannten Problem der für das reine Überleben eigentlich sinnlosen Prachtkleider, Balzrituale und Pfauenfedern.
Der Evolutionsbiologe Josef Reichholf befasst sich in seinem Buch "Vom Ursprung der Schönheit" mit der Frage nach den ökologischen Grundlagen von Schönheit und bringt so Licht in "Darwins größtes Dilemma", wie der Untertitel lautet.
Denn obwohl Darwin auf seinen Reisen immer wieder über die Gründe für das Überleben scheinbar nutzlosen tierischen Schmucks – wie zum Beispiel bunte Fellzeichnungen oder ornamentale Federn – nachgedacht hatte, postulierte er in seinem epochalen Werk "Die Entstehung der Arten" (1859), dass die natürliche Auslese jedes Merkmal zu einem bestimmten Zweck gestalte. Nur welchen Sinn machten dann die hinderlichen, auffälligen Federn eines Pfaus, den Darwin in seinem Garten täglich sehen konnte?
Einmal gestand er deswegen seinem Sohn Francis: "Schon vom bloßen Anblick der Schwanzfedern eines Pfauen wird mir übel!" Erst zwölf Jahre später veröffentlichte er sein zweites zentrales Werk, "Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl", in dem er seine Idee einer weiteren Auslese durch sexuelle Selektion vorstellte.
Während die These der "natürlichen Selektion" nur die Fitness eines Lebewesens berücksichtigt, in einer bestimmten Umwelt zu bestehen, bedeutet sexuelle Selektion, dass Weibchen sich ihre Sexualpartner nach bestimmten äußerlichen Merkmalen aktiv aussuchen.
Eine unerhörte Theorie für die viktorianische Epoche – und eine völlige Umkehr der bisherigen Sichtweise auf die Geschlechterrollen, nach der ausschließlich der Mann die Wahl hatte und auch tatsächlich traf.
Mit ihr ließen sich nun auch die zwar schönen, aber "unnützen" Pfauenfedern erklären: Bei manchen
Arten legen die Weibchen auf äußere Merkmale wert, die in keinem direkten Zusammenhang zur Fähigkeit der Männchen stehen, überlebens- und fortpflanzungsfähige Nachkommen zu zeugen oder sich erfolgreich an der Aufzucht der Jungen zu beteiligen.
Schlüsselreize wie z.B. auffällige Farben, Balzrufe oder energieaufwendige Verhaltensweisen der Männchen signalisieren einen "Luxus", den sich nur besonders fitte Individuen leisten können. Ein Pfau, der trotz seiner hinderlichen, langen Schwanzfedern überlebt und nicht vorzeitig von Raubtieren gefressen wird, muss über vererbenswerte Eigenschaften verfügen und wird deswegen von den Weibchen ausgewählt.
Schönheit – so Reichholfs Zugang – ist keine Einbildung des Menschen, weil die Augen anderer Lebewesen offenbar grundsätzlich ähnlich wie wir Schönheit als Ausdruck eines langen evolutionären Prozesses wahrnehmen.
Dies alles führt der Autor dem Leser anhand vieler Beispiele gut lesbar und immer spannend vor Augen. Ausführlich widmet er sich auch dem Thema Schönheit in der Menschenwelt und einem Phänomen, das eng mit dem Aussehen verbunden ist: dem Rassismus. Warum wird ein oft nur geringfügiges Anderssein in Haut- und Haarfarbe oder Gesichtsform als hässlich empfunden?
Die Ablehnung des "Andersartigen" scheint auch eine tiefe Verwurzelung in der fernen Vergangenheit des Menschen zu haben, in der man bestimme äußere Merkmale der Mitglieder einer Gruppe durch sogenannte Vorzugspaarungen erhalten und betonen wollte.
Bei einer Partnerwahl nach dem Grundsatz, "gleich und gleich gesellt sich gern", entwickeln sich bei den Nachkommen über Generationen bestimmte Hautfarben, Kinnformen und Körpergrößen. Ob dies langfristig aber Vor- oder Nachteile hat, wird erst in extremen Situationen wie einer Hungersnot, einem Klimawandel oder Krankheitsepidemien entschieden.
Spätestens dann erweist sich weniger das allzu Uniforme einer Gesellschaft als "schön", sondern eher deren Diversität und genetische Vielfalt.
Auch Krankheiten und Parasiten wir-ken, wie Reichholf darlegt, "als stärkste Triebkräfte der Evolution gleichsam wie bildende Hände am Kunstwerk eines lebendigen Organismus". Und sind mit ein Grund dafür, dass wir Menschen nicht nur nach uniformer Schönheit suchen, sondern immer wieder auch nach der Abweichung vom "Ideal".
Ein Buch, das man auch der Generation "Topmodel und Superstar" auf den Schminktisch legen sollte.