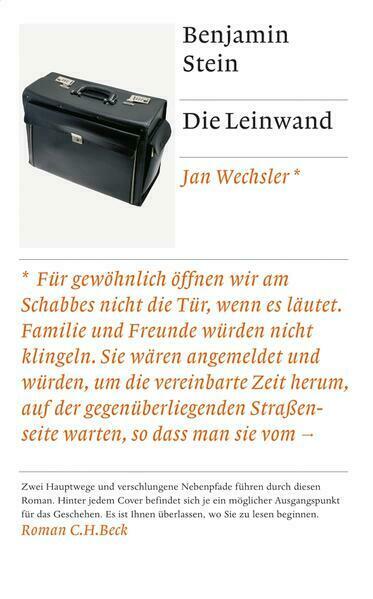"Ohne Schabbes wäre ich wahrscheinlich tot"
Sigrid Löffler in FALTER 31/2010 vom 04.08.2010 (S. 26)
Die Verbesserung der Welt spielt im Werk und Leben des Autors und orthodoxen Juden Benjamin Stein eine herausragende Rolle. Ein Besuch.
Wer sich auf Benjamin Stein einlässt, den Mann und den Romanautor, der muss mit einer biografischen Achterbahnfahrt rechnen. Benjamin Stein – der ursprünglich ganz anders hieß – kann mit einem verwirrenden Spiel von Ich-Fiktionen, vielfachem Rollentausch, Berufs- und Identitätswechsel aufwarten wie kaum sonst jemand und einem gleichwohl ganz harmlos und schlicht begegnen. Mit knapp vierzig hat er die unterschiedlichsten Lebensentwürfe – biografisch und literarisch – schneller durchprobiert und wieder abgebrochen, als man "Ost und West" sagen kann.
In einem der Salons seines Münchner Verlags sitzt er einem gegenüber, im schwarzen Anzug und weißen Hemd und mit der schwarzen Yarmulke auf dem Kopf. Er lächelt entspannt, während er die zahlreichen möglichen Lebensläufe aufzählt, die sich ihm seit den 80er-Jahren als Optionen angeboten haben.
Stein entstammt einer kommunistischen Familie in der DDR: Der Großvater war ZK-Mitglied, die Eltern waren beide regimetreue Ingenieure. Als Elfjähriger war er der jüngste Nachwuchspoet im privaten Ostberliner Dichterzirkel des Künstlerpaares Ulrich und Charlotte Grasnick, was in eine Laufbahn als Untergrunddichter à la Wolfgang Hilbig hätte münden können. Auch Hochleistungssportler hätte er werden können: Als Teenager trainierte er für den Olympiakader der DDR – im Einerrudern.
Mit 16 aber rüttelt ihn eine Sinnkrise durch. Er gibt den Hochleistungssport auf, entdeckt seine jüdische Identität und seine Passion fürs jüdische Schrifttum, namentlich den Talmud, und gibt sich den frommen Künstlernamen "Benjamin Stein", der seit 1988 auch in seinem Pass eingetragen ist. Da er als Wehrdienstverweigerer in der DDR nicht studieren darf, wird er Nachtpförtner in einem Altenheim: "Damit habe ich weit mehr verdient als mein Vater, der seit 20 Jahren Ingenieur war."
Nach der Wende von 1989 heißen die provisorischen Lebensentwürfe: Kurzzeitstudent der Judaistik; Literaturstipendiat, Jungautor und Romandebütant ("Das Alphabet des Juda Liva"); IT-Journalist in München und Korrespondent diverser Computerzeitschriften; Unternehmensberater für Informationstechnologie; Buchverleger und Inhaber eines kleinen Avantgardeverlags (Edition Neue Moderne); Verfasser eines vielgelobten und höchst originellen zweiten Romans, "Die Leinwand", in dem es vor allem um das Vexierspiel mit jüdischen Identitäten und um Ich-Fiktionen des Autors geht.
Die wichtigste Lebensentscheidung, die alles Bisherige umstürzt, trifft Benjamin Stein im Jahr 2000: Als 30-Jähriger entschließt er sich, "Schabbes zu halten, streng zu leben und Ernst zu machen mit dem orthodoxen Judentum". Die längste Zeit habe er sich vor dieser Entscheidung gedrückt, sagt er, aber nachdem er geheiratet hatte und an Kinder dachte, war es so weit: "Jetzt bist du dran, jetzt musst du es tatsächlich auch tun." Nämlich: "die Tradition weitergeben". Stein lächelt: "Wie die Rabbiner sagen: Du kannst dich der Aufgabe verweigern, aber du hast sie."
Die Münchner jüdische Gemeinde hat 10.000 Mitglieder, aber maximal 40 fromme Familien. Die Familie Stein ist eine davon. Ist der Entschluss, streng nach dem Gesetz zu leben, in einer säkularisierten Umwelt nicht besonders schwierig durchzuhalten? "Die Leinwand" vermittelt eine Ahnung davon, wie kompliziert es sein muss, die rigorosen Vorschriften im täglichen Leben einzuhalten, von den Essens- bis zu den Sabbat-Regeln.
Benjamin Stein erlebt das anders: "Ich empfinde das nicht als Einschränkung. Für mich persönlich ist das die einfachere Art zu leben. Eine Gesetzesreligion gibt dem Alltag ja auch ein Gerüst und eine Struktur. Sie fokussiert auf das Wesentliche. Und sie entschleunigt das Leben. Hätte ich nicht angefangen, Schabbes zu halten, wäre ich wahrscheinlich schon tot – tot umgefallen, weil ich rund um die Uhr gearbeitet habe. Im observanten Leben aber gibt es diese ganz unverhandelbaren Entschleunigungen."
Steins Erweckungserlebnis aber ist und bleibt der Talmud. "Am Talmud hat mir der intellektuelle Anspruch imponiert – die große Aufgabe, die da jedem Einzelnen gestellt wird. Man überliefert, man sorgt dafür, dass das Gesetz in seiner Gesamtheit überlebt." Wenn es niemanden mehr gäbe, der die Idee am Leben erhält, dann würde sie binnen weniger Generationen vollständig verschwinden. Steins Beispiel, um das zu veranschaulichen, ist die "Broken-Window-Theory": "Ein verlassenes Haus geht kaputt und verfällt, sobald die erste Fensterscheibe eingeschmissen ist. Mit Ideen ist das nicht anders. Und dass die Idee überlebt, erfordert aktiven Einsatz."
Dieser Gedanke, der in der Kabbala "Tikkun" heißt, prägt auch Steins jüngsten Roman: "Tikkun ist die Verbesserung der Welt durch Menschenhand. Der Mensch ist Partner des Ewigen in der ständigen Neuerschaffung der Welt: Wenn er sich dieser Aufgabe entzieht, zerfällt die Schöpfung."
"Die Leinwand" ist ein erstaunliches und hochintelligentes Buch – verblüffend virtuos, spannend zu lesen und zugleich tiefsinnig und unterhaltsam. Das Buch ist ein Doppelroman mit zwei Helden, Amnon Zichroni und Jan Wechsler, und zwei Eingängen: Man kann ihn von vorne oder von hinten zu lesen beginnen; man kann die beiden Erzählstränge und Lebensgeschichten aber auch kapitelweise alternierend lesen. Die beiden Erzählstränge laufen aufeinander zu. Genau in der Mitte des Buches stoßen sie aufeinander und verknäueln sich zu einem konfliktreichen, rätselhaften Finale. Ein Showdown als Denksportaufgabe: Wer geht hier wem in die Falle?
Ein zweites Thema, neben dem Tikkun, ist die jüdische Identitätssuche in einem ultraorthodoxen, einem modern-orthodoxen oder einem säkularen Milieu. Welche Rolle spielt die Religion und welche der Holocaust bei der Konstruktion einer jüdischen Identität heute? Der Autor hat Jan Wechsler mit den Eckpunkten seiner eigenen wechselhaften Biografie ausgestattet – durchaus selbstironisch, denn er zeichnet ihn als eine fragwürdige, unzuverlässige und schillernde Doppelgängerfigur.
Wechslers Gegenspieler ist Amnon Zichroni, ein frommer und streng lebender Psychoanalytiker, der zwar der Schwarzen Pädagogik von Mea Shearim, Jerusalems Orthodoxenviertel, glücklich entkommen ist, dafür aber unheilvoll in die Identitätsprobleme des Geigenbauers Minsky verwickelt wird.
Minsky ist der Dreh- und Angelpunkt des Romans und erinnert deutlich an den Fall des Schweizers Binjamin Wilkomirski, der fälschlich behauptete, als Kind Auschwitz überlebt zu haben, aber selbst an seine Legende glaubte. Im Roman ist es Wechsler, der Minsky entlarvt – und ihn damit ebenso ruiniert wie seinen Mentor Zichroni. Wofür sich Zichroni zu rächen weiß.
Dass Benjamin Stein den Leser in eine weitgehend unbekannte Welt führt – die der jüdischen Orthodoxie mit ihren jahrtausendealten strengen Traditionen –, gibt seinem Roman einen besonderen Reiz. Und natürlich ist der Roman selbst Tikkun – ein Versuch der Neuerschaffung der Welt durch das Wort.