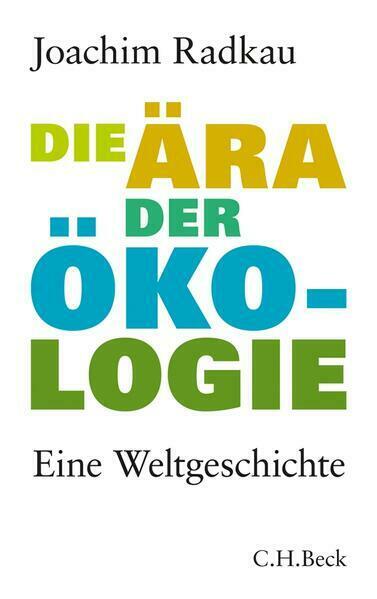Kurze Geschichte und schnelles Vergessen
Karin Chladek in FALTER 10/2011 vom 09.03.2011 (S. 36)
Ökologie: Joachim Radkau legt eine umfangreiche und spannende Geschichte der Umweltbewegung vor
J oachim Radkau hat ein neues Buch über sein Lebensthema veröffentlicht. Der Bielefelder Historiker mit den Forschungsschwerpunkten Technik- und Umweltgeschichte und großem Interesse an Philosophie wurde bekannt, als er im Jahr 2000 eine vielbeachtete globale Umweltgeschichte unter dem Titel "Natur und Macht" publizierte und diese 2002 noch erweiterte. In seinem neuen Werk "Ära der Ökologie" widmet sich Radkau der Geschichte der Umweltbewegung, die spätestens in den 70er-Jahren global an Schwung gewann.
Kein einfaches Unterfangen, denn wie allen klar sein dürfte, die sich auch nur ansatzweise mit der Thematik befasst haben, ist gerade die Umweltbewegung heterogen und von inneren Widersprüchen geprägt wie kaum eine andere politische Kraft. Das lässt sich schon innerhalb von Nationalstaaten und einzelnen Kulturräumen feststellen – und erst recht in globaler Hinsicht. Dazu kommt noch, wie Radkau mehrfach betont, eine eigenartige Geschichtsvergessenheit: "Die Geschichte der Öko-Ära ist nicht nur die Geschichte einer neuen Aufklärung, nicht nur eine Wissens-, sondern auch eine Vergessensgeschichte. Viele Namen, die einst eine Zeitlang die Zukunft zu verkörpern schienen, sind heute selbst innerhalb der Öko-Szene unbekannt."
Daher sind beträchtliches Insiderwissen und hervorragende Kontakte zu zahlreichen Umweltakteuren sowohl in Politik und Verwaltung als auch bei den Nichtregierungsorganisationen nötig, um sich überhaupt an eine Geschichte der Umweltbewegung wagen zu können. Über beides verfügt Joachim Radkau seit geraumer Zeit.
Um die Komplexität der Umweltbewegung und ihre stets präsenten, wenn auch von vielen Protagonisten aktiv ignorierten Widersprüchlichkeiten und Konfliktpunkte erzählerisch in den Griff zu bekommen, orientiert sich Radkau in "Ära der Ökologie" an Leitmotiven und Spannungszonen, die die Umweltbewegung geprägt haben: am Problem der Prioritätensetzung, am Antagonismus zwischen charismatischer Zivilbewegung und fortschreitender Bürokratisierung, am Paradigma Atomkonflikt, an der Frage, ob Naturschutz für oder gegen den Menschen betrieben wird, sowie am Wechselspiel zwischen globaler Bewegung und lokalen Anliegen, um nur einige zu nennen.
Radkau betont: "Die globale Geschichte der Umweltbewegung ist keine harmonische Geschichte. Gerade durch den transnationalen Vergleich erkennt man, in welch unterschiedlichen Welten viele Umweltinitiativen leben und wie wenig sie in Wahrheit voneinander wissen. Eine grenzüberschreitende Kommunikation kann erst dann gelingen, wenn man sich die Unterschiede bewusst macht."
Auch wenn die jüngsten internationalen Umwelt- und Klimakonferenzen allesamt gescheitert sind, ist für Radkau trotz eigener Skepsis noch nicht gesagt, dass der globale Top-down-Ansatz, der sich vom Abstrakten, Allgemeinen schrittweise zum Konkreten, Speziellen vorarbeitet, in umweltpolitischer Hinsicht nicht funktioniert: "Die tief verwurzelte Regionalität der Umweltbewegung ist nur die eine Seite: Der globale Horizont, so imaginär er auch sein mochte, gehörte frühzeitig dazu." Während die US-amerikanische Umweltbewegung sehr lokal und regional orientiert ist und die internationalen Umweltkonferenzen für wenig sinnvoll hält, liefern diese in anderen Ländern, wie zum Beispiel in China, allerdings wesentliche Impulse für die dortige Umweltdiskussion.
Die Geschichte der Umweltbewegung kann – auch aufgrund der zeitlichen Nähe – wohl kaum aus einer distanzierten Perspektive erzählt werden. Joachim Radkau ist Wissenschaftler, ein renommierter Historiker – und gleichzeitig ist er seit mehr als 40 Jahren umweltpolitisch engagiert. Anhand seines eigenen Werdegangs kann er auch die teilweise problematische Spaltung zwischen "Experten" und "Basis" nachvollziehen: "Mein primärer Impuls, als ich die Umweltinitiativen als ,meine' Bewegung empfand, war vor vierzig Jahren der Hass auf den Lärm und den unaufhaltsam vordringenden Autoverkehr. Für Global-Ökologen ist das Lärmproblem aber uninteressant; Anti-Lärm-Initiativen, die per se lokal sind, werden als bornierte NIMBY-Bewegungen (,Not in my backyard', etwa: nach dem Florianiprinzip handelnd) abgetan."
Für Radkau ist diese zunehmende Abstraktion von globalen Umweltproblemen und deren scheinbare Unzugänglichkeit für die meisten Menschen die größte Herausforderung der Umweltkommunikation, von der aktuell alles abhängen könnte: "Der globale und nachhaltige Erfolg des Umweltschutzes dürfte entscheidend daran hängen, ob es gelingt, ihn an einer begrenzten Zahl von klaren und einfachen, allen vernünftigen Menschen einsichtigen Regeln festzumachen (...). Eben darin besteht der praktische Nutzen eines Rückblicks über die vergangenen Jahrzehnte: Hinter dem bis ins Unendliche anschwellenden Wust der Umweltschutzbestimmungen doch die einfachen Grundmotive wiederzuerkennen. Wenn ein Menschenrecht auf sauberes Wasser, gute Luft, gesunde Ernährung und ruhigen Schlaf (...) durchgesetzt wird, dann wird damit zugleich auch ein Großteil der Umweltprobleme in Angriff genommen. Nur im Einklang mit der menschlichen Natur kann die menschliche Beziehung zur Natur reformiert werden. Die Klimapolitik verrennt sich als bloße Klimapolitik in Sackgassen."
Eines macht Radkaus ebenso ambitionierte wie spannende Zusammenschau deutlich: Auch wenn Umweltinitiativen meist im Hier und Jetzt leben, würde sich ein Blick wenige Jahrzehnte zurück auch für sie selbst oft lohnen. So kurz die Weltgeschichte der Umweltbewegung nach historischen Maßstäben auch noch sein mag, fasziniert sie doch schon heute aufgrund ihrer Vielfalt, Komplexität und des immer neuen Wechselspiels ihrer Leitmotive. Im Übrigen gilt: "The future is unwritten" (Joe Strummer).